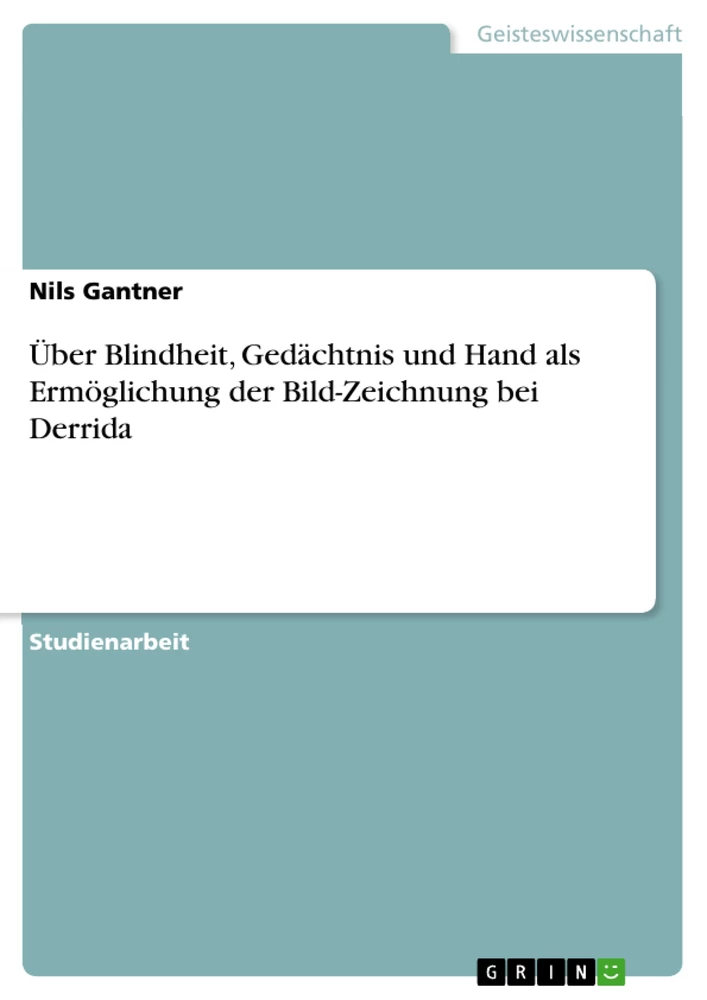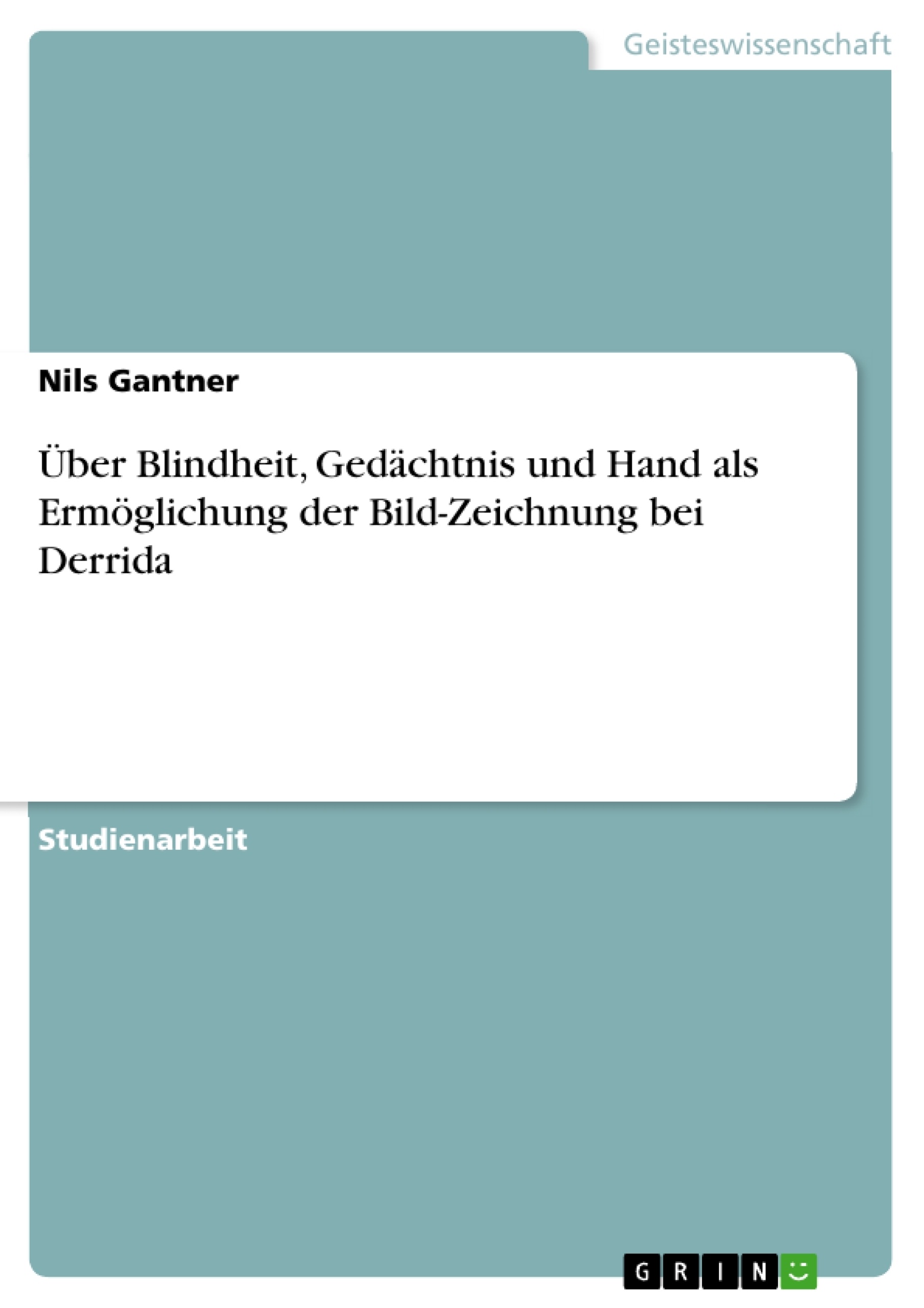Absicht vorliegender Arbeit ist es, Derridas phänomenologische Bildtheorie, wie er sie in den "Aufzeichnungen eines Blinden" (dt. 1997) hinsichtlich der Bild-Zeichnung entwickelt, in ihren wesentlichen Zügen zu erfassen. Allerdings muss diesbezüglich angemerkt werden, dass Derrida nicht explizit den Anspruch erhebt, eine phänomenologische Bildtheorie in seinem Text zu entwerfen, diese jedoch implizit dort enthalten ist. Sein Text lässt sich also als im Sinne einer Bildtheorie lesen.
Eine grundlegende Frage, die im Laufe der Arbeit zu klären sein wird, lautet daher, wie bei Derrida die Bild-Zeichnung konstituiert wird. Hierzu schlägt er zwei Hypothesen vor: (1.) Der Zeichner oder die Zeichnerin ist blind. Und (2.) Die Zeichnung eines Blinden ist die Zeichnung eines Blinden. Diese beiden Hypothesen, die Derridas Text leiten, werde ich anhand ausgewählter Begriffe seiner Terminologie erläutern. Beispielhaft wären hier die transzendentale und die sakrifizielle Blindheit zu nennen, die für das Verständnis von Derridas phänomenologischer Bildposition wesentlich sind. Zudem möchte ich die These vertreten, dass die Theoreme Blindheit, Gedächtnis und Hand essentiell für Derridas Bildtheorie sind und ohne diese kein „Denken der Zeichnung“ möglich ist.
Des Weiteren möchte ich der Frage nachgehen, ob Derridas bildphänomenologische Aussagen auch als eine phänomenologische Ästhetik aufgefasst werden können. Handelt es sich hier also um eine „dekonstruktive“ Ästhetik? Oder sollte man eher von einer „Ästhetik der Blindheit“(Nonnenmacher) bei Derrida sprechen? Vielleicht auch eine „Ästhetik der Abwesenheit“ (Kamper)? Und in welchem Verhältnis würde diese zur traditionellen Ästhetik stehen? Diesem Fragenkomplex soll nachgegangen werden.
Da Derrida sich in seinem Text auch mit anderen Autoren der philosophischen Tradition hinsichtlich des Themas der Blindheit bzw. der Visualität auseinandersetzt, ist es daher unumgänglich, auf seine Bezüge zu Platon (Der Staat), Descartes (Dioptrik) und Merleau-Ponty (Das Sichtbare und das Unsichtbare) einzugehen. Auf andere Bücher Derridas soll ebenso Bezug genommen werden, da die Beschäftigung mit der Bild-Zeichnung schon in der "Grammatologie" (1967) ihren Ausgangspunkt hat. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick. Einen besonderen Bezug soll es zur phänomenologischen Forschung (Antje Kapust, 2009) geben.
Inhaltsverzeichnis
- A: Einleitung
- B: Über Blindheit, Gedächtnis und Hand als Ermöglichung der Bild-Zeichnung bei Derrida
- 1. Sakrifizielle und transzendentale Blindheit als Bedingung der Bild-Zeichnung oder über Gabe, Gedächtnis und apokalyptische Blindheit
- 2. Die Hand und ihre Bedeutung für die Bild-Zeichnung
- C: Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Derridas phänomenologische Bildtheorie, wie er sie in den Aufzeichnungen eines Blinden (dt. 1997) hinsichtlich der Bild-Zeichnung entwickelt, in ihren wesentlichen Zügen zu erfassen. Derrida selbst erhebt jedoch nicht explizit den Anspruch, eine phänomenologische Bildtheorie zu entwerfen, diese ist aber implizit in seinem Text enthalten. Die Arbeit geht der Frage nach, wie bei Derrida die Bild-Zeichnung konstituiert wird, und untersucht die Bedeutung der Blindheit, des Gedächtnisses und der Hand für Derridas Bildtheorie.
- Die Rolle der sakrifiziellen und der transzendentalen Blindheit in der Bild-Zeichnung
- Der Zusammenhang zwischen Gedächtnis und Bild-Zeichnung
- Die Bedeutung der Hand als Werkzeug der Bild-Zeichnung
- Die Frage nach einer „dekonstruktiven“ Ästhetik bei Derrida
- Derridas Bezug zu anderen Philosophen wie Platon, Descartes und Merleau-Ponty
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet Derridas beiden Grundhypothesen zur Bild-Zeichnung: Der Zeichner ist blind, und die Zeichnung eines Blinden ist die Zeichnung eines Blinden. Derrida stellt die Bedeutung des Gedächtnisses für den Zeichenvorgang heraus, indem er auf Baudelaires „Gedächtniskunst“ verweist. Er argumentiert, dass die Blindheit des Zeichners eine Bedingung für die Möglichkeit der Bild-Zeichnung ist.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Begriffen der sakrifiziellen und der transzendentalen Blindheit. Derrida argumentiert, dass die sakrifzielle Blindheit ein „Opferereignis“ ist, das den Bruch mit der sichtbaren Welt markiert. Die transzendentale Blindheit hingegen ist die unsichtbare Bedingung der Möglichkeit der Bild-Zeichnung.
Schlüsselwörter
Bild-Zeichnung, Blindheit, Gedächtnis, Hand, transzendentale Blindheit, sakrifzielle Blindheit, Gabe, Opferereignis, Dekonstruktion, Ästhetik, Phänomenologie, Merleau-Ponty, Platon, Descartes, Baudelaire
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Derridas Theorie zur Bild-Zeichnung?
Derrida postuliert, dass Blindheit eine wesentliche Bedingung für die Bild-Zeichnung ist, da der Zeichner aus dem Gedächtnis und nicht durch simultanes Sehen agiert.
Was unterscheidet sakrifizielle von transzendentaler Blindheit?
Die sakrifizielle Blindheit markiert den Bruch mit der sichtbaren Welt (Opferereignis), während die transzendentale Blindheit die unsichtbare Bedingung der Möglichkeit des Zeichnens ist.
Welche Bedeutung hat das Gedächtnis für den Zeichenprozess bei Derrida?
Da der Zeichner den Blick vom Objekt auf das Papier abwendet, wird die Zeichnung zu einem Akt der Erinnerung (Baudelaires „Gedächtniskunst“).
Warum spielt die Hand eine zentrale Rolle in dieser Bildtheorie?
Die Hand fungiert als das tastende Werkzeug, das die Verbindung zwischen dem Unsichtbaren (Gedanken/Gedächtnis) und der sichtbaren Spur auf dem Papier herstellt.
Auf welche philosophischen Vorläufer bezieht sich Derrida?
Er setzt sich kritisch mit Platon (Visualität), Descartes (Dioptrik) und Merleau-Ponty (Das Sichtbare und das Unsichtbare) auseinander.
- Quote paper
- Nils Gantner (Author), 2009, Über Blindheit, Gedächtnis und Hand als Ermöglichung der Bild-Zeichnung bei Derrida, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316638