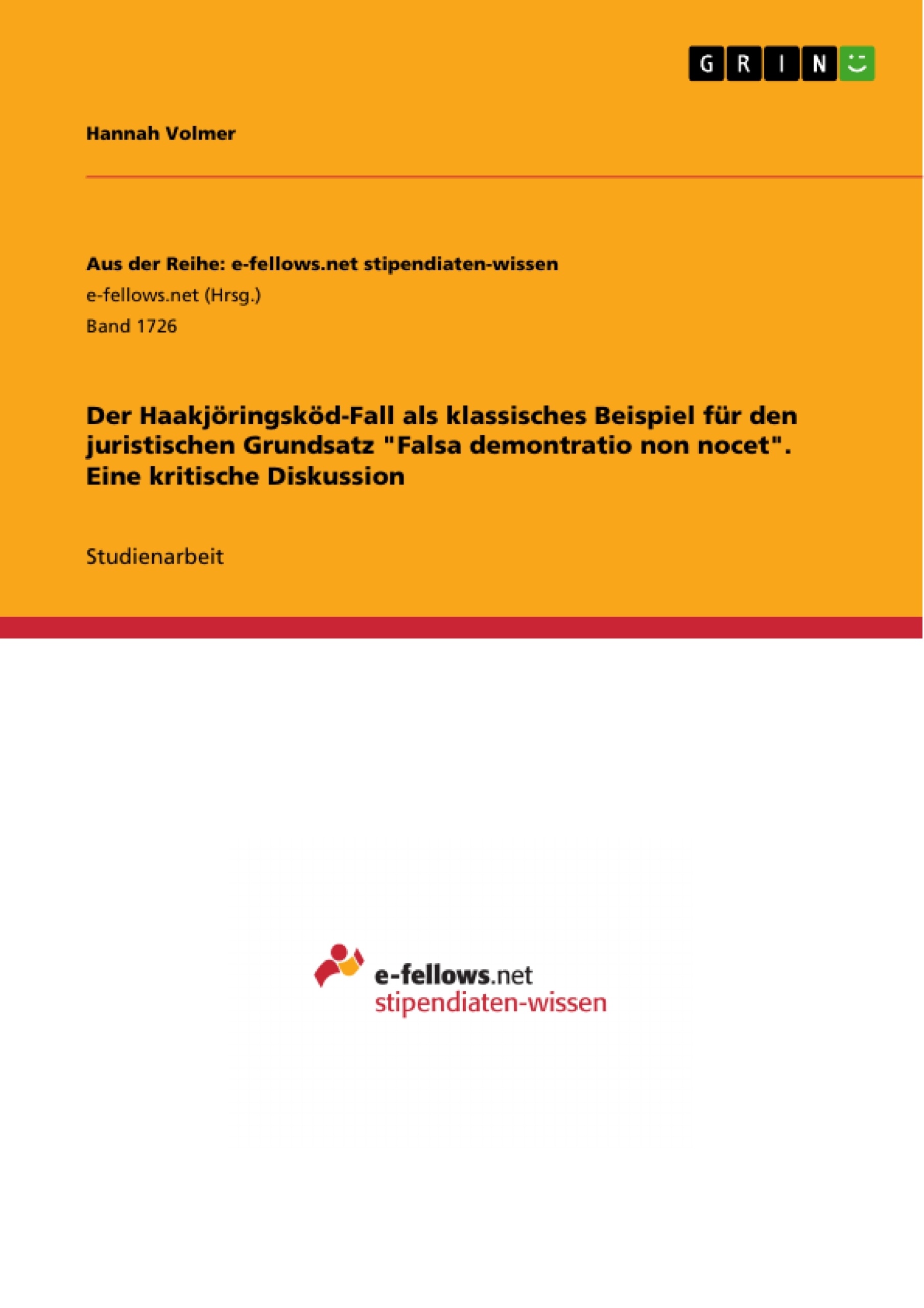„Falsa demonstratio non nocet“ und „Auslegung vor Anfechtung“ – jeder Erstsemesterstudent der Rechtswissenschaft kennt diese Grundsätze und verbindet sie direkt mit dem sogenannten Haakjöringsköd-Fall (RGZ 99, 147), dem „klassischsten“ Fall („Musterbeispiel“/„Schulbeispiel“) auf diesem Gebiet. Er gilt zugleich als der Fall, der in der Rechtsprechung die Wende hinsichtlich des subjektiven Fehlerbegriffs im Mängelgewährleistungsrecht („Geburtsstunde“) gebracht hat. Und endlich ist dies der Fall, der in der Literatur auf höchst unterschiedliche Weise interpretiert wird und zum Teil für heftige Kritik hinsichtlich der Notwendigkeit beider genannten Grundsätze gesorgt hat.
Erstaunlich ist jedoch, dass das Reichsgericht in seinen Entscheidungsgründen weder den Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“ ausdrücklich genannt hat, noch dass es eine allgemeine Definition des subjektiven Fehlerbegriffs geliefert hat (oder das Wort „Fehler“ überhaupt verwendet hat), obwohl gerade bei einer Abkehr von der alten Rechtsprechung zum objektiven Fehlerbegriff davon auszugehen wäre.
Ziel und Zweck dieser Seminararbeit ist es deshalb, die historische Entwicklung des bereits Gelernten nachzuvollziehen und die im Studium vermittelten Grundsätze kritisch zu hinterfragen. Zu erörtern sind im Besonderen die Frage der (historischen) Bedeutung des Urteils und die geschichtliche Entwicklung, sowie die Existenzberechtigung des Grundsatzes falsa demonstratio non nocet und des subjektiven Fehlerbegriffs. Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Zunächst werden Sachverhalt und Entscheidungsgründe des Falles dargestellt, sodann wird die historische Entwicklung vor und nach der Entscheidung hinsichtlich der beiden Grundsätze, das heißt die Hintergründe und Auswirkungen, erläutert. Im zweiten Teilkomplex dieser Arbeit werden die Grundsätze reflektiert untersucht und kritisch hinterfragt. Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Kritik der Literatur, die mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse endet.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einführung: Problemaufriss..
- B) Grundlagen: Die Entscheidung RGZ 99, 147.
- I) Der zugrunde liegende Sachverhalt..
- II) Die Entscheidungsgründe
- III) Die historischen und rechtlichen Hintergründe der Entscheidung.
- 1) Warum ein Kaufvertrag über Walfischfleisch?
- 2) Warum ist Haifischfleisch fehlerhaftes Walfischfleisch?..
- IV) Die historische Entwicklung der beiden Grundsätze ...
- 1) Die allgemeine Definition der beiden Grundsätze.
- 2) Der Grundsatz falsa demonstratio non nocet
- a) Römisches Recht und Frühklassik.
- b) Hoch- und Spätklassik..
- c) Gemeines Recht.....
- d) Heutiges Recht nach Inkrafttreten des BGB..
- 3) Der subjektive Fehlerbegriff nach § 459 I BGB a.F.
- a) Vom Römischen zum Gemeinen Recht.
- b) Heutiges Recht nach Inkrafttreten des BGB.
- V) Die weitere Entwicklung: Auswirkung der Entscheidung.
- 1) Der Grundsatz falsa demonstratio non nocet..
- 2) Der subjektive Fehlerbegriff nach § 459 I BGB a.F.
- a) Nach Inkrafttreten des BGB (1920 - 2002).
- b) Nach Inkrafttreten des Schuldrechts-modernisierungsgesetzes (ab 2002)
- C) Kritische Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgründen
- I) Der Grundsatz falsa demonstratio non nocet..
- 1) Die generelle Regel zur Auslegung von Willenserklärungen .
- 2) Die Notwendigkeit einer festgeschriebenen Regel?.
- a) § 116 BGB
- b) § 117 BGB.
- c) §§ 133, 157 BGB
- d) Gewohnheitsrecht.
- e) Zwischenergebnis.
- 3) Nichtnennung des Grundsatzes durch das RG..
- 4) Nachtrag: Der wirkliche Inhalt der Regel ........
- II) Der subjektive Fehlerbegriff nach § 459 I BGB a.F.
- 1) Auseinandersetzung mit der Lösung des RG.
- a) Nichtigkeit wegen anfänglicher Unmöglichkeit, § 306 BGB a.F.
- b) Erfüllungspflicht nach §§ 440 I, 320 ff., 326 BGB a.F.
- c) Anfechtung nach § 119 II BGB.
- d) Zwischenergebnis..
- 2) Auseinandersetzung mit dem subjektiven Fehlerbegriff ..
- a) Der objektive Fehlerbegriff..
- b) Der objektiv-subjektive Fehlerbegriff ..
- c) Der (Zusicherungs-) Fehlerbegriff..
- d) Zwischenergebnis.
- D) Zusammenfassung: Ausblick....
- Der Grundsatz "falsa demonstratio non nocet" (falsche Bezeichnung schadet nicht)
- Der subjektive Fehlerbegriff im Kaufrecht
- Die Auslegung von Willenserklärungen
- Die Bedeutung von Gewohnheitsrecht im Zivilrecht
- Die historische Entwicklung des deutschen Zivilrechts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Haakjöringsköd-Fall, einer berühmten Entscheidung des Reichsgerichts (RGZ 99, 147), die einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des deutschen Zivilrechts geleistet hat. Die Arbeit analysiert die Rechtsgrundlagen, die historischen und rechtlichen Hintergründe sowie die Auswirkungen der Entscheidung auf die Weiterentwicklung des Rechts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Haakjöringsköd-Fall und stellt die relevante Rechtsprechung des Reichsgerichts vor. Anschließend werden die historischen und rechtlichen Hintergründe der Entscheidung untersucht, insbesondere die Frage, warum ein Kaufvertrag über Walfischfleisch geschlossen wurde und warum Haifischfleisch als fehlerhaftes Walfischfleisch betrachtet wurde. Die Arbeit beleuchtet dann die historische Entwicklung der beiden zentralen rechtlichen Grundsätze, "falsa demonstratio non nocet" und der subjektive Fehlerbegriff im Kaufrecht, und analysiert deren Anwendung im deutschen Recht. Abschließend wird die Arbeit die Auswirkungen der Entscheidung auf die weitere Entwicklung des Rechts untersuchen und eine kritische Auseinandersetzung mit den Entscheidungsgründen des Reichsgerichts liefern.
Schlüsselwörter
Haakjöringsköd-Fall, Reichsgericht, falsa demonstratio non nocet, subjektiver Fehlerbegriff, Kaufrecht, Willenserklärungen, Gewohnheitsrecht, historische Entwicklung des deutschen Zivilrechts.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der juristische Grundsatz „falsa demonstratio non nocet“?
Es bedeutet „eine falsche Bezeichnung schadet nicht“. Wenn sich beide Parteien einig sind, was gemeint ist, spielt die falsche Benennung im Vertrag keine Rolle.
Worum ging es im berühmten Haakjöringsköd-Fall?
Die Parteien schlossen einen Vertrag über „Haakjöringsköd“ (norwegisch für Haifischfleisch), meinten aber beide Walfischfleisch. Das Gericht entschied, dass der Vertrag über Walfischfleisch gültig war.
Warum ist dieser Fall für Erstsemester im Jurastudium so wichtig?
Er ist das Musterbeispiel für die Auslegung von Willenserklärungen (§§ 133, 157 BGB) und den Vorrang der Auslegung vor einer Anfechtung wegen Irrtums.
Was ist der „subjektive Fehlerbegriff“ im Kaufrecht?
Er besagt, dass eine Sache fehlerhaft ist, wenn sie nicht die Beschaffenheit aufweist, die die Parteien subjektiv vereinbart haben, unabhängig von objektiven Standards.
Welche historische Bedeutung hat das Urteil RGZ 99, 147?
Es gilt als „Geburtsstunde“ des subjektiven Fehlerbegriffs in der deutschen Rechtsprechung und markiert die Abkehr vom rein objektiven Fehlerbegriff.
- Citation du texte
- Hannah Volmer (Auteur), 2016, Der Haakjöringsköd-Fall als klassisches Beispiel für den juristischen Grundsatz "Falsa demontratio non nocet". Eine kritische Diskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316672