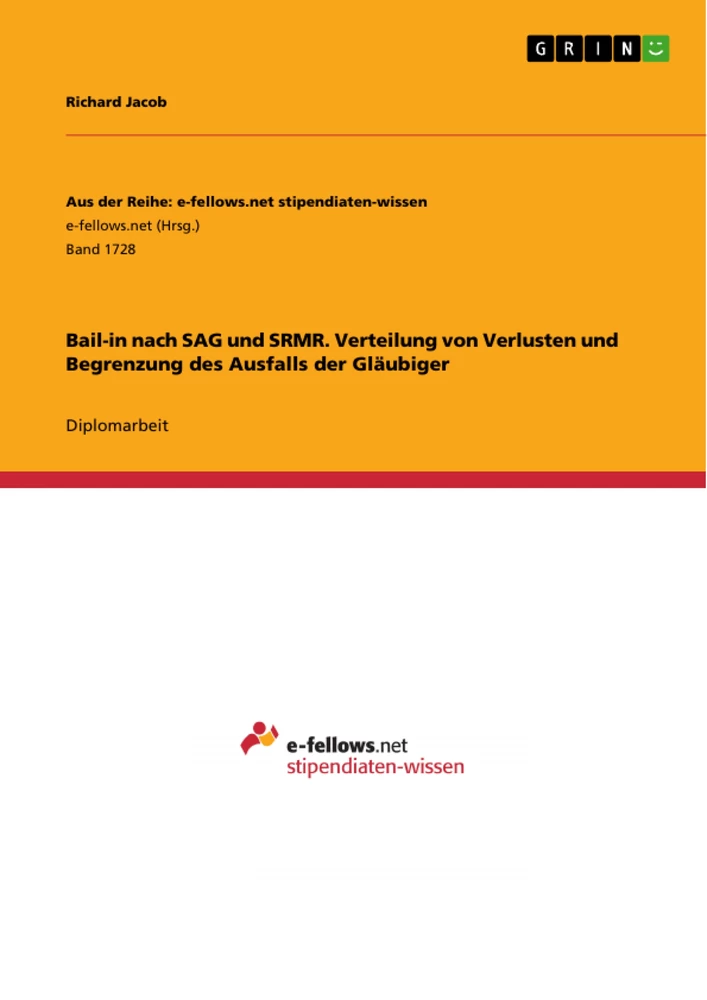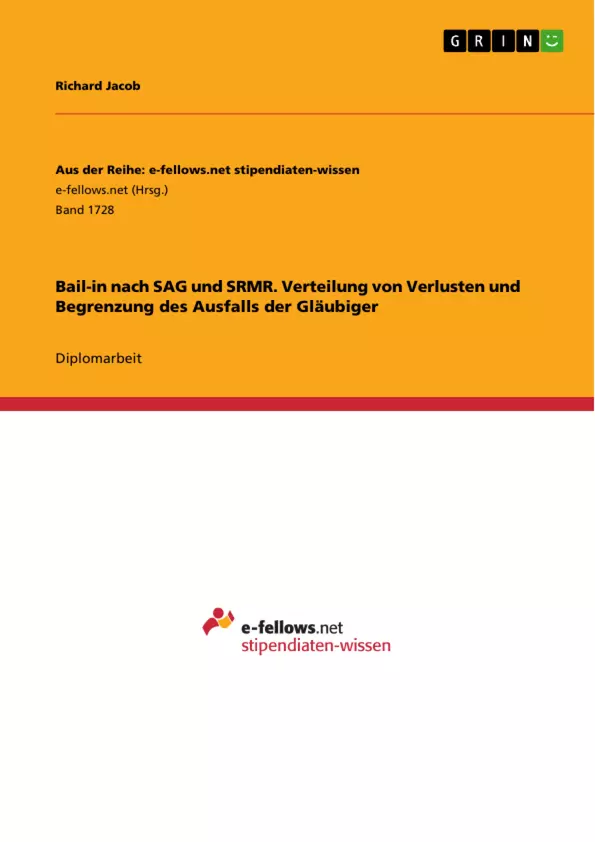Die Beleuchtung des Konzepts des „Bail-in“ und ein Überblick über das Verhältnis von dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) und der Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR) hinsichtlich des Bail-in-Instruments führen in das Thema dieser Arbeit ein.
Anschließend wird der Bail-in nach dem SAG analysiert, indem die Tatbestandsseite und dabei insbesondere die erfassten Forderungen sowie die Rechtsfolgenseite mit ihren diskretionären Ausnahmen dargestellt werden (Punkt B.). Ausgeklammert werden Sonderregelungen zu Derivaten sowie zu grenzüberschreitenden Sachverhalten und Konzernfragen.
Im weiteren Verlauf werden die Unterschiede des Bail-in-Instruments in der SRMR dargestellt und die Bedeutung der Unterschiede verdeutlicht (Punkt C.).
Bei der Untersuchung des Bail-in-Instruments wird in dieser Arbeit dem engen Verständnis von Art. 2 Abs. 1 Nr. 57 der Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) gefolgt, sodass die Umwandlung und Herabschreibung von relevanten Kapitalinstrumenten nach § 89 SAG beziehungsweise Art. 21 SRMR nicht näher beleuchtet wird.
Schließlich wird das Bail-in-Instrument hinsichtlich der Verteilung der Verluste auf die Gläubiger bewertet (Punkt D.).
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- I. Das Konzept des Bail-in
- II. Überblick zum Verhältnis von SAG und SRMR hinsichtlich des Bail-in-Instruments
- B. Bail-in nach dem SAG
- I. Tatbestandsvoraussetzungen
- 1. Allgemeine Voraussetzungen für Abwicklungsmaßnamen
- 2. Spezielle Voraussetzungen für einen Bail-in
- a) Ausschöpfung vorrangiger Maßnahmen
- b) Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten
- aa) Ausnahmen mit Bezug zur Einlagensicherung
- bb) Ausnahmen wegen insolvenzrechtlicher Aus- und Absonderungsrechte
- cc) Ausnahmen bezüglich Interbankenverbindlichkeiten
- dd) Ausnahmen zur Erhaltung des Geschäftsbetriebes
- c) Sonstige Voraussetzungen
- II. Rechtsfolgen
- 1. Umwandlung, § 90 Nr. 1 SAG
- 2. Herabschreibung, § 90 Nr. 2 SAG
- 3. Restrukturierungsplan
- 4. Die Ausnahmen
- a) Ausnahme wegen zeitlicher Unmöglichkeit
- b) Ausnahmen zur Fortführung kritischer Funktionen
- aa) Kritische Funktionen
- bb) Wesentliche Geschäftsaktivitäten
- cc) Anwendungsbereich des Ausnahmetatbestandes
- c) Ausnahmen zur Vermeidung von Ansteckungsgefahren
- d) Ausnahmen zur Vermeidung von Wertevernichtung
- 5. Maßstab der Ermessensausübung
- III. Rechtsbehelfe der Gläubiger
- 1. Allgemeine Rechtsbehelfe
- 2. Der Ausgleichsanspruch gemäß § 147 S. 1 SAG
- a) Ausnahmen auf der Tatbestandsebene
- b) Ausnahmen auf der Rechtsfolgenseite
- c) Fehlbewertungen
- C. Unterschiede des Bail-in nach der SRMR
- I. Tatbestandsvoraussetzungen
- 1. Allgemeine Voraussetzungen des Abwicklungskonzepts
- 2. Spezielle Voraussetzungen für einen Bail-in
- II. Rechtsfolgen
- III. Rechtsbehelfe
- IV. Folgerungen aus dem Vergleich
- D. Bewertung der Verteilung der Verluste auf die Gläubiger
- I. Bewertung der Ausnahmen
- 1. Kurzfristige Interbankenverbindlichkeiten
- 2. Ansprüche der Einlagensicherungssysteme
- 3. Ausnahmen, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten
- 4. Zeitlich nicht berücksichtigbare Forderungen
- 5. Forderungen, deren Einbeziehung den erforderlichen Umfang der Maßnahme erhöht
- 6. Der Erhalt kritischer Funktionen und die Vermeidung von Ansteckungsgefahren
- 7. Ergebnis zur Rechtfertigung der Ausnahmen
- II. Bewertung des Ausgleichsanspruchs gemäß § 147 SAG
- 1. Werthaltigkeit des Anspruchs
- 2. Gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs
- 3. Ergebnis
- III. Gesamtbewertung der Verteilung
- E. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Anwendung des Bail-in-Instruments im Rahmen des deutschen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (SAG) und der EU-Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (SRMR). Sie analysiert die Verteilung von Verlusten auf Gläubiger im Falle einer Abwicklung und bewertet die Ausnahmen vom Bail-in-Mechanismus.
- Das Konzept des Bail-in und seine Anwendung im deutschen und europäischen Recht
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Bail-in im SAG und der SRMR
- Die Verteilung von Verlusten auf Gläubiger im Rahmen des Bail-in-Prozesses
- Die Ausnahmen vom Bail-in-Mechanismus und ihre Rechtfertigung
- Die Bewertung des Ausgleichsanspruchs der Gläubiger gemäß § 147 SAG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Bail-in ein und gibt einen Überblick über die Regulierung des Instruments im SAG und der SRMR. Das zweite Kapitel analysiert die Voraussetzungen für die Anwendung des Bail-in im SAG, einschließlich der allgemeinen und speziellen Voraussetzungen, der Ausnahmen und des Maßstabs der Ermessensausübung. Das dritte Kapitel beleuchtet die Rechtsfolgen des Bail-in im SAG, einschließlich der Umwandlung, Herabschreibung und Restrukturierung. Das vierte Kapitel untersucht die Rechtsbehelfe der Gläubiger im Fall eines Bail-in, insbesondere den Ausgleichsanspruch gemäß § 147 SAG. Das fünfte Kapitel vergleicht die Unterschiede des Bail-in-Instruments im SAG und der SRMR. Das sechste Kapitel bewertet die Verteilung der Verluste auf die Gläubiger, einschließlich der Ausnahmen und des Ausgleichsanspruchs. Das Ergebnis fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Bail-in, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG), EU-Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (SRMR), Verlustverteilung, Gläubigerschutz, Einlagensicherung, kritische Funktionen, Ansteckungsgefahren, Ausgleichsanspruch, Rechtsbehelfe.
- Quote paper
- Richard Jacob (Author), 2015, Bail-in nach SAG und SRMR. Verteilung von Verlusten und Begrenzung des Ausfalls der Gläubiger, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316736