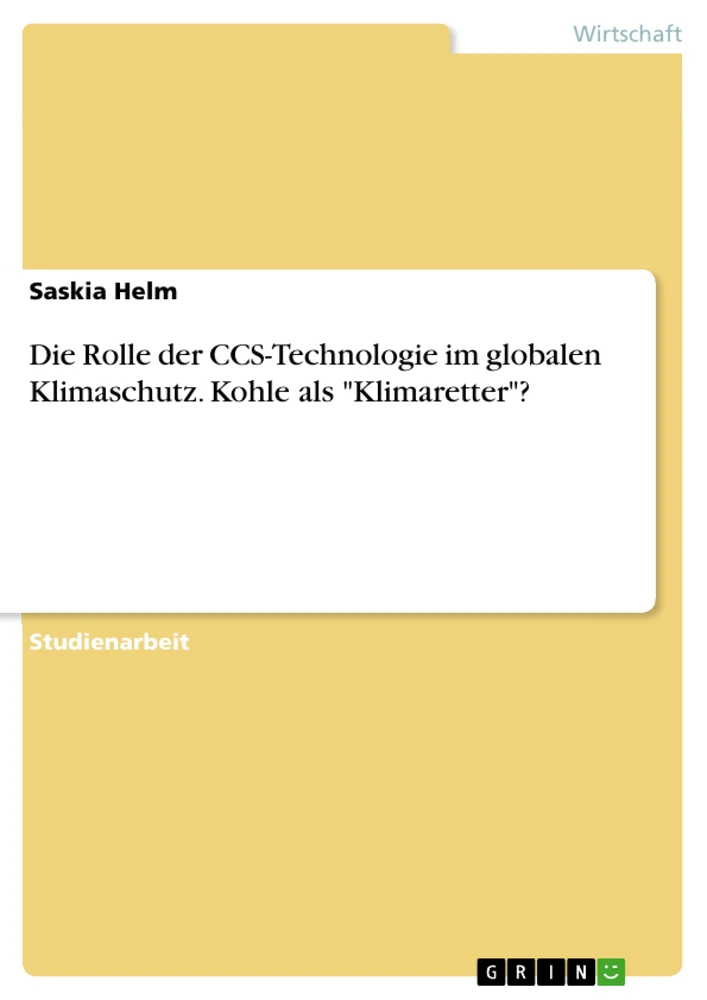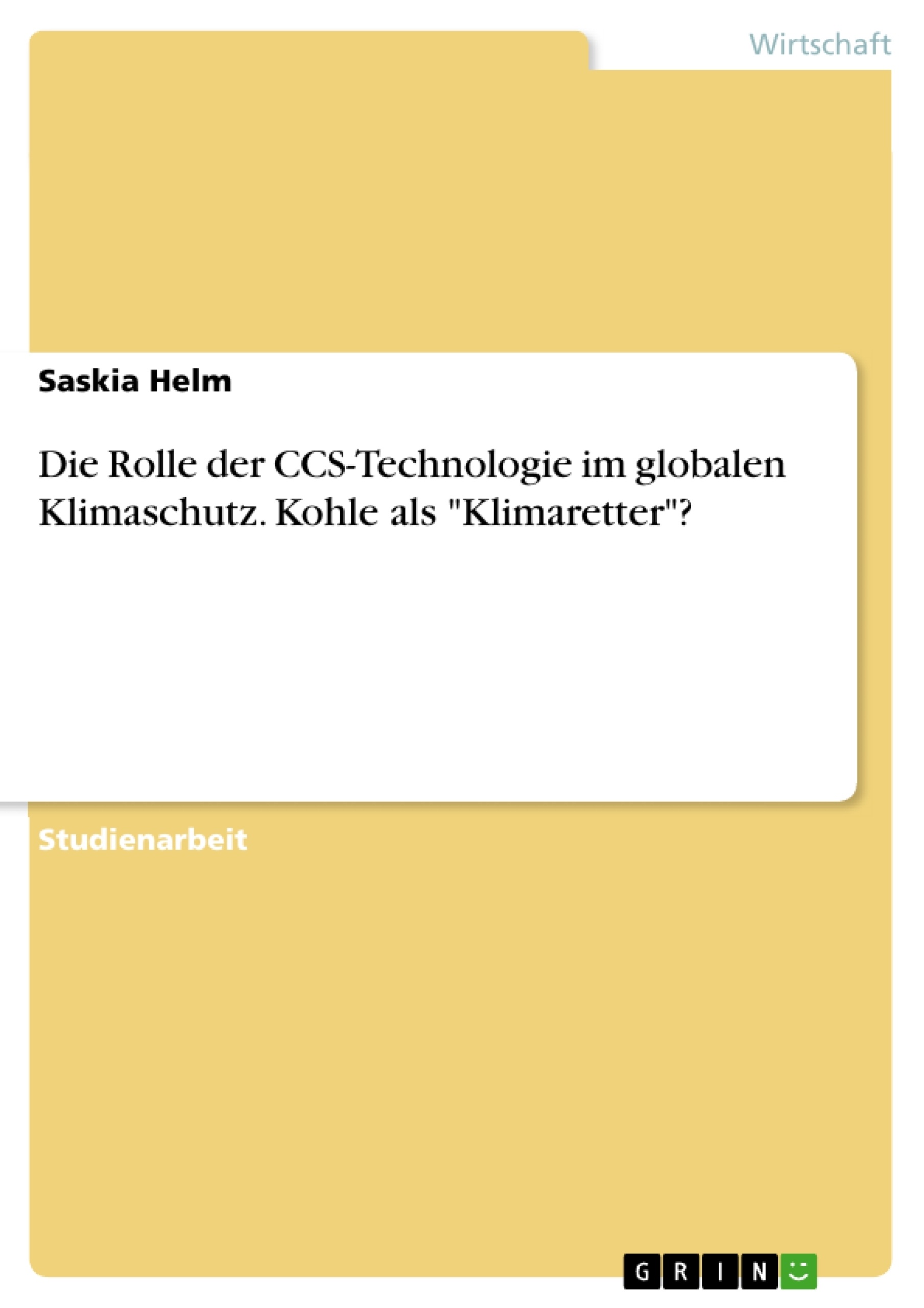CCS-Technologie für die Zukunft: Kann Vattenfall die Kohle in Brandenburg durch die CCS-Technologie "grün" werden lassen?
Ziel vorliegender Hausarbeit ist es, eine Identifizierung von positiven und negativen Begleiterscheinungen der CCS-Technologie vorzunehmen. Diese werden aus Sicht der relevanten Akteure der Energiepolitik, insbesondere im Bundesland Brandenburg, dargestellt.
Hierbei soll die Problematik der Erschließung neuer Braunkohletagebaue in der Lausitz eingehend thematisiert werden. Weiterfolgend soll eine kurze Analyse des Beitrages von CCS zu nationalen Klimaschutzzielen ermöglichen, die Tatsache zu prüfen, ob CCS als bessere Alternative zum Klimaschutz im Vergleich zu erneuerbaren Energien bewertet werden kann.
Die "Horrorszenarien" einer "Klimakatastrophe" als Folge eines weiterhin ungehinderten Ausstoßes des "Klimakillers" CO2 dürften und sollten jedem Bewohner dieser Erde durch die intensivierte Debatte aller gesellschaftlichen Akteure bewusst geworden sein. Umso wichtiger erscheint es, dass geeignete Lösungsstrategien schnellstmöglich etabliert werden, wobei keinesfalls Konsens über die Wahl der richtigen Energieträger und entsprechender Technologien besteht.
Dass erneuerbare Energiequellen einen wesentlichen Anteil haben müssen, steht außer Frage, aber wie sich ein akzeptabler Energiemix, auch in Abhängigkeit von europäischen Diversifizierungsvorhaben und geopolitischen Konflikten in Exportländern, gestalten muss, bedarf genauster Prüfung.
Aufgrund der drastisch notwendigen Reduzierung von CO2-Emissionen scheint es, als wenn die veralteten uneffizienten Energieträger, wie beispielsweise. Kohle, als umweltschädlichster von allen fossilen Brennstoffen, in den folgenden Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung verlieren werden.
Doch zu aller Verwunderung und meinem großen Interesse scheint diese Prognose weit gefehlt, erlebt die Kohlenutzung doch gerade wieder eine Renaissance: Dank ambitionierter Energiekonzerne, auf deren Spitzenposition sich Vattenfall Europe befindet, könnte Kohle durch die neue CCS-Technologie (Carbon Capture and Sequestration) zum "Klimaretter" werden und den fossilen Energieträger "grün" machen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in den Policy-Prozess
- 2. Hintergrund
- 2.1 Stellenwert des Energieträgers Kohle und klimapolitische Aspekte
- 2.2 Was ist die CCS-Technologie?
- 3. Akteure, Interessen und Instrumente der Policy
- 3.1 Akteure: Pro
- 3.1.1 Energiekonzerne: Vattenfall
- 3.1.1.1 Instrumente
- 3.1.2 Bundesregierung
- 3.1.2.1 Instrumente
- 3.1.3 Landesregierung von Brandenburg
- 3.1.3.1 Instrumente
- 3.1.4 EU und IEA
- 3.1.4.1 Instrumente
- 3.2 Akteure: Contra
- 3.2.1 NRO im Umwelt- und Naturschutzbereich, speziell Greenpeace, BUND, Die Grüne Liga
- 3.2.2 Lokale Bevölkerung und regionale Kommunen
- 3.2.2.1 Instrumente
- 3.2.3 Politische Akteure (Parteien:,Die Linke', 'Die Grünen', SPD-Umweltforum; BMU und Umweltministerium BB Landtag)
- 4. Ökonomischer Vergleich regenerativen Energien mit CCS
- 5. Fazit
- CCS-Technologie und deren Einfluss auf den Klimaschutz
- Akteure und Interessen im Kontext der CCS-Technologie
- Ökonomische und ökologische Aspekte der CCS-Technologie
- Soziale und politische Akzeptanz der CCS-Technologie
- Bewertung von CCS im Vergleich zu erneuerbaren Energien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Hausarbeit ist es, die positiven und negativen Begleiterscheinungen der CCS-Technologie zu identifizieren. Diese werden aus Sicht der policy-relevanten Akteure, deren Interessen und Instrumente, insbesondere im Bundesland Brandenburg, dargestellt. Die Problematik der Erschließung neuer Braunkohletagebaue in der Lausitz soll dabei eingehend thematisiert werden. Weiterhin soll die Analyse des Beitrags von CCS zu nationalen Klimaschutzzielen ermöglichen, um zu prüfen, ob CCS als bessere Alternative zum Klimaschutz im Vergleich zu erneuerbaren Energien bewertet werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in den Policy-Prozess
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von CCS-Technologie im Kontext der Klimaschutzdebatte. Die Dringlichkeit einer drastischen Reduktion von CO2-Emissionen wird betont. Die Studie zeigt, dass Kohle durch CCS-Technologie zum "Klimaretter" werden könnte, indem sie CO2-Emissionen reduziert und die Nutzung des fossilen Brennstoffes "grün" macht. Die Arbeit fokussiert auf die Rolle von Vattenfall und die geplanten CCS-Projekte in Brandenburg, insbesondere die 30 MW Pilotanlage in Schwarze Pumpe und das geplante Demonstrationskraftwerk in Jänschwalde. Die Arbeit analysiert die vielfältigen ökologischen, ökonomischen, politischen und sozialen Aspekte der CCS-Technologie.
2. Hintergrund
2.1 Stellenwert des Energieträgers Kohle und klimapolitische Aspekte
Die Relevanz von Kohle als wichtigsten deutschen Energieträger wird beleuchtet, wobei der Fokus auf den hohen CO2-Ausstoß der Kohleverstromung liegt. Die Notwendigkeit einer drastischen Reduktion von CO2-Emissionen im Kontext des Klimawandels wird betont. Es werden die Forderungen der IEA und OECD nach einer "Energierevolution" hin zu einem "CO2-armen" Energiesystem dargelegt.
2.2 Was ist die CCS-Technologie?
Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Funktionsweise der CCS-Technologie, die das CO2 aus Kraftwerken abscheidet, verflüssigt und unterirdisch speichert. Die Technologie wird als vielversprechende Möglichkeit vorgestellt, CO2-Emissionen zu reduzieren und so die Nutzung von Kohle nachhaltiger zu gestalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die CCS-Technologie, den Klimaschutz, die Kohle, die Energiepolitik, die Akteure im Bereich der Energiepolitik, insbesondere Vattenfall, die Bundesregierung, die Landesregierung von Brandenburg, Greenpeace, BUND, Die Grüne Liga und die lokale Bevölkerung. Wichtige Themen sind die ökonomische und ökologische Bewertung der CCS-Technologie, die soziale und politische Akzeptanz der Technologie und der Vergleich von CCS mit erneuerbaren Energien.
- Citar trabajo
- Saskia Helm (Autor), 2008, Die Rolle der CCS-Technologie im globalen Klimaschutz. Kohle als "Klimaretter"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316961