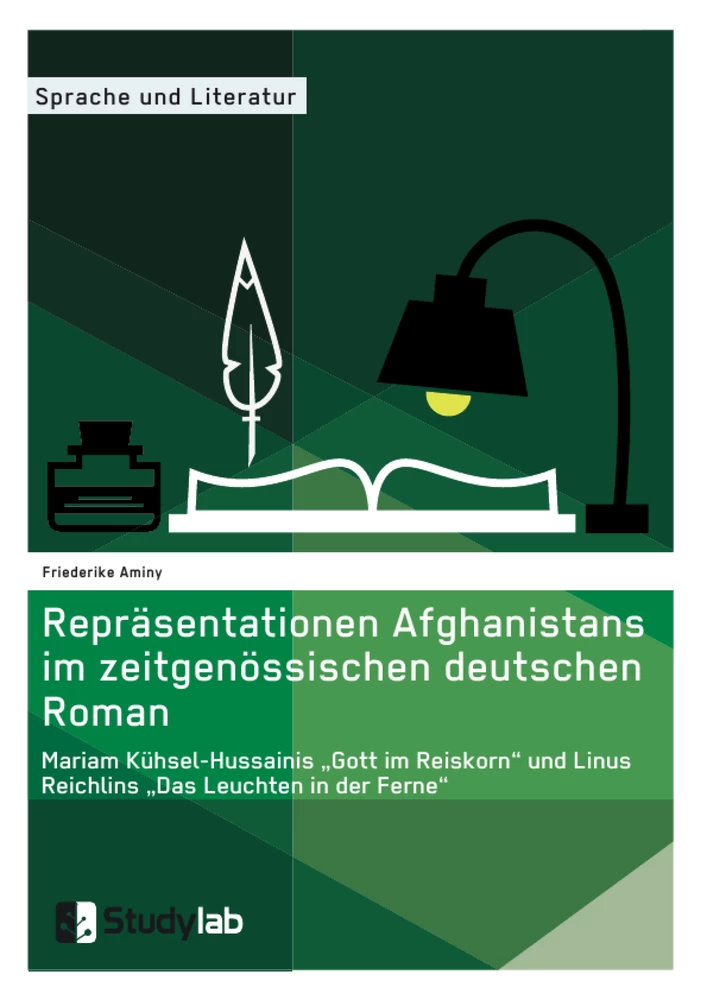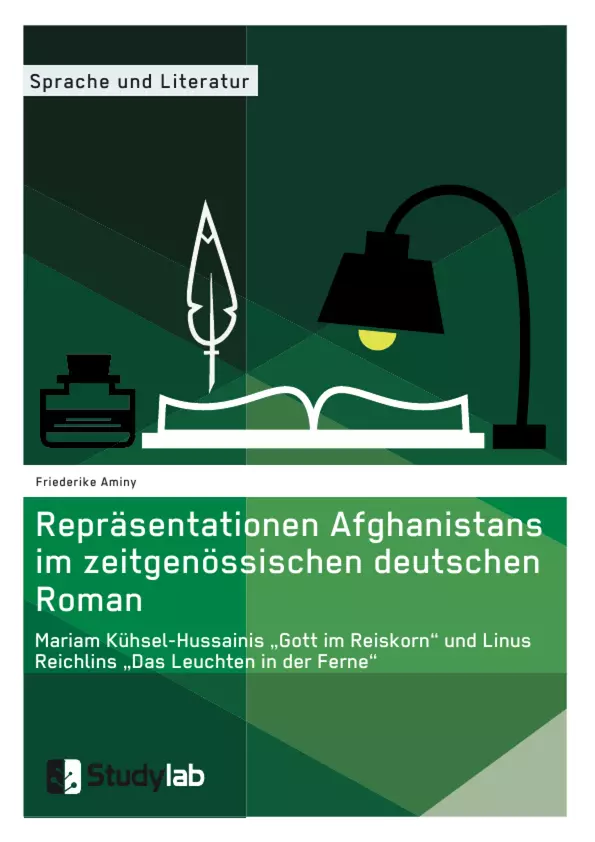Islamistischer Terror, IS, Taliban: Der Nahe und der Mittlere Osten stehen im Westen vor allem für repressive Gesellschaftsordnungen, religiöse Intoleranz und Gewaltherrschaft. Navid Kermani, Orientalist und Schriftsteller, schildert in seiner Dankesrede anlässlich des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2015 eindrucksvoll die Diskrepanz zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart des Orients und des Islams. Er erinnert dabei an frühere islamische Kunst, Musikwissenschaft, Architektur und Poesie und damit an die Freiheit und die Kreativität, die im Islam einmal existierten.
Die vorliegende Arbeit stellt diesen Kontrast anhand unterschiedlicher Repräsentationen Afghanistans im zeitgenössischen deutschen Roman dar. Zum einen als Sehnsuchtsort in Mariam Kühsel-Hussainis Roman „Gott im Reiskorn“ , zum anderen als Ort des Schreckens und der Talibanherrschaft in Linus Reichlins Roman „Das Leuchten in der Ferne“.
Afghanistan fand bereits Mitte des 19. Jahrhunderts Einzug in die deutsche Literatur. Als Beispiel ist das Gedicht "Trauerspiel von Afghanistan" von Theodor Fontane zu nennen. Der Titel hat nichts von seiner Aktualität verloren, auch wenn das Trauerspiel sich heutzutage nicht mehr auf den verlorenen Kampf der Briten bezieht, sondern vielmehr auf den Kampf Afghanistans gegen den Terrorismus und auf die Wiederherstellung von Frieden und Ordnung.
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, anhand der Repräsentationen Afghanistans das Land als Sehnsuchtsort, der Afghanistan einmal war, aus der Vergessenheit und Unkenntnis hervorzuholen und demgegenüber zu untersuchen, was den Schreckensort Afghanistan kennzeichnet, der heute das einzige Gesicht des Landes darstellt.
Um Repräsentationen zu den soeben genannten gegensätzlichen Seiten Afghanistans zu erhalten, wurden die Romane „Gott im Reiskorn“ und „Das Leuchten in Ferne“ ausgewählt. Da es sich bei den Romanen um dieselbe Textsorte handelt, wird zugleich die Vergleichbarkeit der Repräsentationen erleichtert.
Neben den zwei Hauptrepräsentationen Afghanistans als Sehnsuchts- oder Schreckensort soll darüber hinaus ein Blick auf die Bevölkerung Afghanistans sowie das Aussehen, diverse Eigenschaften, Moral, Werte, verschiedene Probleme des Landes wie beispielsweise Hunger und Perspektivlosigkeit, das Stadtleben und die Landschaft geworfen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung in die Thematik, Ziel und Methode
- 1.2 Forschungsrelevanz, Rezeption und Erkenntnisstand
- 2. Theoretische Grundlagen und Begriffe
- 2.1 Interkulturelle Literaturwissenschaft und Komparatistische Imagologie
- 2.2 Postkolonialismus, Orientalismus und Ethnologische Perspektive
- 2.3 Repräsentation, Gegenwartsliteratur, Bacha Posh, Kalligraphie
- 3. Analyse der Repräsentationen Afghanistans
- 3.1 Geschichte, Politik und Biographie als Quellen für die Repräsentationen
- 3.1.1 Ein geschichtlicher Überblick Afghanistans
- 3.1.2 Die aktuelle politische Lage Afghanistans
- 3.1.3 Biographische Informationen zu Autorin und Autor
- 3.2 Inhalt, Form und Erzählstruktur
- 3.2.1 Der Roman Gott im Reiskorn
- 3.2.2 Der Roman Das Leuchten in der Ferne
- 3.3 Das Eigene: Europa und Deutschland
- 3.3.1 Das Eigene in Gott im Reiskorn
- 3.3.2 Das Eigene in Das Leuchten in der Ferne
- 3.4 Das Andere: Repräsentationen Afghanistans
- 3.4.1 Repräsentationen Afghanistans in Gott im Reiskorn
- 3.4.2 Repräsentationen Afghanistans in Das Leuchten in der Ferne
- 4. Fazit
- 4.1 Ergebnis
- 4.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Repräsentation Afghanistans im zeitgenössischen deutschen Roman. Die Zielsetzung besteht darin, die Darstellung Afghanistans in den beiden Romanen „Gott im Reiskorn“ von Mariam Kühsel-Hussaini und „Das Leuchten in der Ferne“ von Linus Reichlins zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die literarischen Strategien der Autorinnen und Autoren im Fokus stehen, um die Konstruktion von Bildern und Stereotypen Afghanistans im deutschen Roman zu beleuchten.
- Die Rolle von Geschichte und Politik in der Konstruktion von Repräsentationen
- Die Bedeutung von Kultur und Identität in der Interaktion zwischen „Eigenem“ und „Anderem“
- Die Verwendung von literarischen Mitteln zur Darstellung von Stereotypen und Vorurteilen
- Die Frage nach der Authentizität und Objektivität von Repräsentationen
- Die Relevanz der Repräsentationen Afghanistans im Kontext der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Repräsentation Afghanistans im deutschen Roman ein. Es werden Zielsetzung, Methode und Forschungsrelevanz der Arbeit erläutert. Kapitel zwei stellt die theoretischen Grundlagen und Begriffe vor, die für die Analyse relevant sind. Hierzu zählen die Interkulturelle Literaturwissenschaft, die Komparatistische Imagologie, der Postkolonialismus, der Orientalismus und die ethnologische Perspektive. Des Weiteren werden die Begriffe Repräsentation, Gegenwartsliteratur, Bacha Posh und Kalligraphie definiert.
Kapitel drei befasst sich mit der Analyse der Repräsentationen Afghanistans in den beiden Romanen „Gott im Reiskorn“ und „Das Leuchten in der Ferne“. Zunächst werden die Geschichte, Politik und Biographie als wichtige Quellen für die Konstruktion von Repräsentationen betrachtet. Anschließend wird der Inhalt, die Form und die Erzählstruktur der Romane analysiert. Schließlich werden die Repräsentationen Afghanistans im Kontext von „Eigenem“ und „Anderem“ untersucht. Kapitel vier fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Repräsentation, Afghanistan, deutscher Roman, Orientalismus, Postkolonialismus, Interkulturelle Literaturwissenschaft, Imagologie, Stereotyp, Kultur, Identität, Geschichte, Politik, „Eigenes“, „Anderes“, Authentizität, Objektivität.
- Citar trabajo
- Friederike Aminy (Autor), 2015, Repräsentationen Afghanistans im zeitgenössischen deutschen Roman. Mariam Kühsel-Hussainis „Gott im Reiskorn“ und Linus Reichlins „Das Leuchten in der Ferne“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316979