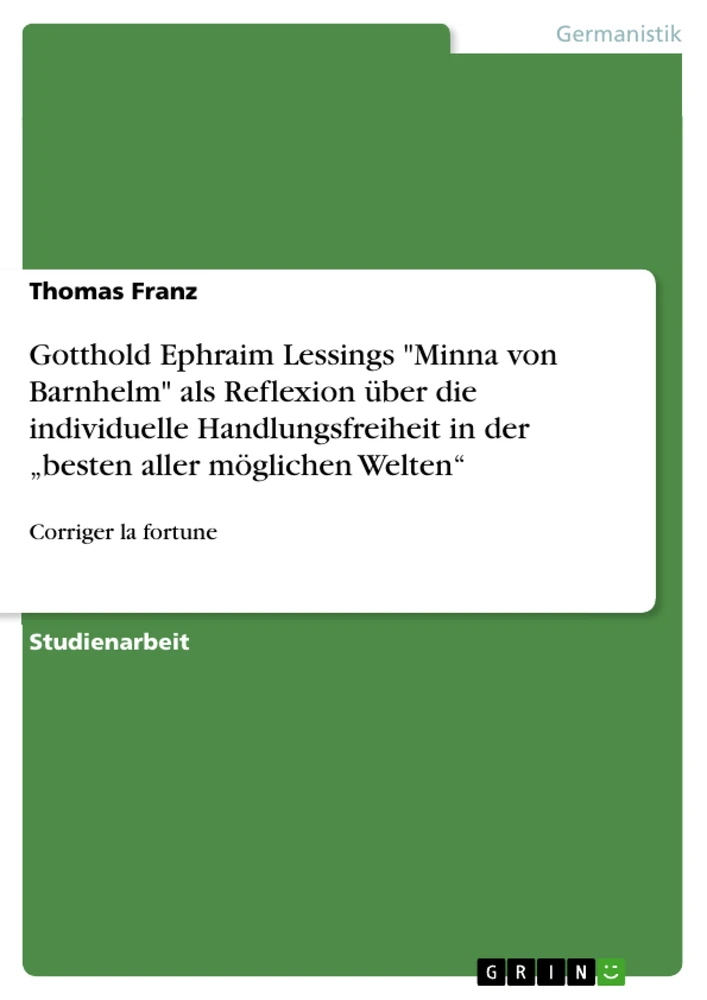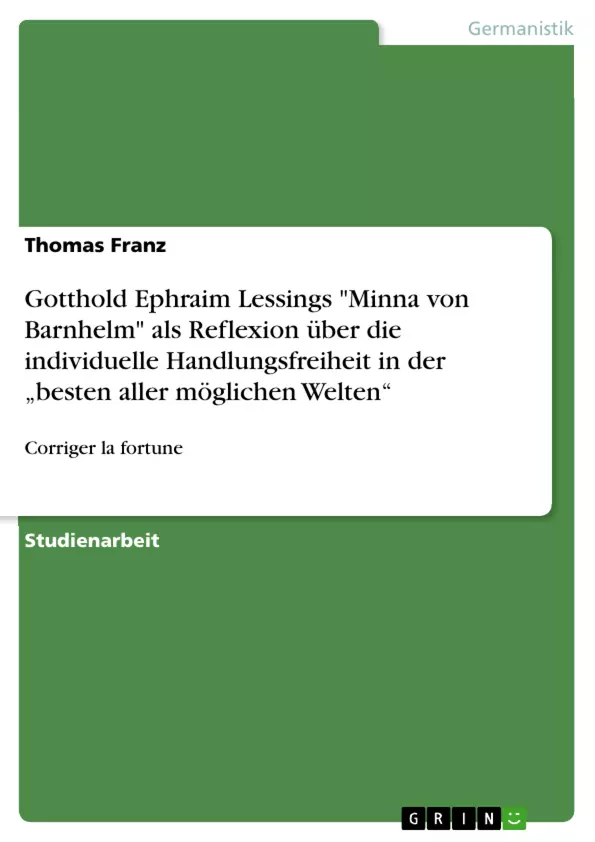Neben den Bezügen zum zeitgeschichtlichen politischen Kontext des Dramas "Minna von Barnhelm" finden sich in der Reflexion auf Glück und Zufall in der „besten aller möglichen Welten“ Aspekte eines über einen konkreten Zeitbezug hinauswirkenden Diskurses, der sich mit der Theodizee-Frage beschäftigt und Fragen nach den Grenzen von Subjektautonomie aufwirft.
Das Zitat „Corriger la fortune“ illustriert einen Kerngedanken des Dramas, indem es den Reflexionsprozess über die Mittel, Möglichkeiten und Berechtigungen, dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen, als das Streben nach Subjektautonomie darstellt.
In dieser Arbeit soll die These untersucht werden, dass Lessings Drama Minna von Barnhelm auf die Bedingungen der Möglichkeit von Subjektautonomie reflektiert. Lessing untersucht mit seiner Minna von Barnhelm die Bedingungen der Möglichkeit von Subjektautonomie, indem er eine Experimentalanordnung schafft, in der die Protagonisten Wege suchen, um ihre eigenen Interessen (z. B. die Realisierung ihrer Liebe in einer Liebesheirat) auch gegen gesellschaftliche Widerstände zu verwirklichen. Konkret zeigt sich dieser Konflikt zwischen Subjektautonomie und hauptsächlich sozialen Widerständen in einem dem Lustspiel zugrunde liegenden Spannungsverhältnis von gesellschaftlichen Normen und individueller leidenschaftlicher Liebe, die als der stärkste Ausdruck des Willens eines Individuums nach Selbstverwirklichung interpretiert werden kann.
Im Rahmen der Hausarbeit soll zunächst der zeitgenössische Ehrdiskurs insbesondere auf seine Folgen für intersubjektive leidenschaftliche Liebe hin untersucht werden. Dabei soll besonderes Augenmerk auf die Folgen für die Möglichkeit individueller Selbstverwirklichung gelegt werden. Die leidenschaftliche Liebe zwischen Minna und Tellheim bietet dabei ein lohnendes Untersuchungsfeld. Artikuliert sich doch gerade in der leidenschaftlichen Liebe der individuelle Wille zur Selbstverwirklichung.
Daran anschließend soll in einem Folgeschritt Lessings Vorstellung von einer neuen sozialen Moral auf der Basis des Mitleids und der (Nächsten-)Liebe dargestellt werden und anhand des Dramentextes nachgewiesen werden, dass dem Mitleid und der leidenschaftlichen Liebe des empfindsamen Liebesdiskurses gerade keine geschichtsverändernde Macht zur Versöhnung von Mensch und Welt, Individuum und Geschichte zuerkannt werden. Der glückliche Ausgang des Dramas verdankt sich einer Häufung von Zufällen, die nicht der...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Die Ehre ist die Ehre“ – Das Ehrprinzip als soziales und politisches Regulativ
- Ehre als Kapital – Liebe im Spannungsfeld von Allianzpolitik und Leidenschaft
- ,,Das Gespenst der Ehre“ - Minnas Technik der Desavouierung des Ehrprinzips
- ,,Vielleicht würde mir Ihr Mitleid gewähret haben, was mir Ihre Liebe versagt.“ - Lessings Vorstellung von einer neuen sozialen Moral auf der Basis des Mitleids und die Funktion der Liebe als säkularisierte Religion
- Überwindung der durch Machtpolitik geschaffenen gesellschaftsinternen Trennungen - Die Funktion der Liebe als Kompensation für den durch Modernisierung entstandenen Sinnverlust
- ,,Mitleid als die Tochter der Liebe“ - Die Rolle des Mitleids
- Tragödie der Theodizee oder Aufklärungsmärchen über den Sieg der zur Anmut gewordenen ratio?
- Extreme Glücks- und Zufallsregie, Sprache „des Herzens“, militärische Metaphorik und die antagonistische Form des Dramas als Strukturprinzipien
- Der Komödienschluss und der „Deus ex machina-Coup“ - Lessings Konzept einer ästhetischen Theodizee
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Lessings Drama „Minna von Barnhelm“ im Hinblick auf die Bedingungen der Möglichkeit individueller Handlungsfreiheit. Sie analysiert, wie Lessing in seinem Werk das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Normen und individueller Liebe als Ausdruck des Willens zur Selbstverwirklichung darstellt und die Folgen für die Möglichkeit individueller Selbstverwirklichung untersucht.
- Das Ehrprinzip als soziales und politisches Regulativ im aufgeklärten Absolutismus
- Die Rolle der Liebe und des Mitleids in Lessings Vorstellung einer neuen sozialen Moral
- Die Funktion der Liebe als Kompensation für den durch Modernisierung entstandenen Sinnverlust
- Die Grenzen von Subjektautonomie im Kontext des Schicksals und der Zufallsregie
- Lessings Konzept einer ästhetischen Theodizee
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Ehrprinzip als soziales und politisches Regulativ, das sich in Tellheims Situation deutlich widerspiegelt. Es analysiert die Folgen des Ehrverlustes für Tellheims gesellschaftliche Position und die Möglichkeit seiner Selbstverwirklichung.
Das zweite Kapitel stellt Lessings Vorstellung einer neuen sozialen Moral auf der Basis des Mitleids und der Liebe dar. Es untersucht die Funktion der Liebe als Kompensation für den durch Modernisierung entstandenen Sinnverlust und die Rolle des Mitleids als „Tochter der Liebe“.
Das dritte Kapitel betrachtet die antagonistische Form des Dramas und analysiert die „extreme Zufallsregie“, die Tellheims Anspruch auf ein günstiges Schicksal als Belohnung für seine Tugendhaftigkeit sowohl als Möglichkeit als auch als Vereitelung subjektiver Autonomie darstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Ehrprinzip, der Liebe und dem Mitleid als gesellschaftlichen und moralischen Regulativen, der Selbstverwirklichung in der „besten aller möglichen Welten“, der Theodizee-Frage und der Funktion des Dramas als Instrument der Reflexion auf die Grenzen von Subjektautonomie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema in Lessings „Minna von Barnhelm“?
Das Drama thematisiert das Spannungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Normen (Ehrprinzip) und individueller Handlungsfreiheit bzw. leidenschaftlicher Liebe.
Warum lehnt Tellheim Minna zunächst ab?
Tellheim fühlt sich durch seinen vermeintlichen Ehrverlust und seine Armut als nicht mehr standesgemäß und verweigert die Heirat aus einem starren Ehrverständnis heraus.
Was bedeutet „Corriger la fortune“ in diesem Kontext?
Es beschreibt das Bestreben, dem Schicksal durch eigenes Handeln auf die Sprünge zu helfen und Subjektautonomie gegenüber dem Zufall zu erlangen.
Wie definiert Lessing die Rolle des Mitleids?
Mitleid fungiert als Basis einer neuen sozialen Moral, die gesellschaftliche Trennungen überwinden soll, jedoch im Drama oft an die Grenzen der Realität stößt.
Ist der glückliche Ausgang des Dramas ein Verdienst der Vernunft?
Die Arbeit argumentiert, dass das glückliche Ende eher einer Häufung von Zufällen (ästhetische Theodizee) als der reinen autonomen Handlungsfreiheit der Protagonisten zu verdanken ist.
- Citation du texte
- Thomas Franz (Auteur), 2014, Gotthold Ephraim Lessings "Minna von Barnhelm" als Reflexion über die individuelle Handlungsfreiheit in der „besten aller möglichen Welten“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316983