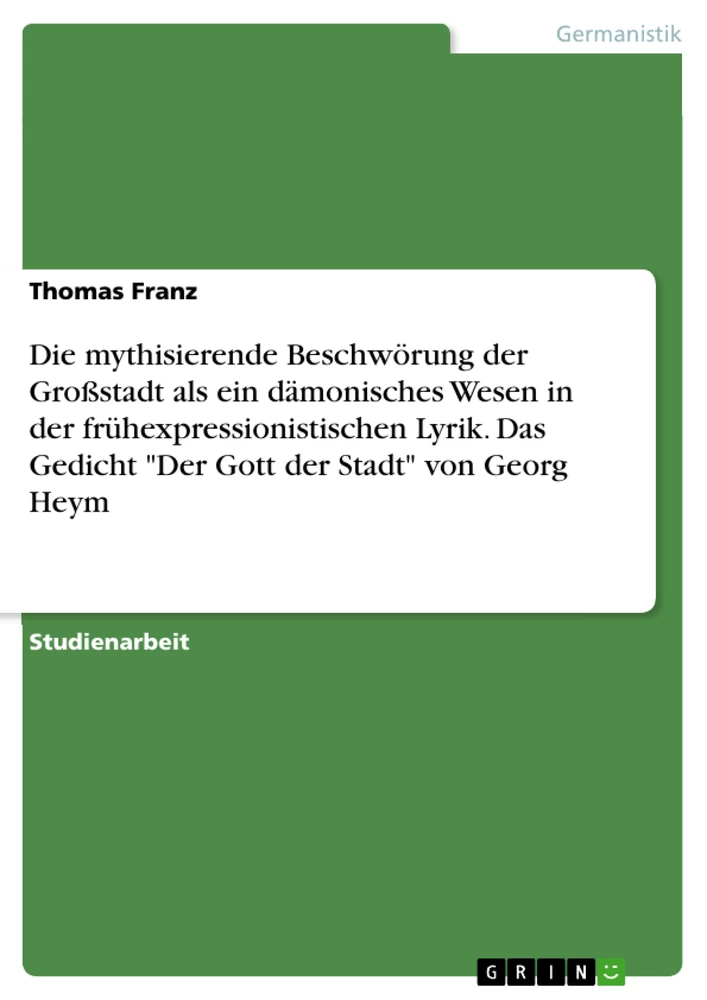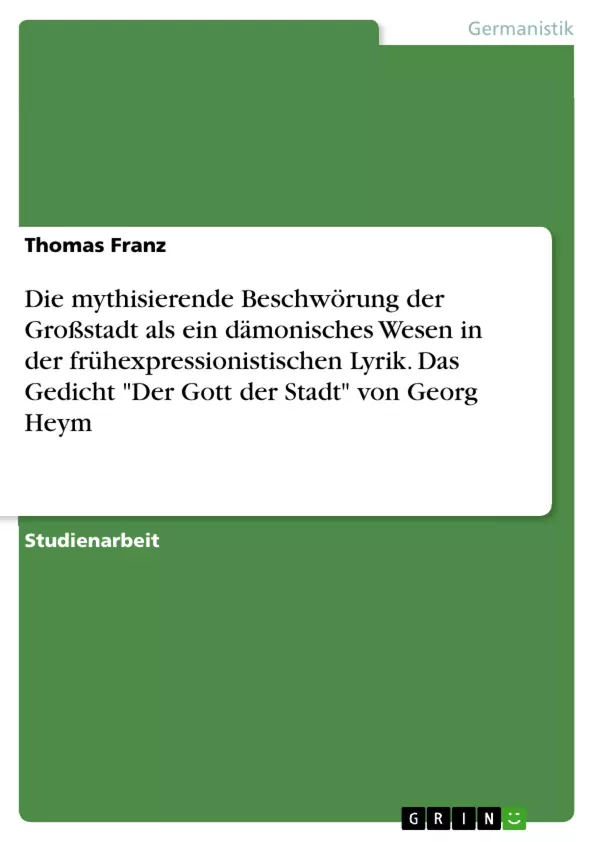Die Großstadtlyrik, die historisch ein Produkt des Naturalismus ist, erreicht im Expressionismus einen zweiten Höhepunkt. Der rasante technische Fortschritt zu Beginn des „expressionistischen Jahrzehnts“ um 1910, der sich insbesondere in den neu entstehenden und schnell wachsenden Großstädten bemerkbar macht, führt durch die Simultaneität von verschiedenen Sinneseindrücken und der damit einhergehenden Reizüberflutung zu einer Verdinglichung des Subjektes, die bewirkt, dass der Einzelne sich nicht mehr als Handlungsträger, sondern als jemand versteht, an dem gehandelt wird, jemand, der anonymen Sachzwängen hilflos ausgesetzt ist, die er nicht mehr beeinflussen kann.
Das Ich zerfällt in diesem Prozess in verschiedene Wahrnehmungen und Empfindungen. Man spricht von einer Krise des Subjektes in der Moderne. Die expressionistische Großstadtlyrik reflektiert diese veränderten Wahrnehmungsmodi in einer radikalen Veränderung der dichterischen Mittel in der Darstellung von Großstadterfahrung. Wenn die Großstadtdichtung des Naturalismus noch als ein Medium der sozialen Anklage und der sentimentalen Identifikation hauptsächlich deskriptiv wirkt, entwickelt sich die expressionistische Großstadtlyrik zu einem autonomem Genre, innerhalb dessen sich zwei Grundtendenzen herausbilden, die äußere Erlebnisse und innere Gefühle des Subjektes zur Expression bringen wollen. Einerseits ist dies die mythisierende Beschwörung der großen Stadt als ein dämonisches Wesen, wie sie vor allem von Georg Heym vollzogen wurde, und andererseits die Auflistung der heterogenen Ereignisse und Sinneseindrücke im Reihungsstil des Simultangedichts, wie es etwa gleichzeitig von den Dichtern Ernst Blass, Jakob van Hoddis und Alfred Lichtenstein entwickelt wird.
Letzteres Verfahren versucht, die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher urbaner Ereignisse und Wahrnehmungen in ein sprachliches Nebeneinander umzusetzen. Dagegen ist die mythisierende Großstadtdarstellung von Georg Heym ein Versuch, die öde Monotonie, die wilhelminische Erstarrung und Spießbürgerlichkeit sowie die gleichförmige Langeweile eines zunehmend technisch fremdbestimmten Lebens in der modernen Großstadt darzustellen. Zugleich erfolgt durch die Mythifizierung und Dämonisierung der großen Stadt, z.B. in der Baal-Gestalt in Heyms paradigmatischen Gedicht Der Gott der Stadt, eine Inkarnation der dämonischen Energien, von denen die Großstadt erfüllt ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Großstadt in der frühexpressionistischen Lyrik
- Ästhetische und zivilisatorische Moderne
- Veränderung der Wahrnehmungsbedingungen
- Ästhetik und Poetik der frühexpressionistischen Lyrik
- Das Motiv der Großstadt bei Georg Heym
- Biografische Bezüge Heyms zur Großstadt
- Das Motiv der Großstadt in der Lyrik Heyms
- Der Gott der Stadt von Georg Heym
- Analyse des Gedichts
- Mythische Personenallegorie und dämonisierende Metaphorik als Zivilisationskritik
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der mythisierenden Darstellung der Großstadt als dämonisches Wesen in der frühexpressionistischen Lyrik, insbesondere am Beispiel von Georg Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“. Ziel ist es, Heyms Gedicht in den zeitgenössischen Kontext der frühexpressionistischen Großstadtlyrik einzuordnen und die Besonderheiten seiner dichterischen Mittel aufzuzeigen.
- Die Darstellung der Großstadt als ein dämonisches Wesen in der frühexpressionistischen Lyrik
- Die spezifische Verwendung von Metaphern und Mythen bei Georg Heym
- Die Veränderung der Wahrnehmungsbedingungen durch die Großstadt im frühen 20. Jahrhundert
- Die ästhetischen und poetischen Merkmale der frühexpressionistischen Lyrik
- Die Kritik an der Zivilisation und den Modernisierungsprozessen in der Großstadt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Großstadtlyrik im Kontext des Expressionismus vor und beleuchtet die Veränderungen der Wahrnehmungsbedingungen in der modernen Großstadt. Das Kapitel 2 widmet sich der ästhetischen und zivilisatorischen Moderne im frühen 20. Jahrhundert und den daraus resultierenden ästhetischen und poetischen Merkmalen der frühexpressionistischen Lyrik. Kapitel 3 behandelt das Motiv der Großstadt in Georg Heyms Werk, insbesondere seine biografischen Bezüge zur Großstadt und die spezifischen Merkmale seiner Großstadtdarstellung. Im vierten Kapitel wird Heyms Gedicht „Der Gott der Stadt“ analysiert, wobei der Fokus auf der mythisierenden Darstellung der Großstadt als dämonisches Wesen liegt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Großstadtlyrik, Expressionismus, Georg Heym, Der Gott der Stadt, Mythisierung, Dämonisierung, Zivilisationskritik, Moderne, Wahrnehmungsbedingungen, Metaphorik, Personenallegorie.
Häufig gestellte Fragen
Was symbolisiert der „Gott der Stadt“ in Georg Heyms Gedicht?
Der Gott, dargestellt als Baal-Gestalt, symbolisiert die dämonischen, zerstörerischen Energien der modernen Großstadt und die Unterwerfung des Individuums unter anonyme Sachzwänge.
Welche Rolle spielt die „Krise des Subjekts“ im Expressionismus?
Durch Reizüberflutung und Industrialisierung fühlt sich der Einzelne nicht mehr als Handelnder, sondern als anonymes Objekt, was zu einem Zerfall der Ich-Identität führt.
Was unterscheidet Heyms Großstadtlyrik vom Reihungsstil anderer Dichter?
Während andere Dichter (wie van Hoddis) die Simultaneität von Eindrücken auflisten, nutzt Heym die Mythifizierung und Dämonisierung, um die Monotonie und Erstarrung der Zivilisation darzustellen.
Was ist Zivilisationskritik im Kontext dieses Gedichts?
Heym kritisiert die wilhelminische Erstarrung, die Spießbürgerlichkeit und die technische Fremdbestimmtheit des Lebens in der modernen Metropole.
Welche literarische Epoche wird hier behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Frühexpressionismus, insbesondere mit der Lyrik des „expressionistischen Jahrzehnts“ um 1910.
- Quote paper
- Thomas Franz (Author), 2013, Die mythisierende Beschwörung der Großstadt als ein dämonisches Wesen in der frühexpressionistischen Lyrik. Das Gedicht "Der Gott der Stadt" von Georg Heym, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316992