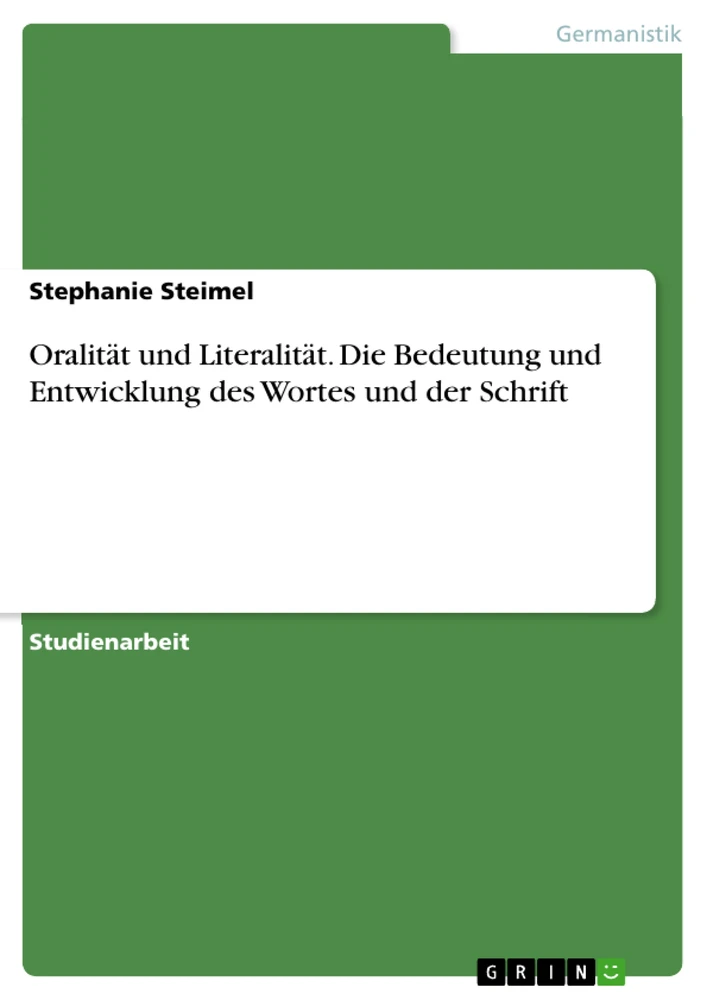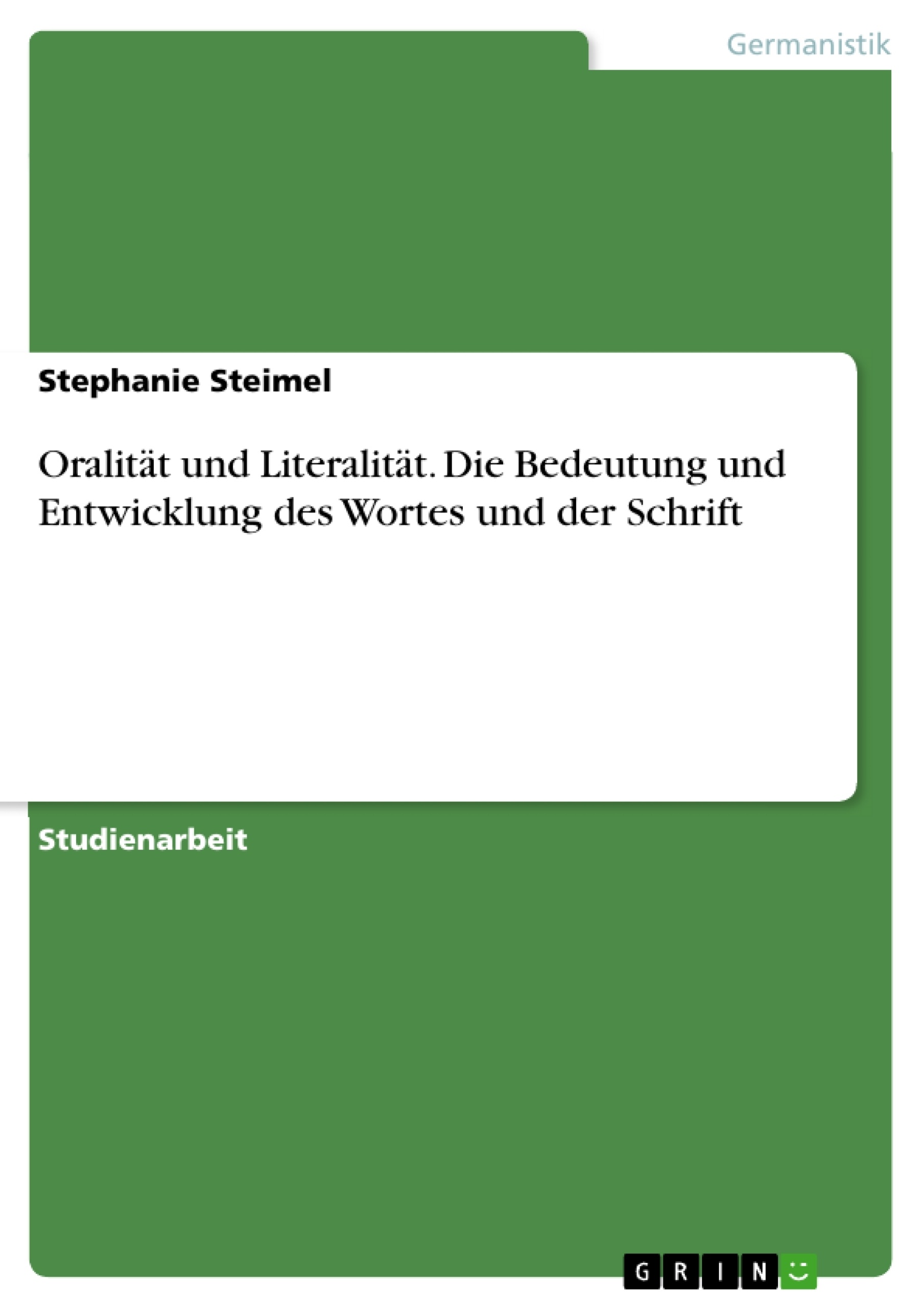Oralität und Literalität als Möglichkeit der Kommunikation und der Weitergabe von Wissen und Informationen sind wichtige Fähigkeiten, heute wie damals. Doch was genau Oralität bedeutet und was sie von der Literalität unterscheidet sind Fragen, die in dieser Arbeit geklärt werden sollen. Des Weiteren wird darauf eingegangen, welchen Stellenwert Literalität für Kulturen damals hatte und heute hat, wie sie sich entwickelt hat und wie sie möglicherweise sogar zur Entwicklung beigetragen hat. Auf einige wichtige Aspekte hat auch schon Eric A. Havelock Antworten gefunden und daher sollen seine Ausführungen als Grundlage für diese Arbeit verwendet werden.
Der Stellenwert der Schrift hat sich maßgeblich verändert und sie bringt sowohl viele Vorteile mit sich, als auch einige Nachteile, wenn man den Kritiken glauben mag. Diese Untersuchung wird sich unter anderem eben mit dieser Kritik beschäftigen und versuchen, diese ein wenig zu entkräften. Die Sprache ist das wichtigste Medium – und die Schrift als Instrument zur Erweiterung dieses Mediums ist ebenso wichtig.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Oralität
- Literalität
- Entwicklung der Literalität
- Literalität und Medien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Oralität und Literalität, ihre Bedeutung für die Kommunikation und Wissensvermittlung, sowie die Entwicklung und den Stellenwert der Literalität im Laufe der Geschichte. Die Arbeit nutzt die Ausführungen von Eric A. Havelock als Grundlage und analysiert die Unterschiede zwischen oralem und literalem Denken.
- Definition und Unterscheidung von Oralität und Literalität
- Entwicklung und Bedeutung der Literalität für Kulturen
- Vergleich von oralem und literalem Denken
- Vorteile und Nachteile der Schriftlichkeit
- Der Einfluss der Literalität auf die Wissensverbreitung und -bewahrung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Was genau bedeutet Oralität, und wie unterscheidet sie sich von Literalität? Die Arbeit untersucht den Stellenwert der Literalität in Vergangenheit und Gegenwart, ihre Entwicklung und ihren möglichen Einfluss auf die kulturelle Entwicklung. Havelocks Ausführungen dienen als Ausgangspunkt für die Analyse. Die Bedeutung und die Veränderungen des Stellenwerts der Schrift werden thematisiert, sowohl positive Aspekte als auch Kritikpunkte werden berücksichtigt. Die Sprache als wichtigstes Medium und die Schrift als deren Erweiterung bilden den Fokus der Arbeit.
2. Oralität: Dieses Kapitel definiert Oralität als mündliche Überlieferung von Geschichte, Informationen und Wissen. Es wird hervorgehoben, dass Oralität eine grundlegende und natürliche menschliche Fähigkeit ist, im Gegensatz zur Literalität, die als zufällige Entwicklung der Menschheit betrachtet wird. Der Erwerb von Sprache wird als angeborene Fähigkeit beschrieben. Havelock’s Erkenntnisse werden herangezogen, um die Bedeutung von Oralität für die Menschheit zu unterstreichen. Der Abschnitt vergleicht Oralität und Literalität im Hinblick auf die Organisation und Weitergabe von Gedanken und Wissen. Sauer’s Beschreibung des oralen Denkens als additiv, aggregativ, konservativ, homöostatisch und situativ wird ausführlich erläutert und mit Beispielen illustriert, die die natürliche Entstehung dieser Denkprozesse verdeutlichen.
3. Literalität: Dieses Kapitel behandelt den Begriff Literalität und seine Verbindung zu Lese- und Schreibfähigkeit. Im Gegensatz zur flüchtigen Oralität ermöglicht Literalität die dauerhafte Speicherung und Weitergabe von Informationen außerhalb des individuellen Gedächtnisses. Der Vergleich des literalen Denkens mit dem oralen Denken nach Sauer zeigt die Vorteile der Literalität auf: unabhängige Speicherung, gezielter Zugriff auf Informationen, Organisation und Kontrolle von Gedanken. Die fehlende Homöostase der Literalität ermöglicht die Akkumulation von Wissen. Der Aspekt der Wahrheit und der Möglichkeit der Veralterung von geschriebenen Informationen wird diskutiert. Die Bedeutung der Aktualisierung und "Wartung" geschriebener Informationen wird als notwendige Korrektur von potentiell falschen Informationen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Oralität, Literalität, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Wissensvermittlung, Kommunikation, Geschichte der Schrift, Entwicklung der Sprache, orales Denken, literales Denken, Eric A. Havelock, Silke Sauer, Wissensspeicherung, Wissensbewahrung.
Häufig gestellte Fragen zu: Oralität und Literalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Konzepte von Oralität und Literalität, ihre Bedeutung für die Kommunikation und Wissensvermittlung sowie die Entwicklung und den Stellenwert der Literalität im Laufe der Geschichte. Die Arbeit nutzt die Ausführungen von Eric A. Havelock als Grundlage und analysiert die Unterschiede zwischen oralem und literalem Denken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition und Unterscheidung von Oralität und Literalität, der Entwicklung und Bedeutung der Literalität für Kulturen, dem Vergleich von oralem und literalem Denken, den Vor- und Nachteilen der Schriftlichkeit sowie dem Einfluss der Literalität auf die Wissensverbreitung und -bewahrung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Oralität, ein Kapitel über Literalität und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfragen vor und skizziert den Ansatz der Arbeit. Das Kapitel über Oralität definiert Oralität und untersucht ihre Bedeutung. Das Kapitel über Literalität behandelt den Begriff Literalität, vergleicht literales und orales Denken und diskutiert die Vor- und Nachteile der Schriftlichkeit. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die Kernaussagen zum Kapitel "Oralität"?
Das Kapitel definiert Oralität als mündliche Überlieferung und hebt ihre grundlegende menschliche Natur hervor. Es vergleicht Oralität mit Literalität hinsichtlich der Organisation und Weitergabe von Wissen und erläutert Sauers Beschreibung des oralen Denkens als additiv, aggregativ, konservativ, homöostatisch und situativ.
Was sind die Kernaussagen zum Kapitel "Literalität"?
Das Kapitel beschreibt Literalität als dauerhafte Speicherung von Informationen. Es vergleicht literales und orales Denken und hebt die Vorteile der Literalität hervor: unabhängige Speicherung, gezielter Zugriff auf Informationen, Organisation und Kontrolle von Gedanken. Die fehlende Homöostase der Literalität ermöglicht die Akkumulation von Wissen. Die Bedeutung der Aktualisierung und Korrektur geschriebener Informationen wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Oralität, Literalität, Schriftlichkeit, Mündlichkeit, Wissensvermittlung, Kommunikation, Geschichte der Schrift, Entwicklung der Sprache, orales Denken, literales Denken, Eric A. Havelock, Silke Sauer, Wissensspeicherung, Wissensbewahrung.
Welche Autoren werden zitiert?
Die Arbeit bezieht sich insbesondere auf die Ausführungen von Eric A. Havelock und Silke Sauer.
Welche Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung stellt die zentralen Fragen nach der Bedeutung von Oralität und Literalität, ihren Unterschieden und dem Stellenwert der Literalität in Vergangenheit und Gegenwart.
Welche Aspekte der Schriftlichkeit werden kritisch beleuchtet?
Die Arbeit thematisiert kritisch die potentielle Veralterung und die Notwendigkeit der Aktualisierung und Korrektur von geschriebenen Informationen.
Was ist der zentrale Unterschied zwischen oralem und literalem Denken?
Ein zentraler Unterschied liegt in der Speicherung und Organisation von Informationen. Orales Denken ist situativ und additiv, während literales Denken eine unabhängige Speicherung und gezielten Zugriff auf Informationen ermöglicht.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Steimel (Autor:in), 2014, Oralität und Literalität. Die Bedeutung und Entwicklung des Wortes und der Schrift, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317011