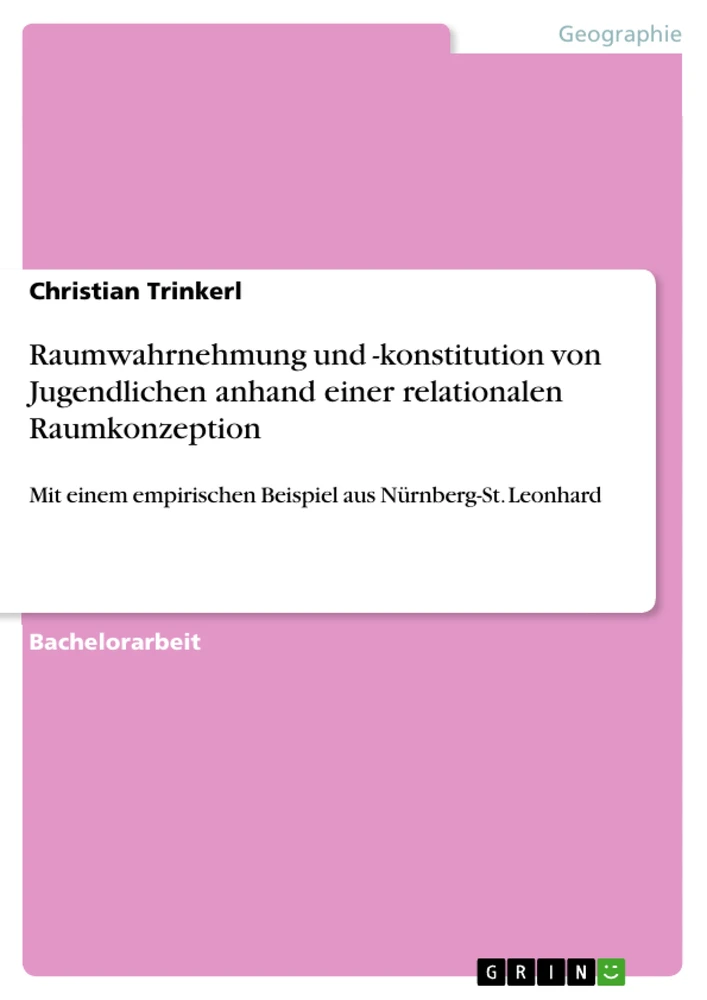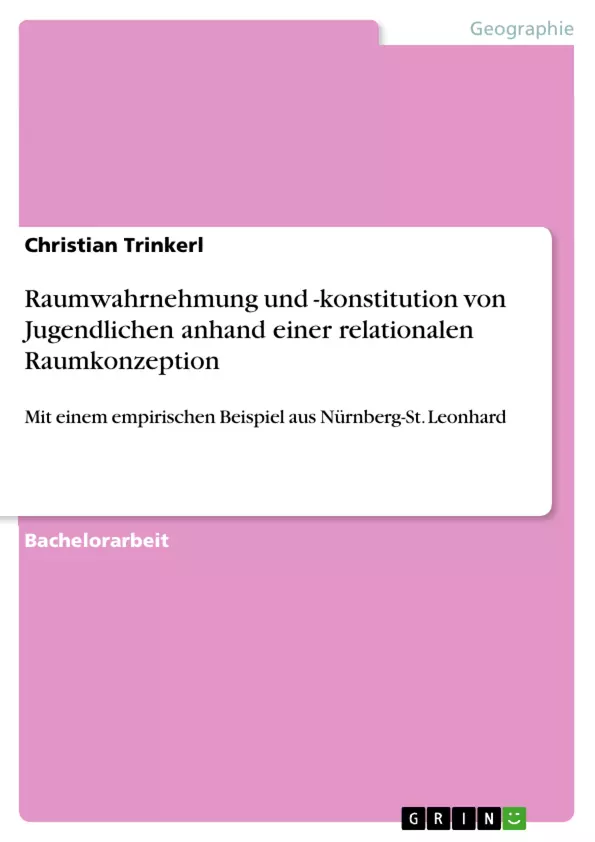Die individuelle Wahrnehmung und Erfahrung des Raumes steht im Zentrum der hier angefertigten Arbeit. Im Folgenden wird der Einfluss von drei ausgewählten Kategorien auf die Raumerfahrung Jugendlicher untersucht: Das soziale Umfeld, welches familiäre Strukturen, die Schule und die Bezugsgruppe der Gleichaltrigen umfasst, architektonisch-materielle Strukturen und bildliche Deutungsmuster sowie die Rolle von virtuellen Räumen und Medien. Anhand der theoretischen Überlegungen zu diesen drei Punkten soll eine Verknüpfung zu einer empirischen Untersuchung hergestellt werden. Im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard wird mittels Methoden der humangeographischen Sozialforschung (mental maps, Fotografien) versucht, entsprechende Ergebnisse zu ermitteln.
Folglich lässt sich als Fragestellung ableiten: Wie nehmen Jugendliche ihre räumliche Umgebung wahr, wie wird Raum dabei konstituiert? Wie groß ist der Einfluss von Familie, Freunden und Schule dabei? Welche Rolle spielen dabei materiellen Strukturen und Architektur? Inwiefern tragen virtuelle Räume und Medien zur Raumerfahrung bei? In Bezug auf diese Fragestellung wird zunächst ein Raumkonzept erläutert, hinter dessen Hintergrund die Arbeit verfasst wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Entwicklung der Thematik Jugendgeographien im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum
- 1.1 Children's Geographies und die Wurzeln in der Soziologie
- 1.2 Jugendgeographien im englischsprachigen Raum ab den 1960er Jahren
- 1.3 Der Entwicklungsverlauf im deutschsprachigen Raum
- 1.4 Zwischensynthese und Perspektiven der Jugendgeographien
- 1.5 Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Raumkonzeption und ausgewählte Indikatoren der Raumwahrnehmung
- 2.1 Ein relationales Raumkonzept
- 2.1.1 Komponenten der Raumkonstruktion
- 2.1.2 Spezifische Eigenschaften der Komponenten
- 2.1.3 Spacing und Syntheseleistungen
- 2.1.4 Vergleich mit Werlens handlungsorientierter Sozialgeographie
- 2.2 Das soziale Umfeld
- 2.2.1 Familiäre Beziehungen
- 2.2.2 Die Schule
- 2.2.3 Die Bedeutung von Freunden und Freizeit
- 2.3 Architektonische Strukturen und bildliche Deutungsmuster
- 2.4 Virtuelle Räume und die Rolle der Medien
- 3 Angewandte Methoden der empirischen Sozialforschung
- 3.1 Ortsbegehung und Beobachtung
- 3.2 'Mental Maps' als Zugang zu individuellen Wahrnehmungsstrukturen Jugendlicher
- 3.3 Zur Doppelrolle von Fotografien
- 4 Nürnberg - St. Leonhard als Untersuchungsgebiet
- 5 Ergebnisse der empirischen Sozialforschung
- 6 Synthese und Fazit
- 6.1 Kritische Reflexion der angewandten Methoden
- 6.2 Vergleich der theoretischen Analyse mit den Ergebnissen der Empirie
- 6.3 Rückbezug zur Fragestellung und zur thematischen Hinführung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Raumwahrnehmung und -konstitution von Jugendlichen anhand eines relationalen Raumkonzepts. Das Hauptziel ist es, die individuellen Raumvorstellungen Jugendlicher im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard zu erforschen und diese im Kontext ihrer sozialen Beziehungen, ihres Umfelds und der architektonischen Strukturen zu analysieren. Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit empirischen Befunden.
- Entwicklung und Anwendung eines relationalen Raumkonzepts zur Analyse der Raumwahrnehmung von Jugendlichen
- Einfluss sozialer Beziehungen (Familie, Schule, Freunde) auf die Raumkonstitution
- Bedeutung architektonischer Strukturen und bildlicher Deutungsmuster für die Raumwahrnehmung
- Rolle virtueller Räume und Medien in der Raumvorstellung Jugendlicher
- Empirische Untersuchung der Raumwahrnehmung im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard mittels Methoden der Sozialforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Entwicklung der Thematik Jugendgeographien im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Forschungsfeldes der Jugendgeographien, beginnend mit den "Children's Geographies" und ihren soziologischen Wurzeln. Es vergleicht die Entwicklungen im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum und skizziert verschiedene Perspektiven und Forschungsansätze innerhalb dieses Feldes. Die Kapitel dient als Grundlage für die theoretische Fundierung der Arbeit und führt zur Fragestellung und Zielsetzung der vorliegenden Bachelorarbeit ein.
2 Raumkonzeption und ausgewählte Indikatoren der Raumwahrnehmung: Dieses Kapitel entwickelt ein relationales Raumkonzept, das die Raumwahrnehmung als Ergebnis von Beziehungen und Interaktionen zwischen Individuen, sozialen Gruppen und der Umwelt beschreibt. Es werden die zentralen Komponenten der Raumkonstruktion (Individuum, soziale Beziehungen, physische Umgebung) detailliert erläutert, ihre spezifischen Eigenschaften beleuchtet und der Begriff des "Spacing" sowie die Bedeutung von Syntheseleistungen im Raumverständnis eingeordnet. Ein Vergleich mit Werlens handlungsorientierter Sozialgeographie wird zur Differenzierung und Präzisierung des relationalen Ansatzes herangezogen. Die verschiedenen Einflussfaktoren wie familiäre Beziehungen, Schule, Freundschaften und Freizeitaktivitäten werden als wesentliche Indikatoren für die Raumwahrnehmung Jugendlicher vorgestellt.
3 Angewandte Methoden der empirischen Sozialforschung: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen der empirischen Untersuchung. Es erläutert den Einsatz von Ortsbegehungen und Beobachtungen, die Verwendung von "Mental Maps" als Instrument zur Erfassung individueller Raumvorstellungen und diskutiert die Doppelrolle von Fotografien als sowohl Forschungsinstrument als auch als Ausdruck der Raumwahrnehmung selbst. Die Methodenwahl wird im Kontext der Forschungsfrage und des gewählten theoretischen Rahmens begründet.
4 Nürnberg - St. Leonhard als Untersuchungsgebiet: Das Kapitel präsentiert den gewählten Untersuchungsraum, den Nürnberger Stadtteil St. Leonhard, und begründet dessen Auswahl als Fallbeispiel für die empirische Untersuchung. Die Beschreibung des Stadtteils fokussiert auf Aspekte, welche für die Raumwahrnehmung Jugendlicher relevant sind, wie beispielsweise die vorhandene Infrastruktur, die sozialen und demographischen Gegebenheiten. Der geografische Kontext wird detailliert dargestellt und für die weitere Auswertung der empirischen Daten vorbereitet.
5 Ergebnisse der empirischen Sozialforschung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard. Die Auswertung der gesammelten Daten (z.B. Mental Maps, Beobachtungen, Fotografien) wird hier detailliert dargestellt. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Raumwahrnehmung und –konstitution der Jugendlichen werden beschrieben und analysiert.
Schlüsselwörter
Raumwahrnehmung, Raumkonstitution, Jugendliche, relationales Raumkonzept, Nürnberg-St. Leonhard, empirische Sozialforschung, Mental Maps, soziale Beziehungen, Architektur, virtuelle Räume, Medien.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Raumwahrnehmung und -konstitution von Jugendlichen in Nürnberg-St. Leonhard
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Raumwahrnehmung und -konstitution von Jugendlichen im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard. Sie analysiert die individuellen Raumvorstellungen der Jugendlichen im Kontext ihrer sozialen Beziehungen, ihres Umfelds und der architektonischen Strukturen. Die Arbeit verbindet theoretische Überlegungen mit empirischen Befunden.
Welches Raumkonzept wird verwendet?
Die Arbeit verwendet ein relationales Raumkonzept. Dieses beschreibt die Raumwahrnehmung als Ergebnis von Beziehungen und Interaktionen zwischen Individuen, sozialen Gruppen und der Umwelt. Zentrale Komponenten sind das Individuum, soziale Beziehungen und die physische Umgebung.
Welche Faktoren beeinflussen die Raumwahrnehmung der Jugendlichen?
Die Raumwahrnehmung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter soziale Beziehungen (Familie, Schule, Freunde), architektonische Strukturen, bildliche Deutungsmuster, virtuelle Räume und Medien.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung verwendet Ortsbegehungen, Beobachtungen, "Mental Maps" (kognitive Karten) zur Erfassung individueller Raumvorstellungen und Fotografien als Forschungsinstrument und Ausdruck der Raumwahrnehmung.
Warum wurde Nürnberg-St. Leonhard als Untersuchungsgebiet ausgewählt?
Die Auswahl von Nürnberg-St. Leonhard als Untersuchungsgebiet wird im Kapitel 4 begründet. Die Beschreibung des Stadtteils fokussiert auf Aspekte, die für die Raumwahrnehmung Jugendlicher relevant sind (Infrastruktur, soziale und demografische Gegebenheiten).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 beleuchtet die Entwicklung der Jugendgeographien. Kapitel 2 entwickelt das relationale Raumkonzept. Kapitel 3 beschreibt die angewandten Methoden. Kapitel 4 stellt das Untersuchungsgebiet vor. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der empirischen Forschung und Kapitel 6 bietet eine Synthese und ein Fazit, inklusive einer kritischen Reflexion der Methoden und einen Rückbezug zur Fragestellung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Raumwahrnehmung, Raumkonstitution, Jugendliche, relationales Raumkonzept, Nürnberg-St. Leonhard, empirische Sozialforschung, Mental Maps, soziale Beziehungen, Architektur, virtuelle Räume, Medien.
Wie wird der Vergleich zwischen angloamerikanischen und deutschsprachigen Jugendgeographien dargestellt?
Kapitel 1 bietet einen umfassenden Vergleich der Entwicklung des Forschungsfeldes der Jugendgeographien im angloamerikanischen und deutschsprachigen Raum, beginnend mit den "Children's Geographies" und ihren soziologischen Wurzeln.
Welche Rolle spielen virtuelle Räume und Medien?
Die Arbeit untersucht die Rolle virtueller Räume und Medien in der Raumvorstellung Jugendlicher als einen wichtigen Einflussfaktor auf die Raumwahrnehmung.
Wie wird das relationale Raumkonzept mit der handlungsorientierten Sozialgeographie nach Werlen verglichen?
Kapitel 2 vergleicht das verwendete relationale Raumkonzept mit Werlens handlungsorientierter Sozialgeographie, um den relationalen Ansatz zu differenzieren und zu präzisieren.
- Quote paper
- Christian Trinkerl (Author), 2014, Raumwahrnehmung und -konstitution von Jugendlichen anhand einer relationalen Raumkonzeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317163