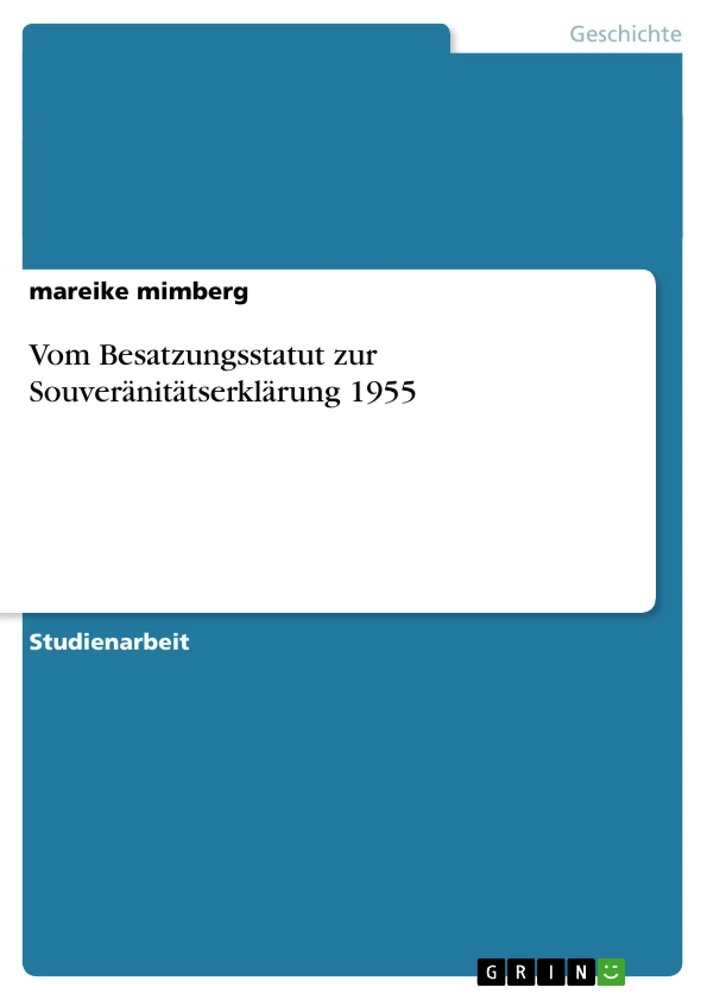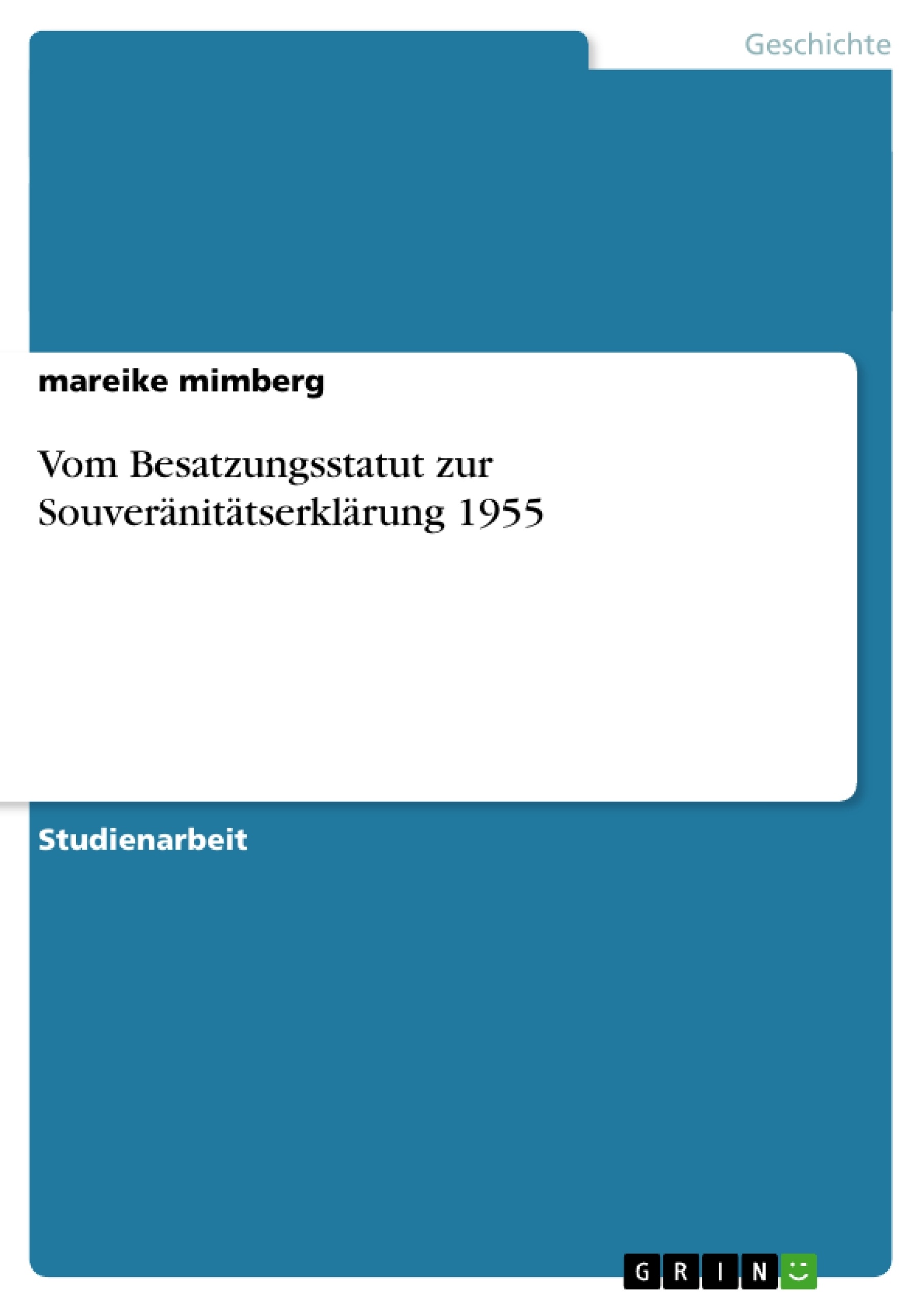Vier Jahre nach Beendigung des 2. Weltkrieges und der Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen fand vom 05.-08. März 1949 eine Außenministerkonferenz der drei Westmächte statt. Im Rahmen dieser Konferenz wurden die amerikanische, die französische und die britische Besatzungszone zur Trizone zusammengefasst und ein Besatzungsstatut, indem alle Befugnisse der westdeutschen Regierung festgehalten wurden, verabschiedet. Im Laufe der Jahre zielten die Bemühungen der Regierung Adenauer darauf ab, die im Besatzungsstatut festgehaltenen Bestimmungen in mehreren kleinen Schritten zu lockern und später durch einen Vertrag zu ersetzen. Diese Arbeit war gekennzeichnet durch zahlreiche, zähe Verhandlungen, die oft nur kleine Fortschritte einbrachten, doch Kanzler Adenauer ließ sich nicht entmutigen und entwickelte sich zu einem starken Verhandlungspartner für die Alliierten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Besatzungsstatut und erste Fortschritte
- Das Besatzungsstatut
- Außenministerkonferenz Paris im November 1949
- Petersberger Abkommen
- Hindernisse auf dem Weg zu Souveränität
- Die Saarfrage
- Die Wiederbewaffnung
- Erleichterung des Besatzungsstatuts bis zur Ersetzung
- Außenministerkonferenz 1950
- Generalvertrag und EVG
- Eigene Einschätzung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Weg der Bundesrepublik Deutschland von der Besatzungsmacht zur Souveränität im Jahr 1955. Sie analysiert das Besatzungsstatut, die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den alliierten Mächten sowie die wichtigsten Hindernisse auf dem Weg zur Selbstbestimmung.
- Das Besatzungsstatut und seine Auswirkungen auf die BRD
- Die Verhandlungen zwischen der BRD und den Alliierten zur Lockerung des Besatzungsstatuts
- Die Saarfrage und die Wiederbewaffnung als zentrale Streitpunkte
- Die Bedeutung des Generalvertrags und der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) für den Prozess der Souveränität
- Adenauers Rolle als Verhandlungspartner und seine Strategie zur Erlangung der Souveränität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den historischen Kontext der Nachkriegszeit in Deutschland dar. Im zweiten Kapitel wird das Besatzungsstatut von 1949 analysiert, das die Grenzen der Souveränität der BRD definierte und die verschiedenen Bereiche festlegte, in denen die Alliierten weiterhin das Sagen hatten. Die Außenministerkonferenz in Paris 1949 und das Petersberger Abkommen werden ebenfalls in diesem Kapitel behandelt.
Das dritte Kapitel widmet sich den Hindernissen, die auf dem Weg zur Souveränität der BRD standen. Die Saarfrage, die umstrittene Zugehörigkeit des Saarlandes, und die Frage der Wiederbewaffnung werden hier näher beleuchtet. Im vierten Kapitel werden die Bemühungen der Bundesregierung um eine Erleichterung des Besatzungsstatuts behandelt, die letztendlich zur Ersetzung durch einen Vertrag führten.
Schlüsselwörter
Besatzungsstatut, Bundesrepublik Deutschland, Souveränität, Adenauer, Alliierte, Saarfrage, Wiederbewaffnung, Generalvertrag, Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG), Nachkriegszeit, Verhandlungen, Deutsche Geschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Besatzungsstatut von 1949?
Das Besatzungsstatut legte die Befugnisse der westdeutschen Regierung fest und definierte gleichzeitig die Vorbehaltsrechte der drei Westmächte (USA, Frankreich, Großbritannien).
Wann erlangte die Bundesrepublik Deutschland ihre volle Souveränität?
Die volle Souveränität wurde im Jahr 1955 durch das Inkrafttreten der Pariser Verträge und die Ablösung des Besatzungsstatuts erreicht.
Welche Rolle spielte Konrad Adenauer in diesem Prozess?
Adenauer verfolgte eine Strategie der kleinen Schritte und zähen Verhandlungen, um das Vertrauen der Alliierten zu gewinnen und die Souveränität schrittweise zurückzuerlangen.
Was waren die größten Hindernisse auf dem Weg zur Souveränität?
Zentrale Streitpunkte waren die Saarfrage (die Zugehörigkeit des Saarlandes) sowie die heftig diskutierte Wiederbewaffnung Deutschlands.
Was war das Petersberger Abkommen?
Es war ein Abkommen von 1949, das erste Lockerungen des Besatzungsregimes brachte und der Bundesrepublik mehr Spielraum in der Außenpolitik und Wirtschaft ermöglichte.
- Arbeit zitieren
- mareike mimberg (Autor:in), 2003, Vom Besatzungsstatut zur Souveränitätserklärung 1955, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31726