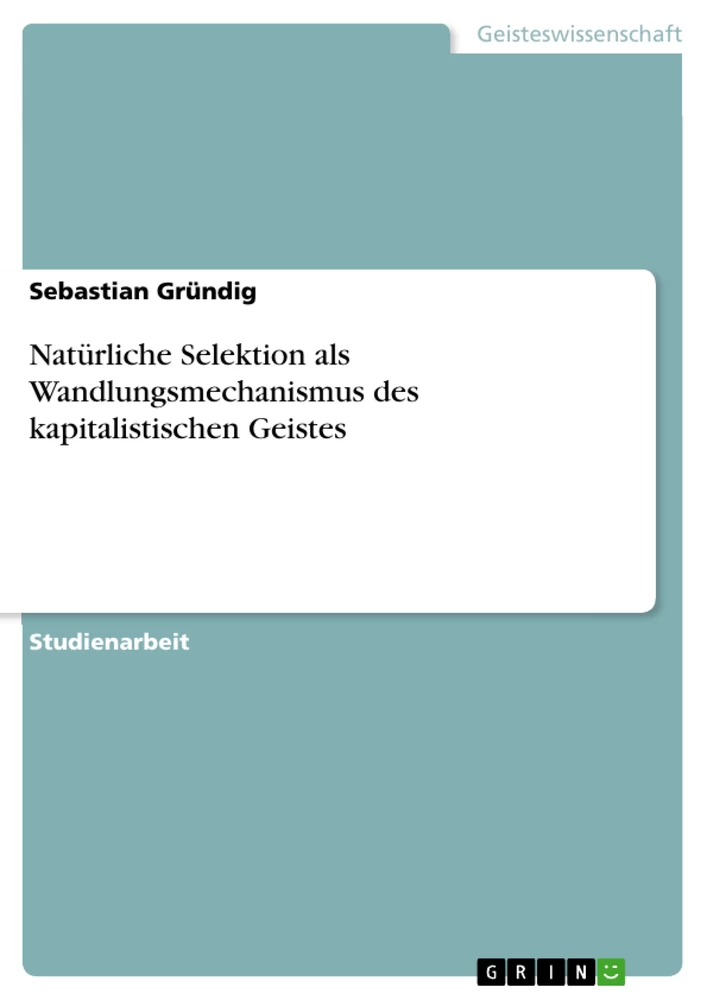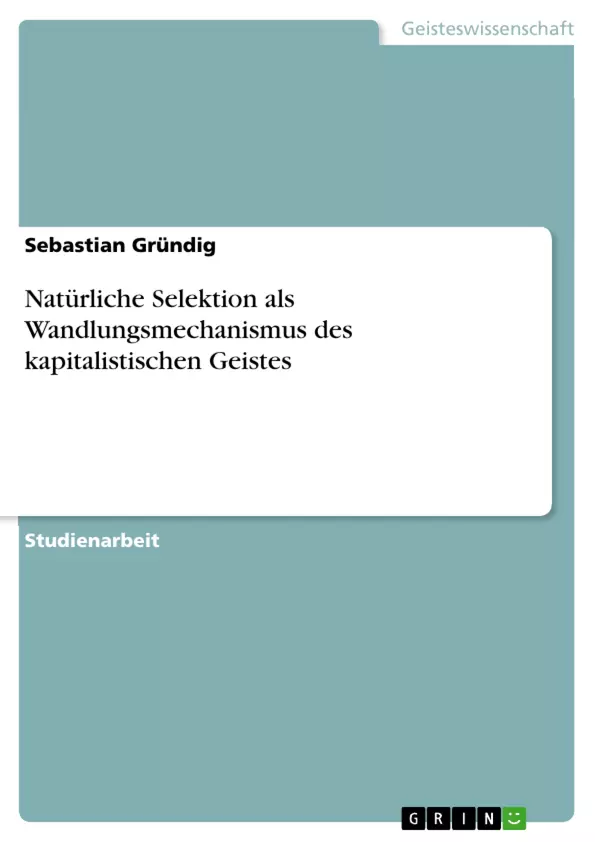In dieser Seminararbeit werden die wichtigsten Wandlungsaspekte des kapitalistischen Geistes von Luc Boltanski und Ève Chiapello aus ihrem Buch "Der neue Geist des Kapitalismus" erläutert und diskutiert. Ferner wird die natürliche Selektion von Verhaltensweisen (inspiriert durch den universellen Darwinismus) als möglicher weiterer Faktor des Wandlungsmechanismus diskutiert.
Der sich ständig wandelnde Kapitalismus ist einer der am häufigsten diskutierten Streitpunkte unserer Gesellschaft. Schon Theoretiker wie Karl Marx und Max Weber haben sich ausgiebig mit dieser Wirtschaftsordnung und ihren Merkmalen beschäftigt. In dem Werk „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (Weber, 1904/1905) spricht Weber, wie schon im Titel vorzufinden, erstmalig vom „Geist des Kapitalismus“ und versucht zu beschreiben, wie sich dieser zu dem entwickelt hat, was er heute ist. 2003 haben sich auch Luc Boltanski und Eve Chiapello diesem Thema angenommen. Sie beschreiben in ihrem Buch „Der neue Geist des Kapitalismus“ (Boltanski und Chiapello 2003) unter anderem sehr ausführlich, was sie unter einem Geist des Kapitalismus verstehen, wie er entstanden ist, wie er sich entwickelt hat und wie sich dieser verändert.
Den Grund für die Veränderungen des kapitalistischen Geistes sehen Boltanski und Chiapello in den Auswirkungen der Wechselbeziehung zwischen dem Kapitalismus und dessen Kritik. An diesem Punkt ergibt sich die Frage, ob sich der Geist des Kapitalismus auch ändert wenn der Kapitalismus selbst keine Kritik erfährt. Ist Kritik wirklich die einzige Variable, welche einen Einfluss auf den kapitalistischen Geist ausübt oder sind auch Veränderungen vorzufinden, die sich nicht als Reaktion dieses Wechselspiels erklären lassen? Kann man solche Veränderungen nachweisen, wäre ebenfalls zu untersuchen welche Strukturen als Ursache dieser Wandlungen fungieren. Eben dieser Aufgabe widmet sich die vorliegende Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der neue Geist des Kapitalismus nach Luc Boltanski und Ève Chiapello
- 1.1. Minimaldefinition des Kapitalismus
- 1.2. Der Geist des Kapitalismus
- 1.3. Die Rechtfertigung des Kapitalismus
- 1.4. Beschränkungen des Akkumulationsprozesses durch den kapitalistischen Geist
- 1.5. Die Wirkung der Kritik
- 1.6. Das Veränderungsmodell des kapitalistischen Geistes nach Boltanski und Chiapello
- 1.7. Die Exit-Kritik
- 2. Die Börse als Schauplatz des Kapitalismus
- 2.1. Das Phänomen des Anlegerrückgangs
- 2.2. Der Trend der Exchange Traded Funds
- 2.3. Trend der ETF-Anlagen im Modell der dreistufigen Wechselbeziehung
- 2.4. Die Wirkung des ETF-Trends auf den kapitalistischen Geist
- 3. Der universelle Darwinismus
- 4. Die natürliche Selektivität als Wandlungsmechanismus des kapitalistischen Geistes
- 4.1. Der Kapitalismus im universellen Darwinismus
- 4.2. ETF-Investments als Replikatoren
- 4.3. Natürliche Selektivität als Ergänzung des Modells der dreistufigen Wechselbeziehung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Wandel des kapitalistischen Geistes und seine Ursachen. Sie setzt dabei den Fokus auf die Theorien von Luc Boltanski und Ève Chiapello, die in ihrem Werk „Der neue Geist des Kapitalismus“ die Wechselbeziehung zwischen Kapitalismus und Kritik als Motor des Wandels identifizieren. Die Arbeit analysiert aktuelle Veränderungen innerhalb des Kapitalismus und untersucht, ob diese sich auf den kapitalistischen Geist auswirken und welche Strukturen als Ursache dieser Wandlungen fungieren. Neben dem von Boltanski und Chiapello beschriebenen Dualismus zwischen Kritik und Kapitalismus wird eine alternative Erklärung für den Wandel des kapitalistischen Geistes vorgestellt und diskutiert.
- Der neue Geist des Kapitalismus nach Boltanski und Chiapello
- Die Bedeutung von Kritik für den Wandel des Kapitalismus
- Aktuelle Veränderungen im Kapitalismus, insbesondere der Trend zu Exchange Traded Funds (ETFs)
- Die Rolle des universellen Darwinismus im Wandel des kapitalistischen Geistes
- Alternative Erklärungen für den Wandel des kapitalistischen Geistes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz des Wandels des kapitalistischen Geistes. Sie stellt die Argumentationslinie der Arbeit dar und führt die Theorien von Boltanski und Chiapello ein.
Kapitel 1 beleuchtet die Theorien von Boltanski und Chiapello zum neuen Geist des Kapitalismus. Es werden die Minimaldefinition des Kapitalismus, der Geist des Kapitalismus, die Rechtfertigung des Kapitalismus und das Modell der dreistufigen Wechselbeziehung zwischen Kapitalismus und Kritik dargestellt.
Kapitel 2 analysiert das Phänomen des Anlegerrückgangs an der Börse und den Trend der Exchange Traded Funds (ETFs). Es untersucht die Auswirkungen des ETF-Trends auf den kapitalistischen Geist.
Kapitel 3 führt den universellen Darwinismus als ein mögliches Konzept zur Erklärung des Wandels des kapitalistischen Geistes ein.
Kapitel 4 betrachtet die natürliche Selektivität als Wandlungsmechanismus des kapitalistischen Geistes. Es analysiert die Rolle von ETF-Investments als Replikatoren und die natürliche Selektivität als Ergänzung des Modells der dreistufigen Wechselbeziehung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Themen des Kapitalismus, des Wandels des kapitalistischen Geistes, der Kritik und des universellen Darwinismus. Sie analysiert die Auswirkungen von Exchange Traded Funds (ETFs) auf den Kapitalismus und die Rolle der natürlichen Selektivität als Wandlungsmechanismus. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind: Kapitalakkumulation, Profitmaximierung, Rechtfertigung, dreistufige Wechselbeziehung, Replikatoren, Anlegerrückgang.
Häufig gestellte Fragen
Was verstehen Boltanski und Chiapello unter dem "neuen Geist des Kapitalismus"?
Es ist ein Set von Rechtfertigungen, die Menschen dazu motivieren, sich am kapitalistischen Akkumulationsprozess zu beteiligen, indem sie Werte wie Autonomie und Flexibilität betonen.
Welche Rolle spielt Kritik für den Wandel des Kapitalismus?
Kritik zwingt den Kapitalismus dazu, sich zu rechtfertigen und anzupassen, wodurch er Kritikpunkte absorbiert und so seinen "Geist" erneuert.
Wie wird der Trend zu ETFs in dieser Arbeit analysiert?
ETFs werden als Beispiel für einen Wandel untersucht, der möglicherweise nicht nur auf Kritik, sondern auf strukturelle Selektionsmechanismen zurückzuführen ist.
Was ist "universeller Darwinismus" im Kontext der Wirtschaft?
Es ist die Theorie, dass sich bestimmte Verhaltensweisen oder Finanzprodukte (wie ETFs) durch natürliche Selektion durchsetzen, weil sie effizienter "repliziert" werden.
Kann sich der Kapitalismus auch ohne Kritik verändern?
Die Arbeit diskutiert die natürliche Selektivität als einen Wandlungsmechanismus, der unabhängig von moralischer oder sozialer Kritik wirken kann.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Gründig (Autor:in), 2015, Natürliche Selektion als Wandlungsmechanismus des kapitalistischen Geistes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317312