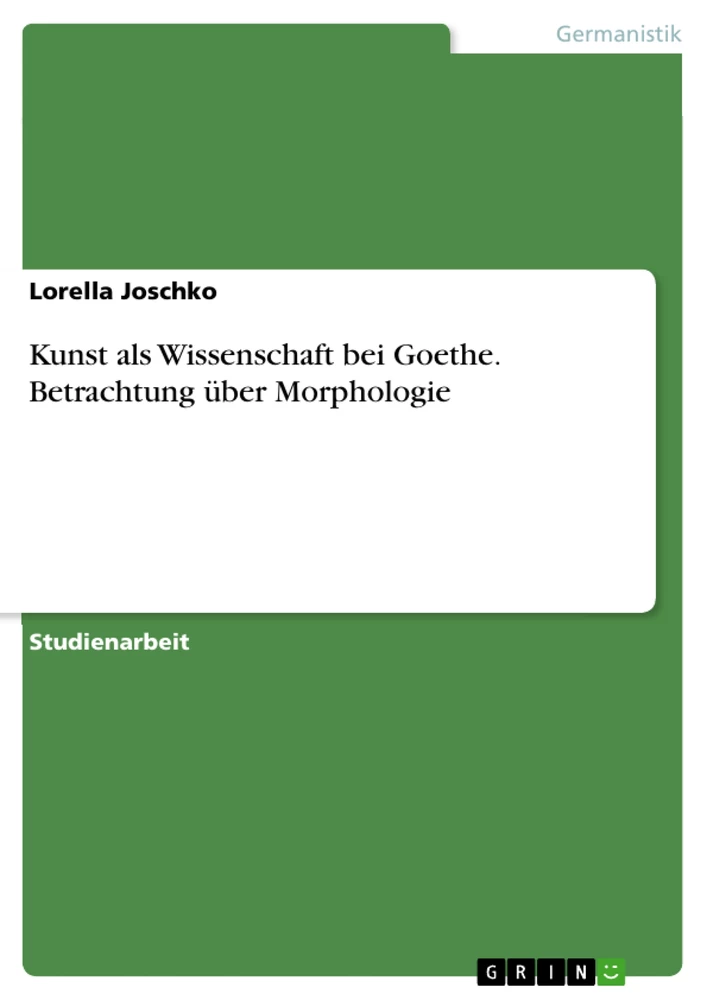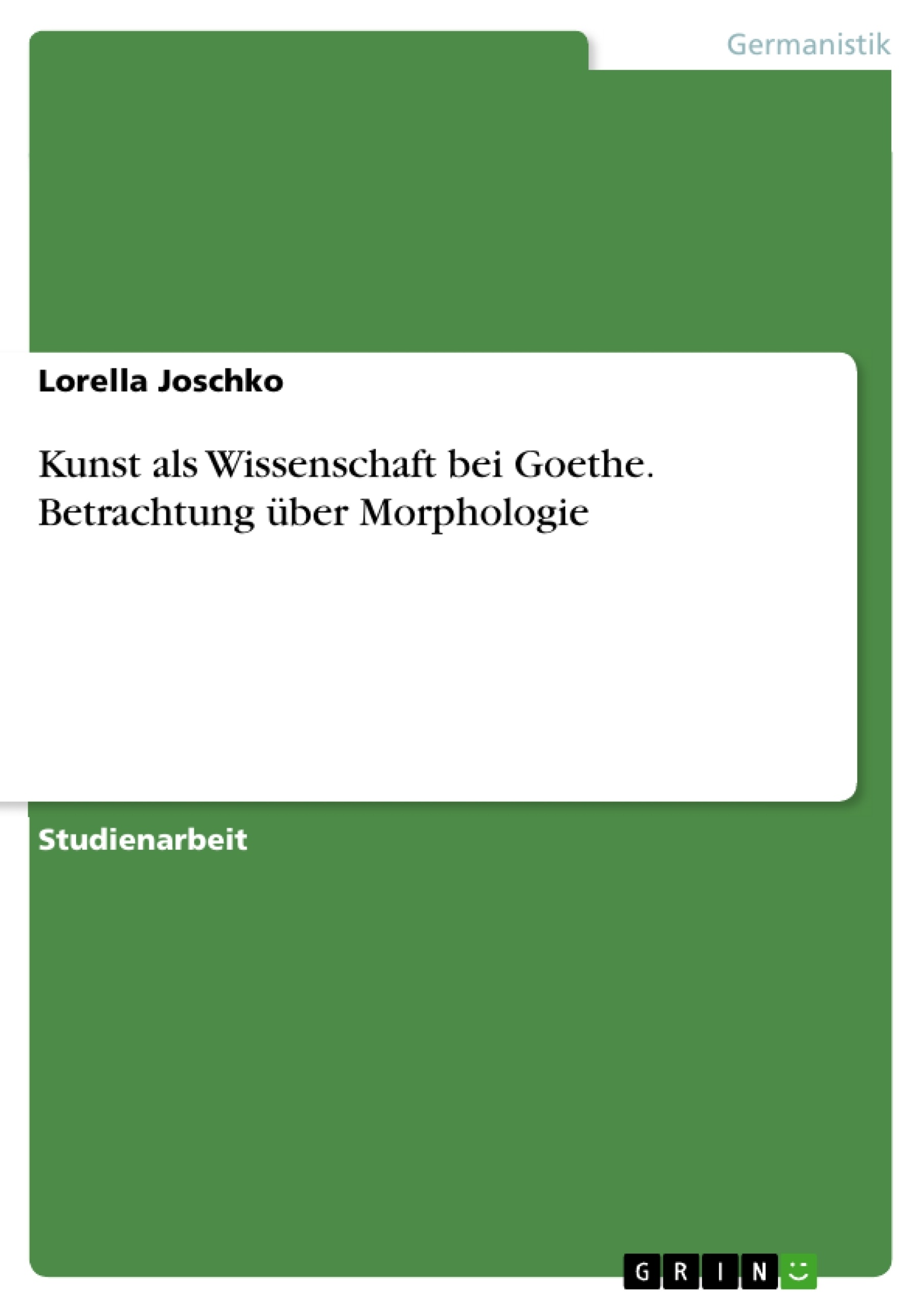Goethes literarisches Werk umfasst vor allem Lyrik, Dramen und erzählende Werke, aber auch gegenläufige Disziplinen wie kunsttheoretische und naturwissenschaftliche Schriften. Der Bezug zwischen Kunst und Naturwissenschaft entwickelte sich allmählich im Zuge Goethes Aufenthalt in Weimar und kam später mit der Italienreise zu seinem Höhepunkt. In dieser Zeit (1821) entstand auch die Erstfassung seines Romans „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ in dem die Verknüpfung von Kunst und Natur allzu gut deutlich wird.
Dieser Bezug schlägt sich allerdings auch in zahlreichen seiner anderen Werke nieder, wie zum Beispiel in „Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil“ oder auch in seinem umfassenden Briefwechsel. Goethe selbst sieht sich wohl als der „Vermittler von Objekt und Subjekt“, wobei die Natur den Platz des Objektes und der Mensch den Platz des Subjektes einnimmt. Er appelliert zur genauen Betrachtung der Dinge im Ganzen, denn nur dann wird sich einem auch das Allgemeine offenbaren können und was noch größerer Bedeutung zukommt, mit ihm auch der Geist der Dinge.
Goethes Werke zur Naturkunde, die fast ein drittel seines Gesamtwerkes ausmachen, sind allesamt von einer pantheistischen Naturphilosophie geprägt. Er versuchte stets zu statischen Gesetzmäßigkeiten Theorien übersinnlicher Phänomene gegenüberzustellen. Dieses Übersinnliche lässt sich nach Goethe in allen Organismen wiederfinden, offenbart sich allerdings nur im reinen Kunstwerk – im Schönen.
Das Wesen der Kunst (Schönheit), oder im engeren Sinne der Ästhetik wurzelte bereits in der Antike bei Vertretern wie Horaz, Aristoteles oder Platon. Der Begriff der Ästhetik leitet sich von dem griechischen Wort `aísthesis´ ab, was für Wahrnehmung, Gefühl und Verständnis steht. Erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts existiert die Ästhetik als eigenständige Disziplin in dessen Zentrum „die Konzeption einer Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis“ steht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Vom Beginn Goethes botanischer Studien
- Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären
- Die Urpflanze
- Goethes Kunstauffassung
- Natur und Kunst
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Johann Wolfgang von Goethes Auseinandersetzung mit der Natur, insbesondere mit seinem botanischen Studium und seiner Philosophie der Metamorphose der Pflanzen. Es wird Goethes Sichtweise auf die Verbindung von Natur und Kunst beleuchtet, sowie seine Kritik an der statischen Klassifizierung der Pflanzenwelt durch Carl von Linné.
- Goethes botanische Studien und ihre Einflüsse
- Die Metamorphose der Pflanzen als Ausdruck einer dynamischen Natur
- Die Einheit von Kunst und Natur in Goethes Werk
- Die Kritik an Linnés Klassifizierungssystem
- Goethes pantheistische Naturphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet Goethes literarisches und naturwissenschaftliches Werk und führt in die Thematik der Verbindung von Kunst und Natur ein. Kapitel 2 widmet sich Goethes botanischen Studien und beschreibt seine frühen Erfahrungen mit der Pflanzenwelt. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Goethes Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären und stellt seine Kritik an Linnés statischem Klassifizierungssystem dar.
Schlüsselwörter (Keywords)
Goethe, Botanik, Metamorphose, Naturphilosophie, Kunst, Linné, Klassifizierung, Einheit von Kunst und Natur, Pantheismus
Häufig gestellte Fragen zu Goethes Morphologie
Wie verband Goethe Kunst und Naturwissenschaft?
Goethe sah sich als Vermittler zwischen Objekt (Natur) und Subjekt (Mensch). Er glaubte, dass sich das Übersinnliche und der Geist der Dinge nur durch eine ganzheitliche Betrachtung offenbaren, die sowohl wissenschaftlich als auch künstlerisch ist.
Was ist Goethes Konzept der "Urpflanze"?
Die Urpflanze ist ein ideelles Modell, aus dem sich laut Goethe alle existierenden Pflanzenformen durch Metamorphose ableiten lassen. Sie repräsentiert das allgemeine Gesetz hinter der Vielfalt der Natur.
Warum kritisierte Goethe das System von Carl von Linné?
Goethe kritisierte Linnés System als zu statisch und rein klassifizierend. Er bevorzugte eine dynamische Sichtweise, welche die Entwicklung und Wandlung (Metamorphose) der Organismen in den Vordergrund stellt.
Welche Rolle spielte die Italienreise für Goethes Studien?
Die Italienreise markierte den Höhepunkt seiner Naturstudien. Dort festigte sich seine Anschauung der Metamorphose der Pflanzen und der enge Bezug zwischen der antiken Ästhetik und den Gesetzen der Natur.
Was bedeutet Pantheismus in Goethes Naturphilosophie?
Sein Pantheismus drückt die Überzeugung aus, dass das Göttliche bzw. ein lebendiger Geist in allen Teilen der Natur gegenwärtig ist und sich in den organischen Gesetzen der Welt zeigt.
- Citation du texte
- Lorella Joschko (Auteur), 2014, Kunst als Wissenschaft bei Goethe. Betrachtung über Morphologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317876