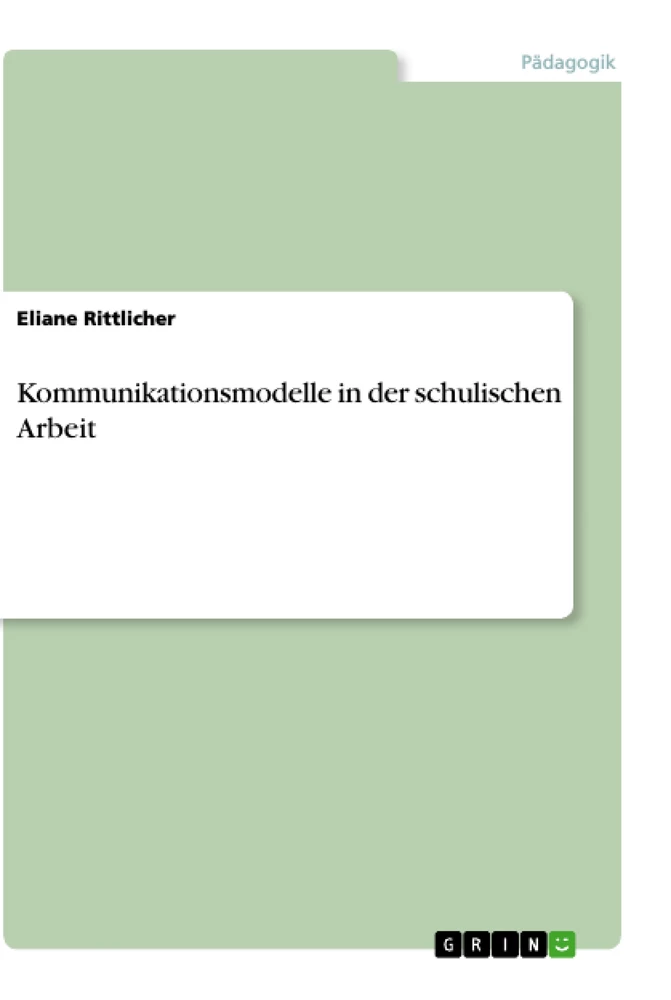Schulen sollten ihre Schüler auf das Leben in einer Weise vorbereiten, in der Erfolgsintelligenz zählt, nicht statische analytische Intelligenz. Stattdessen lassen sie ihre Schüler in einem Zustand der Ahnungslosigkeit. Am Ende stehen Ärzte, die keine Beziehung zu ihren Patienten herstellen können, Psychologen, deren Verständnis vom Menschen auf Lehrbuchfälle beschränkt ist, und Manager, die ein Problem vielleicht analysieren, aber nicht lösen können.
Hinsichtlich einer erfolgreichen Bewältigung des Lebens, auf das die Schule laut ihrem Bildungsauftrag vorbereiten soll, sind Kompetenzen von Nöten, die über kognitive Fähigkeiten und Kenntnisse hinausgehen. Sowohl die Erfolgsintelligenz, als auch die Emotionale Intelligenz umfassen dabei mehr als nur die kommunikative Kompetenz, diese sei aber, so Karl Schuster, die wichtigste Voraussetzung. Die umfassende Förderung der kommunikativen Kompetenz – sie beinhaltet neben der Fähigkeit zum sprachlichen Handeln in spezifischen Situationen auch die Fähigkeit, GesprächspartnerInnen einzuschätzen und einzuordnen, sowie die Kenntnis von situationstypischen Handlungsspielräumen – ist ein fachübergreifendes Lernziel.
Die kommunikative Kompetenz der SchülerInnen kann allerdings nur dann erweitert werden, wenn die Lehrperson selbst über umfassende kommunikationspsychologische Kenntnisse und sozial-kommunikative Handlungskompetenzen verfügt. [...]
Annette Bauer-Klebl setzt Unterrichten mit Kommunizieren, mit ‚in soziale Beziehung treten’ gleich. Unterrichten sei nur dann kompetent und adäquat möglich, wenn die Lehrkraft über sozial-kommunikative Handlungskompetenzen verfüge.
Bei Konrad Ehlich und Jochen Rehbein wird die Notwendigkeit sozial-kommunikativer Handlungskompetenz im Lehrberuf noch offensichtlicher: Vom ersten Klingeln an erwarten SchülerInnen von der Lehrperson „richtige sprachliche Handlungen“ und sind notfalls auch bereit, ihre Erwartungen ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen, wenn der Referendar, die Referendarin, noch von den Kommunikationsstrukturen an der Universität verwöhnt, nicht in der Lage ist, sie zu erfüllen.
Dieses für die unterrichtliche Kommunikation erforderliche Wissen stellen die im Folgenden vorgestellten Kommunikationsmodelle meiner Ansicht nach zur Verfügung.
Es werden ausführlich das Vier-Ohren-Modell (Schulz von Thun), Watzlawicks Kommunikationstheorie und die TZI (Ruth Cohn) vorgestellt und in Bezug auf ihre Bedeutung für die schulische Kommunikation hin ausgewertet!
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Wichtige Kommunikations- und Sprachtheorien vor Watzlawick
- 2.1. Das Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver (1949)
- 2.2. Das Organonmodell der Sprache von Karl Bühler (1934)
- 3. Die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick
- 3.1. Einführung
- 3.2. Begriffliche Grundlagen
- 3.2.1. Mitteilung
- 3.2.2. Interaktion
- 3.2.3. Rückkopplung
- 3.2.4. Metakommunikation
- 3.3. Die pragmatischen Axiome
- 3.3.1. Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
- 3.3.2. Die Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
- 3.3.3. Die Interpunktion von Ereignisfolgen
- 3.3.4. Digitale und analoge Kommunikation
- 3.3.5. Symmetrische und komplementäre Interaktionen
- 3.4. Gestörte Kommunikation
- 3.4.1. Die Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren
- 3.4.2. Störungen auf dem Gebiet der Inhalts- und Beziehungsaspekte
- 3.4.3. Die Interpunktion von Ereignisfolgen
- 3.4.4. Fehler in den Übersetzungen zwischen digitaler und analoger Kommunikation
- 3.4.5. Störungen in symmetrischen und komplementären Interaktionen
- 3.5. Paradoxe Kommunikation
- 3.5.1. Paradoxe Handlungsaufforderungen
- 3.5.2. Die Doppelbindungstheorie
- 3.6. Einordnung des Kommunikationsmodells
- 4. Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn
- 4.1. Einführung
- 4.2. Strukturen
- 4.3. Axiome
- 4.3.1. Existentiell-anthropologisches Axiom
- 4.3.2. Ethisch-soziales Axiom
- 4.3.3. Pragmatisch-politisches Axiom
- 4.4. Postulate
- 4.4.1. Erstes existentielles Postulat
- 4.4.2. Zweites existentielles Postulat
- 4.4.3. Ein drittes Postulat
- 4.5. Hilfsregeln
- 4.6. Funktion und Aufgabe der TZI-Gruppenleitenden
- 4.7. Hintergrund und Anliegen der Themenzentrierten Interaktion
- 5. Das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun
- 5.1. Einführung
- 5.2. Begriffliche Grundlagen
- 5.2.1. Nachricht
- 5.2.2. Interaktion
- 5.2.3. Feedback
- 5.2.4. Metakommunikation
- 5.3. Eine Nachricht mit vier Ohren empfangen
- 5.4. Die vier Ohren des Empfängers
- 5.4.1. Das „Sach-Ohr“
- 5.4.2. Das „Beziehungs-Ohr“
- 5.4.3. Das „Selbstoffenbarungs-Ohr“
- 5.4.4. Das „Appell-Ohr“
- 5.5. Die vier Seiten einer Nachricht
- 5.5.1. Die Sachseite
- 5.5.2. Die Beziehungsseite
- 5.5.3. Die Selbstoffenbarungsseite
- 5.5.4. Die Appellseite
- 5.6. Das Vier-Ohren-Modell als Zusammenschau verschiedener Ansätze
- 6. Die watzlawicksche Kommunikationstheorie und das Vier-Ohren-Modell Schulz von Thuns in der schulischen Arbeit
- 6.1. Nonverbale Kommunikation und Körpersprache im Unterricht
- 6.2. Interpunktionskonflikte und Metakommunikation im Unterricht
- 6.3. Inhalts- und Beziehungsebene in der schulischen Kommunikation
- 6.4. Symmetrie und Komplementarität in der LehrerIn-SchülerInnen-Beziehung
- 6.5. Beziehungsbotschaften und ihr Einfluss auf das Selbstkonzept des Menschen
- 6.6. Appelle in der schulischen Kommunikation
- 6.7. Das Vier-Ohren-Modell als kognitiver Wegweiser für ein emotionales Gelände
- 7. Cohns Themenzentrierte Interaktion in der schulischen Arbeit
- 7.1. Themenzentrierte Interaktion als Orientierungshilfe
- 7.2. Lebendiges Lehren und Lernen im Sinne der Themenzentrierten Interaktion
- 7.3. Selektive Authentizität und andere TZI-Hilfsregeln im Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Kommunikationsmodelle und ihre Anwendbarkeit im schulischen Kontext. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für effektive Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern zu schaffen und potenzielle Konflikte zu identifizieren und zu lösen.
- Analyse verschiedener Kommunikationsmodelle (Watzlawick, Schulz von Thun, Cohn)
- Anwendung der Modelle auf die Lehrer-Schüler-Interaktion
- Identifizierung von Kommunikationsstörungen im Unterricht
- Strategien zur Verbesserung der Kommunikation im schulischen Alltag
- Der Einfluss von Kommunikation auf das Selbstkonzept der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem Anspruch des lebensnahen Lernens und der schulischen Realität. Sie verweist auf die Werke von Sternberg und Goleman, die die Bedeutung von Erfolgsintelligenz und emotionaler Intelligenz für den Erfolg im Leben betonen, und argumentiert, dass kommunikative Kompetenz eine zentrale Voraussetzung für diese Intelligenzformen darstellt. Die Bedeutung von Kommunikationsfähigkeit in diversen Berufsbildern wird hervorgehoben.
2. Wichtige Kommunikations- und Sprachtheorien vor Watzlawick: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über frühe Kommunikationsmodelle, wie das von Shannon und Weaver, und das Organonmodell von Bühler, um den Kontext für die darauffolgenden, ausführlicher behandelten Theorien zu schaffen. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Entwicklung der Kommunikationstheorie.
3. Die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick: Dieser Abschnitt analysiert Watzlawicks Kommunikationstheorie umfassend. Die pragmatischen Axiome werden detailliert erklärt und ihre Relevanz für die Kommunikation, insbesondere für mögliche Störungen, hervorgehoben. Der Fokus liegt auf Konzepten wie der Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren, Inhalts- und Beziehungsaspekten, Interpunktion von Ereignisfolgen, digitaler und analoger Kommunikation, sowie symmetrischen und komplementären Interaktionen. Gestörte Kommunikation und paradoxe Kommunikation werden ebenfalls ausführlich betrachtet.
4. Die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn: Dieses Kapitel widmet sich der TZI als ganzheitliches Kommunikationsmodell. Es beschreibt die Strukturen, Axiome und Postulate der TZI und beleuchtet ihre Anwendung in Gruppenprozessen. Die Rolle der Gruppenleitenden und der Hintergrund der TZI werden ebenfalls diskutiert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und den Prinzipien der TZI für eine konstruktive Kommunikation.
5. Das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun: Das Kapitel erläutert das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun detailliert, einschließlich der vier Seiten einer Nachricht (Sach-, Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appell-Seite) und wie diese von den vier Ohren des Empfängers empfangen werden. Es betont das Zusammenspiel dieser Aspekte und deren Bedeutung für die Verständigung und mögliche Missverständnisse.
6. Die watzlawicksche Kommunikationstheorie und das Vier-Ohren-Modell Schulz von Thuns in der schulischen Arbeit: Dieses Kapitel wendet die zuvor beschriebenen Theorien auf den schulischen Kontext an. Es analysiert nonverbale Kommunikation, Interpunktionskonflikte, Inhalts- und Beziehungsebenen, Symmetrie und Komplementarität in der Lehrer-Schüler-Beziehung, Beziehungsbotschaften und ihren Einfluss auf das Selbstkonzept der Schüler, sowie Appelle im Unterricht. Das Vier-Ohren-Modell wird als Werkzeug zur Verbesserung der Klarheit und Stimmigkeit der Kommunikation im Schulalltag präsentiert.
7. Cohns Themenzentrierte Interaktion in der schulischen Arbeit: Das Kapitel untersucht die Anwendbarkeit der TZI im Unterricht. Es beleuchtet die TZI als Orientierungshilfe für Lehrkräfte, betont die Bedeutung der Persönlichkeit der Lehrkraft, und diskutiert praktische Aspekte wie das Delegieren von Aufgaben, den Umgang mit Störungen und die Förderung des „Wir-Gefühls“ im Klassenzimmer. Die Anwendung von TZI-Hilfsregeln wie der selektiven Authentizität wird ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Kommunikationsmodelle, Schulische Kommunikation, Lehrer-Schüler-Interaktion, Watzlawick, Schulz von Thun, Themenzentrierte Interaktion (TZI), Nonverbale Kommunikation, Interpunktion, Inhalts- und Beziehungsaspekte, Symmetrie, Komplementarität, Selbstkonzept, Appelle, Konflikte, Gestörte Kommunikation, Effektive Kommunikation, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Kommunikationsmodelle im schulischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Kommunikationsmodelle und deren Anwendung im schulischen Kontext. Es analysiert die Theorien von Paul Watzlawick, Friedemann Schulz von Thun und Ruth C. Cohn, um ein besseres Verständnis für effektive Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern zu ermöglichen und potentielle Konflikte zu identifizieren und zu lösen.
Welche Kommunikationsmodelle werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Kommunikationstheorie von Paul Watzlawick (mit den pragmatischen Axiomen, gestörter und paradoxer Kommunikation), die Themenzentrierte Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn (mit Strukturen, Axiomen, Postulaten und Hilfsregeln) und das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun (mit den vier Seiten einer Nachricht und den vier Ohren des Empfängers).
Welche Vorläufermodelle werden betrachtet?
Zur Einordnung der zentralen Theorien werden das Kommunikationsmodell von Shannon und Weaver (1949) und das Organonmodell der Sprache von Karl Bühler (1934) kurz vorgestellt.
Wie werden die Modelle auf den schulischen Kontext angewendet?
Das Dokument analysiert die Anwendung der Modelle auf die Lehrer-Schüler-Interaktion, indem es Aspekte wie nonverbale Kommunikation, Interpunktionskonflikte, Inhalts- und Beziehungsebenen, Symmetrie und Komplementarität in der Lehrer-Schüler-Beziehung, Beziehungsbotschaften und deren Einfluss auf das Selbstkonzept der Schüler sowie Appelle im Unterricht untersucht. Die praktische Umsetzung der Themenzentrierten Interaktion im Unterricht wird ebenfalls beleuchtet.
Welche konkreten Themen werden im Detail behandelt?
Zu den detailliert behandelten Themen gehören die pragmatischen Axiome Watzlawicks (Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren; Inhalts- und Beziehungsaspekte; Interpunktion; digitale und analoge Kommunikation; symmetrische und komplementäre Interaktionen), gestörte und paradoxe Kommunikation, die Strukturen, Axiome und Postulate der TZI, die vier Seiten einer Nachricht und die vier Ohren des Empfängers nach Schulz von Thun, sowie der Einfluss der Kommunikation auf das Selbstkonzept der Schüler.
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für effektive Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern zu schaffen, potentielle Konflikte zu identifizieren und zu lösen, sowie Strategien zur Verbesserung der Kommunikation im schulischen Alltag aufzuzeigen. Es untersucht den Einfluss der Kommunikation auf das Selbstkonzept der Schüler und analysiert verschiedene Kommunikationsmodelle und deren Anwendbarkeit im schulischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kommunikationsmodelle, Schulische Kommunikation, Lehrer-Schüler-Interaktion, Watzlawick, Schulz von Thun, Themenzentrierte Interaktion (TZI), Nonverbale Kommunikation, Interpunktion, Inhalts- und Beziehungsaspekte, Symmetrie, Komplementarität, Selbstkonzept, Appelle, Konflikte, Gestörte Kommunikation, Effektive Kommunikation, Pädagogik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels prägnant darstellt.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist für Lehrkräfte, Pädagogen, Studenten der Pädagogik und alle Interessierten relevant, die sich mit dem Thema Kommunikation im schulischen Kontext auseinandersetzen möchten.
- Citar trabajo
- Eliane Rittlicher (Autor), 2005, Kommunikationsmodelle in der schulischen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317939