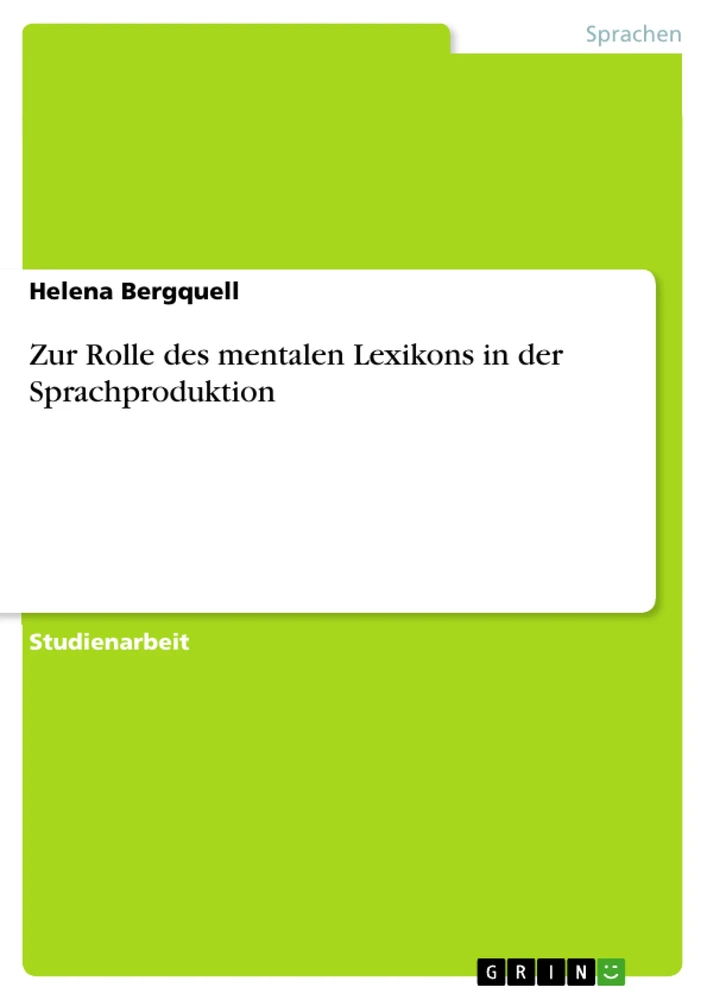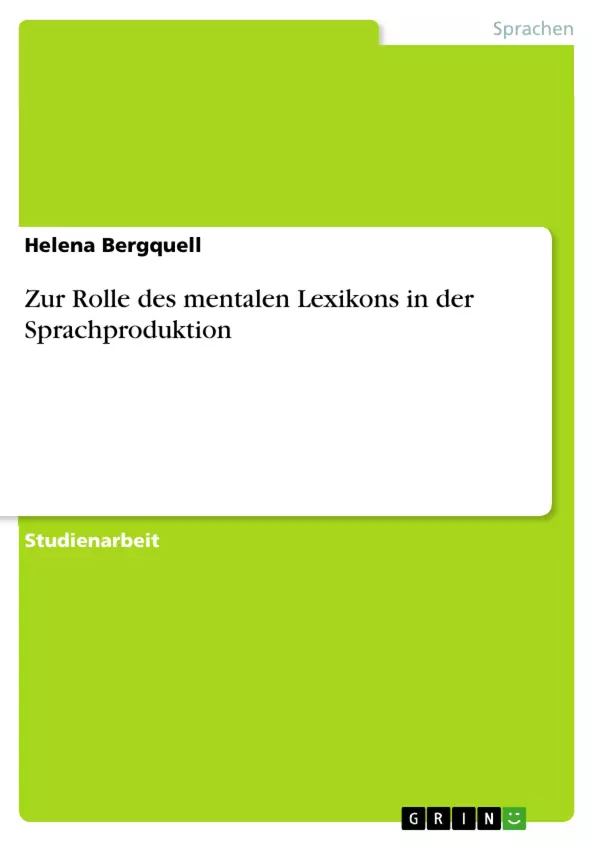Unter einem Lexikon versteht man ein nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk für alle Wissensgebiete oder für ein bestimmtes Sachgebiet, auch Wörterbuch genannt. Der menschliche Wortspeicher wird in der Linguistik als mentales Lexikon bezeichnet und ist ein Modell des sprachlichen Wortschatzes. In der Psycholinguistik bezeichnet man einen sprachlichen Wissensbestand im Langzeitgedächtnis, in dem die Wörter einer Sprache mental repräsentiert sind, als mentales Lexikon. Das mentale Lexikon muss einem Sprecher für die Verwendung von Wörtern Informationen über die Lautform, über die orthografische Form, über die syntaktische sowie semantische Eigenschaften von Wörtern bereitstellen.
Trotz der ähnlichen Bezeichnungen und auch inhaltlichen Überschneidungen gibt es organisatorische und inhaltliche Unterschiede zwischen dem Wörterbuch und dem mentalen Lexikon. Diese Unterschiede werden in der Psycholinguistik meist durch Versprecher erforscht. Die alphabetische Ordnung des Wörterbuches kann nicht auf das mentale Lexikon übertragen werden, da hierbei bei einem Versprecher ein alphabetisch benachbartes Wort gewählt würde. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Dennoch besteht die Möglichkeit, dass die Wörter teilweise tatsächlich nach ihren Anlauten sortiert sind. Mitentscheidend sind aber auch andere Aspekte der Lautstruktur, wie der Auslaut, das Akzentmuster sowie der Vokal mit dem Hauptakzent.
Diese Arbeit wirft die Frage auf, wie Wörter im mentalen Lexikon gespeichert werden. Die Fragstellung wird anhand des Beispiels der Flexionsendungen diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entwicklung einer Fragestellung zur Abspeicherung von Wörtern im mentalen Lexikon.
- 2.) Die Speicherung von Wörtern im mentalen Lexikon.
- Hypothese 1: Flexionsendungen werden erst bei Bedarf an ihre Wörter gehängt.
- Hypothese 2: Derivationspräfixe und -suffixe sind bereits im mentalen Lexikon mit ihrem Stamm verknüpft.
- 3.) Erörterung Hypothese 1: Flexionsendungen werden erst bei Bedarf an ihre Wörter gehängt.
- Erörterung Hypothese 2: Derivationspräfixe und -suffixe sind bereits im mentalen Lexikon mit ihrem Stamm verknüpft.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Wörter im mentalen Lexikon gespeichert sind. Ziel ist es, zu erforschen, ob Flexionsendungen erst bei Bedarf an Wörter gehängt werden oder ob Derivationspräfixe und -suffixe bereits im mentalen Lexikon mit ihrem Stamm verknüpft sind.
- Das mentale Lexikon als Modell des sprachlichen Wortschatzes
- Unterschiede zwischen Wörterbuch und mentalem Lexikon
- Die Rolle von Versprechern in der Forschung des mentalen Lexikons
- Flexion und Wortbildung als Teilbereiche der Morphologie
- Die Organisation von Wörtern im mentalen Lexikon
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik des mentalen Lexikons ein und beschreibt die Unterschiede zwischen dem gedruckten Wörterbuch und dem mentalen Lexikon. Es werden verschiedene Aspekte des mentalen Lexikons beleuchtet, wie die Organisation, die Anzahl der Einträge und die Geschwindigkeit der Suche. Kapitel 2 stellt zwei Hypothesen zur Speicherung von Wörtern im mentalen Lexikon vor. Die erste Hypothese besagt, dass Flexionsendungen erst bei Bedarf an ihre Wörter gehängt werden, während die zweite Hypothese die Verknüpfung von Derivationspräfixen und -suffixen mit ihren Stämmen im mentalen Lexikon postuliert. Kapitel 3 behandelt die Erörterung der ersten Hypothese, während das vierte Kapitel die zweite Hypothese analysiert.
Schlüsselwörter
Mentales Lexikon, Wortbildung, Flexion, Morphologie, Derivation, Präfixe, Suffixe, Versprecher, Psycholinguistik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das mentale Lexikon?
Es ist ein Modell des sprachlichen Wortschatzes im Langzeitgedächtnis, das Informationen über Lautform, Bedeutung und Grammatik speichert.
Wie unterscheidet sich das mentale Lexikon von einem Wörterbuch?
Im Gegensatz zum alphabetischen Wörterbuch ist das mentale Lexikon nach phonologischen, semantischen und morphologischen Kriterien vernetzt.
Wie werden Flexionsendungen im Gehirn verarbeitet?
Es wird diskutiert, ob Flexionsendungen (wie -st, -te) erst bei der Sprachproduktion an den Stamm gehängt werden oder mit diesem zusammen gespeichert sind.
Was verraten Versprecher über das mentale Lexikon?
Versprecher zeigen, dass Wörter oft nach Anlauten, Akzentmustern oder ähnlichen Bedeutungen gruppiert sind, da meist ähnliche Wörter verwechselt werden.
Was ist die Rolle von Derivationspräfixen?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass Präfixe und Suffixe bei der Wortbildung bereits fest mit ihrem Stamm im Lexikon verknüpft sein könnten.
- Quote paper
- Helena Bergquell (Author), 2015, Zur Rolle des mentalen Lexikons in der Sprachproduktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317955