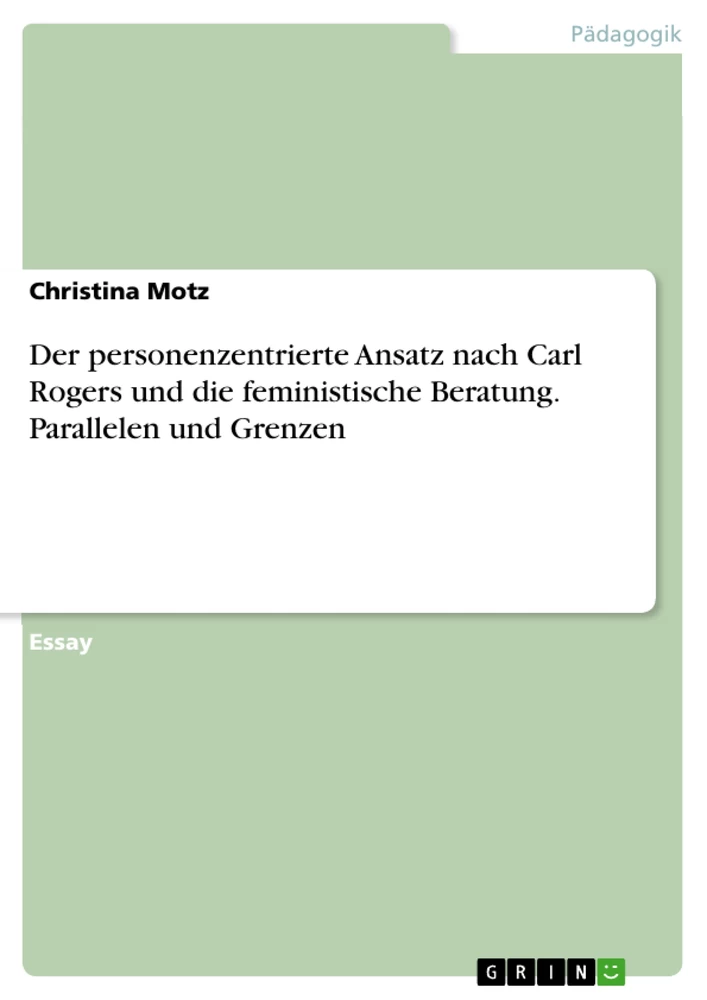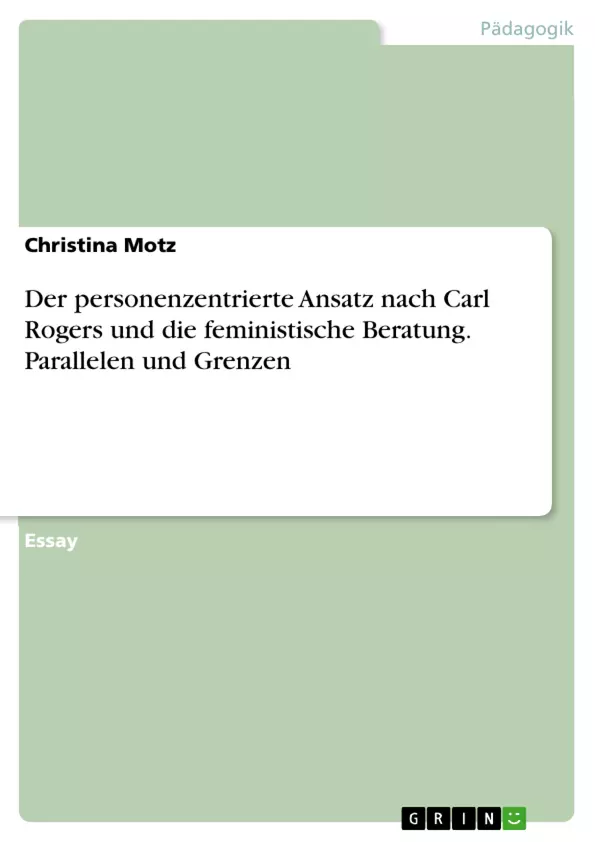Meine Arbeit befasst sich mit zwei verschiedenen Beratungskonzepten, die innerhalb der Beratung weite Verbreitung finden und auch weitere Beratungsfelder beeinflusst haben. Es handelt sich um die feministische und die personenzentrierte Beratung. Mein Anliegen ist es, diese beiden Perspektiven zunächst einzeln darzustellen, um anschließend zu betrachten, inwieweit sie übereinstimmen bzw. miteinander vereinbar sind oder wo sich Abgrenzungen und Widersprüche aufweisen lassen.
Dazu gehe ich im ersten Schritt näher auf die Perspektive der feministischen Beratung ein und versuche diese Beratungsform zu umreißen. Im Anschluss werfe ich einen näheren Blick auf einen Wandel innerhalb der feministischen Beratung, der sich ausgehend von der Perspektive der Solidarisierung hin zu einer verstärkten Anerkennung von Vielfalt, vollzogen und die feministische Beratung und ihre Perspektive auf die Klientinnen nachhaltig beeinflusst hat.
Danach folgt die Auseinandersetzung mit der Frage nach Macht und dem Umgang mit dieser innerhalb der feministischen Beratungsbeziehung.
Der zweite Themenblock beinhaltet die Grundsätze der personenzentrierten Beratung, das darin vorherrschende Menschenbild bzw. den Blick auf den Klienten sowie die Art und Relevanz der Beratungsbeziehung.
Abschließend verweise ich auf die Parallelen und jeweiligen Differenzen zwischen beiden Ansätzen und ziehe ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Perspektive der feministischen Beratung
- Was bedeutet „feministisch“ beraten?
- Solidarisierung und politische Positionierung vs. Anerkennung von Heterogenität?
- Beratung als machtvolles Beziehungsverhältnis
- Der personenzentrierte Ansatz Carl Rogers
- Was bedeutet „Personenzentrierte Beratung“?
- Das Menschenbild innerhalb der personenzentrierten Beratung
- Die Relevanz einer wertschätzenden Beratungsbeziehung
- Der personenzentrierte Ansatz und die feministische Beratung
- Parallelen und Grenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert und vergleicht die feministische und die personenzentrierte Beratung als zwei bedeutende Ansätze im Bereich der Beratung. Der Fokus liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Perspektiven, insbesondere im Hinblick auf die Beratungspraxis und die Berücksichtigung von Machtverhältnissen.
- Die feministische Beratung als Reaktion auf patriarchale Strukturen und Diskriminierung von Frauen
- Der Wandel von Solidarisierung zu Anerkennung von Heterogenität in der feministischen Beratung
- Der Umgang mit Macht und Unterordnung in der feministischen Beratungsbeziehung
- Die Grundprinzipien der personenzentrierten Beratung, insbesondere die Betonung der Klientenzentrierung und der wertschätzenden Beziehung
- Die Parallelen und Differenzen zwischen der feministischen und der personenzentrierten Beratung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die beiden Beratungskonzepte ein und erläutert die Zielsetzung des Textes. Das zweite Kapitel befasst sich mit der feministischen Beratung, definiert den Begriff und beleuchtet die Entwicklung von einer solidarischen zu einer heterogeneren Perspektive. Kapitel 2.3 analysiert die Machtverhältnisse innerhalb der feministischen Beratungsbeziehung. Kapitel 3 präsentiert den personenzentrierten Ansatz Carl Rogers, wobei die Grundprinzipien, das Menschenbild und die Bedeutung der Beratungsbeziehung im Mittelpunkt stehen. Das vierte Kapitel untersucht die Parallelen und Grenzen zwischen der feministischen und der personenzentrierten Beratung. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Feministische Beratung, personenzentrierte Beratung, Machtverhältnisse, Geschlechterrollen, Heterogenität, Klientenzentrierung, wertschätzende Beziehung, Beratungspraxis, Empowerment, Selbstbestimmung, Gleichstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der personenzentrierten Beratung nach Carl Rogers?
Der Kern liegt in der Wertschätzung, Empathie und Kongruenz des Beraters, wobei der Klient als Experte für sein eigenes Erleben im Mittelpunkt steht.
Was zeichnet feministische Beratung aus?
Feministische Beratung berücksichtigt gesellschaftliche Machtverhältnisse und patriarchale Strukturen, die das Leben von Frauen beeinflussen, und zielt auf Empowerment und politische Bewusstwerdung ab.
Wie gehen beide Ansätze mit dem Thema Macht um?
Während die personenzentrierte Beratung Machtunterschiede durch eine gleichwertige Beziehung minimieren will, analysiert die feministische Beratung Macht als strukturelles Problem in der Gesellschaft und der Beratung selbst.
Was bedeutet „Anerkennung von Heterogenität“ in der feministischen Beratung?
Es bedeutet den Wandel von einer rein solidarischen Sichtweise („alle Frauen sind gleich“) hin zur Anerkennung der Vielfalt von Lebensentwürfen, Herkunft und Identitäten der Klientinnen.
Gibt es Parallelen zwischen Rogers' Ansatz und feministischer Beratung?
Ja, beide Ansätze betonen die Selbstbestimmung des Klienten/der Klientin und lehnen autoritäre, bevormundende Expertenrollen in der Beratung ab.
- Citar trabajo
- Christina Motz (Autor), 2012, Der personenzentrierte Ansatz nach Carl Rogers und die feministische Beratung. Parallelen und Grenzen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318022