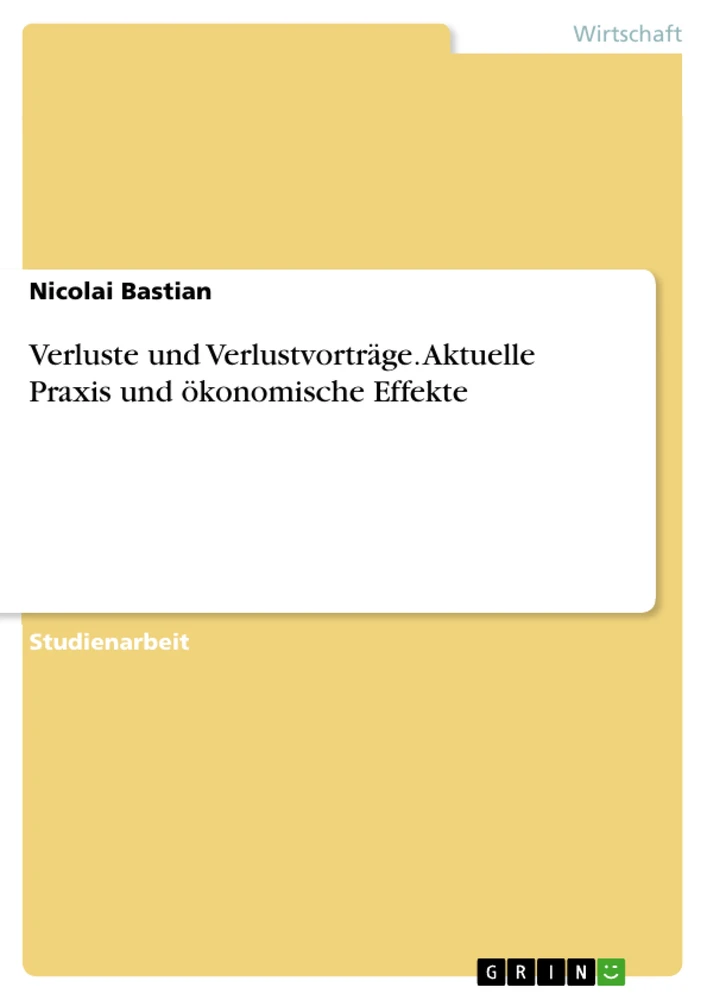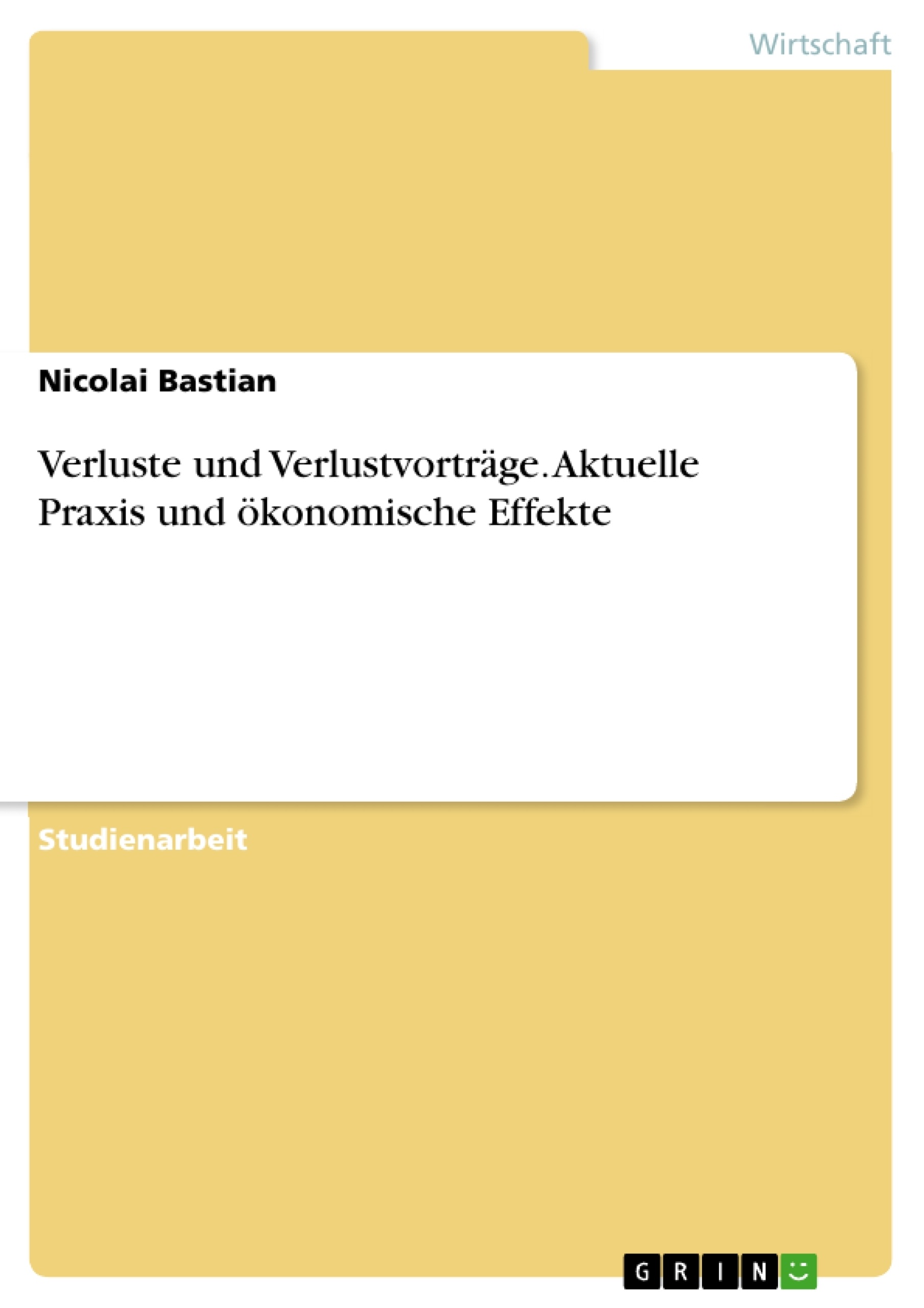Dies ist eine Seminararbeit über die Thematik rund um Verluste und Verlustvorträge. Es wird auf europäische und deutsche Gesetzmäßigkeiten eingegangen und die praktische Handhabe, sowie die ökonomischen Effekte aus der Verlustnutzungsmöglichkeit und deren Einschränkungen behandelt.
Im Zuge der vergangenen Wirtschaftskrise, aber auch aufgrund aktueller Ereignisse, wie beispielsweise dem VW-Abgasskandal und dem hieraus entstandenen wirtschaftlichen Schaden, kommt dem Umgang mit finanziellen Verlusten und den daraus resultierenden Verlustvorträgen eine nach wie vor tragende Rolle zu.
Am Jahresende 2011 hatten die unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen deutschen Unternehmen einen Verlustvortrag in Höhe von rund 570 Milliarden Euro angehäuft (siehe hierzu: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2015, S. 21), was rund 35 Milliarden Euro mehr als dem Schweizer Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr entspricht (Vgl. OECD 2012, S. 11).
Aus der Sicht von Unternehmen und Investoren ist es wünschenswert, dass diese Verluste für steuerliche Zwecke mit Gewinnen verrechnet werden. Durch die Möglichkeit der Verlustnutzung entsteht dem betroffenen Unternehmen so ein ökonomischer Vorteil, da hierdurch Liquiditätsabflüsse durch Steuerzahlungen vermieden werden können und letztlich mehr Liquidität im Unternehmen verbleibt, welche wiederum für Investitionen oder Ausschüttungen an die Gesellschafter eingesetzt werden kann (Vgl. Becker et al. 2009, S. 22).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Aktuelle Praxis
- 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Verlustverrechnung in Deutschland
- 2.2 Verlustverrechnung im internationalen Vergleich
- 2.3 Modellierung
- 2.4 Verlustverwertungsstrategien
- 2.4.1 zweistufiger Erwerb
- 2.4.2 sale-and-lease-back
- 3 Ökonomische Effekte
- 3.1 Wertigkeit der Steuerersparnis durch Verlustverrechnung
- 3.2 Verlustverrechnung hinsichtlich neuer Unternehmen
- 3.3 Auswirkungen im internationalen Wettbewerb
- 3.4 Auswirkungen auf die Risikobereitschaft
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Handhabung von Verlusten und Verlustvorträgen im unternehmerischen Bereich, insbesondere in Bezug auf die Auswirkungen der deutschen Restriktionen zur Verlustverrechnung. Sie beleuchtet internationale Unterschiede in der gesetzlichen Regelung und analysiert die ökonomischen Effekte der Verlustnutzung.
- Rechtliche Grundlagen der Verlustverrechnung in Deutschland und im internationalen Vergleich
- Modellierung und Strategien zur Verlustverwertung
- Ökonomische Auswirkungen der Verlustverrechnung auf Unternehmen
- Einfluss der Verlustverrechnung auf den internationalen Wettbewerb
- Auswirkungen auf die unternehmerische Risikobereitschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Bedeutung des Umgangs mit Verlustvorträgen, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngeren Wirtschaftskrise und von Ereignissen wie dem VW-Abgasskandal. Sie unterstreicht den ökonomischen Vorteil der Verlustverrechnung für Unternehmen durch Vermeidung von Liquiditätsabflüssen und betont den Zielkonflikt zwischen unternehmerischem Interesse an zeitnaher Verlustnutzung und staatlichem Interesse an stabilen Steuereinnahmen. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung: die Darstellung der aktuellen Praxis der Verlustbehandlung, die Analyse der deutschen Restriktionen, der Vergleich internationaler Regelungen und die Bewertung der ökonomischen Effekte der Verlustnutzung.
2 Aktuelle Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die alltägliche Bedeutung von Verlusten in Unternehmen, insbesondere in Anlauf- und Krisensituationen. Es erläutert die Bedeutung des Verlustvortrags und des Verlustrücktrags zur Minimierung der Steuerlast und das unternehmerische Ziel, den Barwert der Steuerersparnis durch möglichst zeitnahe und umfassende Verrechnung der Verluste mit hoch besteuerten Gewinnen zu maximieren. Der Fokus liegt auf der Optimierung der Verlustnutzung im Interesse des Unternehmens.
2.1 Rechtliche Grundlagen zur Verlustverrechnung in Deutschland: Dieses Kapitel befasst sich mit den deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen der Verlustverrechnung. Es beschreibt die Einschränkungen, die der deutsche Staat zur Sicherung des Steuersubstrats auferlegt, inklusive der Begrenzungen des Verlustrücktrags nach § 10d Abs. 1 EStG und des Verlustvortrags nach § 10d Abs. 2 EStG. Besonders hervorgehoben wird die Beschränkung des Verlustabzugs für Körperschaften gemäß § 8c KStG, eingeführt zur Verhinderung von missbräuchlichem Handel mit Verlustmänteln (Mantelkauf). Das Kapitel erklärt die Konsequenzen dieser Regelungen, wie die anteilige oder vollständige Vernichtung von Verlustvorträgen bei schädlichen Beteiligungserwerben.
3 Ökonomische Effekte: Dieses Kapitel befasst sich mit den ökonomischen Folgen der Verlustverrechnung und deren Einschränkungen. Es analysiert den Wert der Steuerersparnis, die Auswirkungen auf neue Unternehmen und den internationalen Wettbewerb, sowie den Einfluss auf die unternehmerische Risikobereitschaft. Die Analyse wird wahrscheinlich Modellrechnungen und empirische Daten verwenden, um die ökonomischen Auswirkungen zu quantifizieren und zu interpretieren. Es könnte beispielsweise die Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen und die Kapitalstruktur von Unternehmen untersuchen.
Schlüsselwörter
Verlustverrechnung, Verlustvortrag, Verlustrücktrag, Steuerersparnis, Unternehmenssteuer, Körperschaftsteuer, § 10d EStG, § 8c KStG, internationaler Vergleich, ökonomische Effekte, Risikobereitschaft, Verlustnutzungsstrategien, Mantelkauf.
Häufig gestellte Fragen zu: Verlustverrechnung im unternehmerischen Bereich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Handhabung von Verlusten und Verlustvorträgen in Unternehmen, insbesondere die Auswirkungen der deutschen Restriktionen zur Verlustverrechnung. Sie vergleicht internationale Regelungen und analysiert die ökonomischen Effekte der Verlustnutzung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Verlustverrechnung in Deutschland und im internationalen Vergleich, Modellierung und Strategien zur Verlustverwertung, ökonomische Auswirkungen auf Unternehmen, den Einfluss auf den internationalen Wettbewerb und die Auswirkungen auf die unternehmerische Risikobereitschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur aktuellen Praxis der Verlustverrechnung (inklusive rechtlicher Grundlagen in Deutschland und im internationalen Vergleich sowie Verlustverwertungsstrategien), ein Kapitel zu den ökonomischen Effekten und ein Fazit.
Was sind die rechtlichen Grundlagen der Verlustverrechnung in Deutschland?
Die Arbeit beschreibt die deutschen rechtlichen Rahmenbedingungen, inklusive der Beschränkungen des Verlustrücktrags (§ 10d Abs. 1 EStG) und des Verlustvortrags (§ 10d Abs. 2 EStG). Besonders wird die Beschränkung des Verlustabzugs für Körperschaften (§ 8c KStG) zur Verhinderung von missbräuchlichem Handel mit Verlustmänteln (Mantelkauf) erläutert.
Welche ökonomischen Effekte werden analysiert?
Analysiert werden der Wert der Steuerersparnis durch Verlustverrechnung, die Auswirkungen auf neue Unternehmen und den internationalen Wettbewerb sowie der Einfluss auf die unternehmerische Risikobereitschaft. Die Analyse verwendet wahrscheinlich Modellrechnungen und empirische Daten.
Welche Verlustverwertungsstrategien werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht Strategien wie den zweistufigen Erwerb und Sale-and-Lease-back als Möglichkeiten zur Verlustverwertung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Verlustverrechnung, Verlustvortrag, Verlustrücktrag, Steuerersparnis, Unternehmenssteuer, Körperschaftsteuer, § 10d EStG, § 8c KStG, internationaler Vergleich, ökonomische Effekte, Risikobereitschaft, Verlustnutzungsstrategien, Mantelkauf.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die aktuelle Praxis der Verlustbehandlung darzustellen, die deutschen Restriktionen zu analysieren, internationale Regelungen zu vergleichen und die ökonomischen Effekte der Verlustnutzung zu bewerten.
Welche Bedeutung hat der Umgang mit Verlustvorträgen?
Der Umgang mit Verlustvorträgen ist wichtig zur Vermeidung von Liquiditätsabflüssen und zur Minimierung der Steuerlast. Es besteht ein Zielkonflikt zwischen unternehmerischem Interesse an zeitnaher Verlustnutzung und staatlichem Interesse an stabilen Steuereinnahmen.
- Quote paper
- Nicolai Bastian (Author), 2016, Verluste und Verlustvorträge. Aktuelle Praxis und ökonomische Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318125