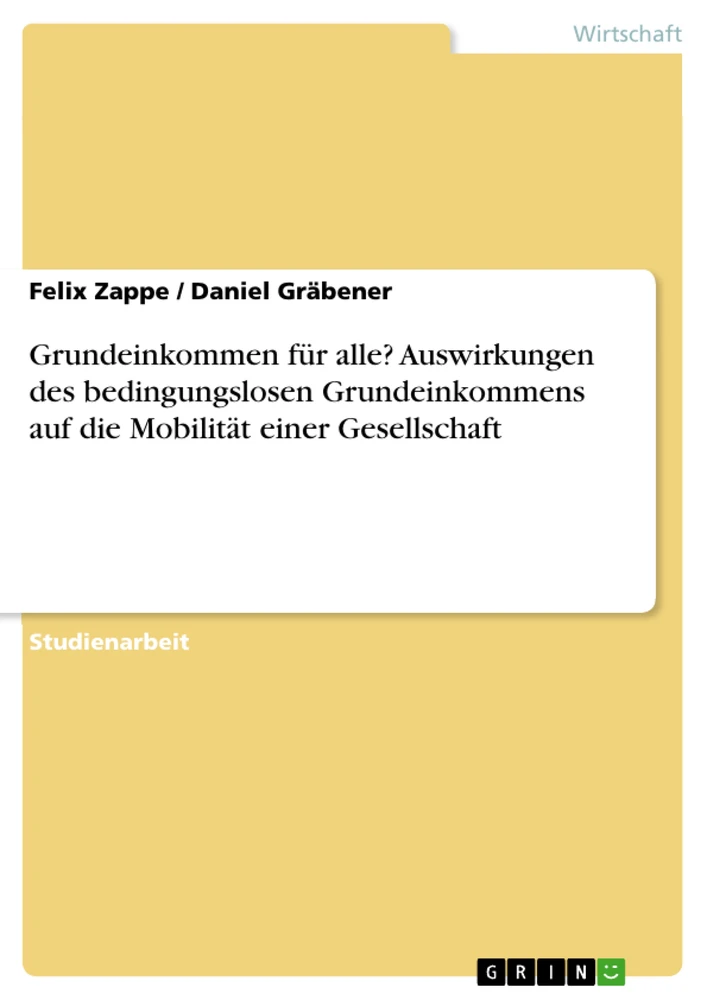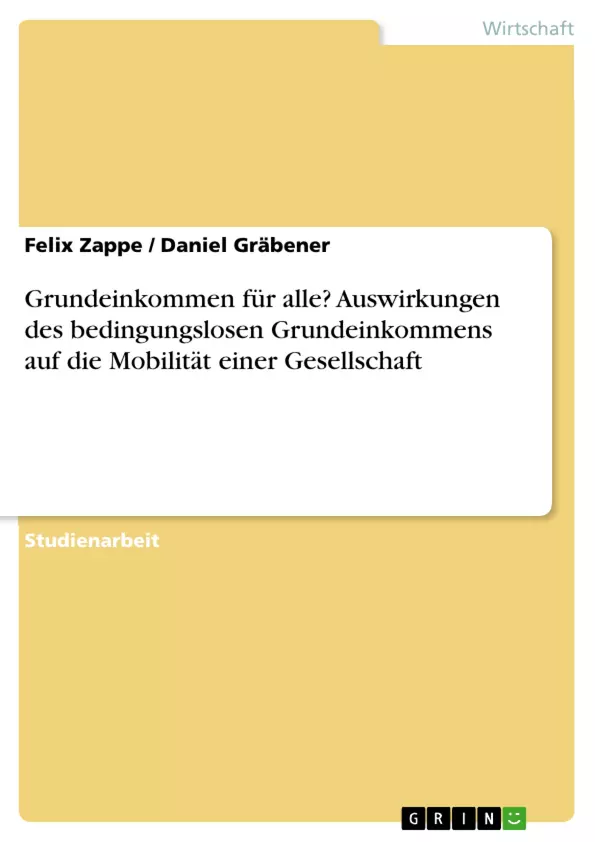Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welche Auswirkungen die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf die geographische, soziale und Arbeitsmobilität hätte. Dazu vergleicht sie die Auswirkungen des BGE auf die Dimensionen des sozioökonomischen Wohlstandes der einzelnen Sinus-Milieus.
Nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen, um wirklich das Leben zu leben, nach dem man als eigenständiges und selbst denkendes Individuum womöglich strebt. Eine Idee, wie man diese soziale Ungerechtigkeit überwinden könnte, liefern Yannick Vanderborght und Philippe Van Parijs in Ihrem Buch: „Ein Grundeinkommen für alle?“ (2005). Zusammenfassend wird eine bisher noch als utopisch eingestufte Idee unter die Lupe genommen, die einen positiven Einfluss auf zahlreiche Lebenssituationen haben könnte.
Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser zunächst einen generellen Überblick über die vorhandenen Forschungsansätze des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) zu nennen. Dabei soll bereits zu Beginn die Idee samt seiner Modalitäten und verschiedenen Ausprägungen umfangreich dargestellt werden. Anschließend folgt eine Gegenüberstellung verschiedenster Vor- und Nachteile, um die Frage zu klären, inwiefern ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt sinnvoll bzw. umsetzbar ist.
Durch die Darstellung der Vor- und Nachteile soll eine kritische Würdigung des Konzepts erfolgen, welche jedoch keinesfalls einen Anspruch auf Vollständigkeit besitzt, dem Leser jedoch die wichtigsten Argumente für und gegen die Einführung eines BGE eindringlich näher bringen soll. Im Folgenden gilt es dann herauszuarbeiten, inwiefern man ein bedingungsloses Grundeinkommen mit dem Stichwort Mobilität sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Es folgt eine Exploration des Begriffs „Mobilität“, welche die inhaltliche Tragweite dieses Begriffs fernab der populärwissenschaftlich-technischen Nutzung darstellt und somit einen Rahmen liefert, in dem die Auswirkungen der Einführung des BGE betrachtet werden können. Dieser Betrachtung schließt sich eine zusammenfassende Schlussbetrachtung an, welche, flankiert von einem konkreten Forschungsvorhaben, den Ausgangspunkt für eine weitere tiefergehende Erörterung des Themas ermöglicht.
Das Vorgehen dieser Arbeit ist somit rein qualitativ-explorativ und stützt sich auf die Fusion verschiedener Gedanken der vorliegenden Literatur. Dies ist vor allem dem Umstand der bisher rein fiktiven Einführung des BGE geschuldet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Methodik
- 2. Das bedingungslose Grundeinkommen
- 2.1 Definition und Idee des Grundeinkommens
- 2.2 Modalitäten des BGE
- 2.3 Eine sinnvolle Idee?
- 2.3.1 Vorteile eines BGE
- 2.3.2 Nachteile eines BGE
- 3. Mobilität
- 3.1 Begriffsexplikation Mobilität
- 3.2 Betrachtung der Mobilitätskategorien
- 4. Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Mobilität
- 4.1 Auswirkungen auf die geographische Mobilität
- 4.2 Auswirkungen auf die Arbeitsmobilität
- 4.3 Auswirkungen auf die soziale Mobilität
- 5. Schlussbetrachtung und Ergebnisse
- 5.1 Zusammenfassung und Fazit
- 5.2 Implikationen für die Forschung & Praxis
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf die Mobilität einer Gesellschaft. Ziel ist es, die Idee des BGE, seine Vor- und Nachteile sowie seine potenziellen Auswirkungen auf verschiedene Mobilitätsformen (geographisch, arbeitsbezogen, sozial) zu analysieren. Die Arbeit basiert auf einer qualitativ-explorativen Methode, da empirische Daten zum Thema fehlen.
- Das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) und seine Definition
- Vor- und Nachteile eines BGE
- Der Begriff Mobilität und seine verschiedenen Dimensionen
- Auswirkungen des BGE auf geographische Mobilität
- Auswirkungen des BGE auf Arbeits- und soziale Mobilität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einführende Kapitel skizziert die Problemstellung sozialer Ungerechtigkeit und die daraus resultierende Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) als möglichen Lösungsansatz. Es definiert die Zielsetzung der Arbeit – einen Überblick über das BGE zu geben, seine Vor- und Nachteile zu diskutieren und seine potenziellen Auswirkungen auf die Mobilität zu analysieren – und beschreibt die gewählte Methodik, die aufgrund des Mangels an empirischen Daten zur Wirkung des BGE auf die Mobilität, eine rein qualitative und explorative Herangehensweise ist. Die Autoren betonen die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit weiterer Forschung.
2. Das bedingungslose Grundeinkommen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Konzept des BGE. Es beleuchtet die zugrundeliegenden Ideen und Definitionen, untersucht verschiedene Modalitäten seiner Umsetzung und diskutiert ausführlich die Argumente für und gegen seine Einführung. Die Diskussion umfasst sowohl ökonomische als auch soziale Aspekte, wobei die Autoren eine kritische, aber ausgewogene Perspektive einnehmen, die sowohl die potenziellen Vorteile als auch die Herausforderungen der Implementierung eines BGE hervorhebt. Die Kapitel verwendet bereits existierende Forschungsarbeiten und Theorien als Grundlage der Analyse.
3. Mobilität: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Auseinandersetzung mit dem Begriff "Mobilität". Es geht über eine rein verkehrstechnische Interpretation hinaus und erörtert die verschiedenen Dimensionen von Mobilität, insbesondere geographische, soziale und arbeitsbezogene Mobilität. Die Autoren legen eine breite Definition zugrunde, die die verschiedenen Facetten und Zusammenhänge von Mobilität in der Gesellschaft umfasst, um einen soliden Rahmen für die spätere Analyse der Auswirkungen des BGE auf die Mobilität zu schaffen. Das Kapitel dient als wichtige Grundlage für die folgenden Kapitel.
4. Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Mobilität: In diesem zentralen Kapitel werden die potenziellen Auswirkungen eines BGE auf verschiedene Aspekte der Mobilität untersucht. Es werden die Auswirkungen auf die geographische Mobilität (z.B. Wohnortwechsel), die Arbeitsmobilität (z.B. Wechsel des Arbeitsplatzes oder der beruflichen Tätigkeit) und die soziale Mobilität (z.B. Verbesserung der sozialen Teilhabe) analysiert. Die Autoren entwickeln Hypothesen über die möglichen Veränderungen, wobei sie die komplexen Interaktionen zwischen dem BGE und den verschiedenen Mobilitätsformen hervorheben und die Unsicherheiten und offenen Fragen betonen.
Schlüsselwörter
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Mobilität (geographisch, sozial, arbeitsbezogen), soziale Ungerechtigkeit, Armut, ökonomische Auswirkungen, soziale Auswirkungen, qualitative Forschung, explorative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf die Mobilität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) auf verschiedene Aspekte der Mobilität – geographisch, arbeitsbezogen und sozial. Sie untersucht die Idee des BGE, seine Vor- und Nachteile und deren potenziellen Einfluss auf die Mobilität einer Gesellschaft.
Welche Methodik wird verwendet?
Da empirische Daten zum Thema fehlen, verwendet die Arbeit eine qualitative und explorative Forschungsmethode. Die Analyse basiert auf bestehender Forschung und Theorien.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die zentralen Themen sind das bedingungslose Grundeinkommen (BGE), seine Definition und verschiedenen Modalitäten, die verschiedenen Dimensionen von Mobilität (geographisch, sozial, arbeitsbezogen) und die potenziellen Auswirkungen des BGE auf diese Mobilitätsformen. Die Arbeit untersucht sowohl die Vorteile als auch die Nachteile eines BGE.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Methodik), Das bedingungslose Grundeinkommen (Definition, Modalitäten, Vor- und Nachteile), Mobilität (Begriffsexplikation und Kategorien), Auswirkungen des BGE auf die Mobilität (geographisch, arbeitsbezogen, sozial) und Schlussbetrachtung (Zusammenfassung, Fazit, Implikationen für Forschung und Praxis, Ausblick).
Welche Aspekte des BGE werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Definition und die Idee des BGE, verschiedene Modalitäten seiner Umsetzung, seine ökonomischen und sozialen Aspekte, sowie die Argumente für und gegen seine Einführung. Die Diskussion beinhaltet eine kritische, aber ausgewogene Betrachtung der potenziellen Vorteile und Herausforderungen.
Welche Aspekte der Mobilität werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht geographische Mobilität (z.B. Wohnortwechsel), Arbeitsmobilität (z.B. Arbeitsplatzwechsel) und soziale Mobilität (z.B. Verbesserung der sozialen Teilhabe). Der Begriff "Mobilität" wird umfassend definiert, um die verschiedenen Facetten und Zusammenhänge in der Gesellschaft zu berücksichtigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung fasst die Ergebnisse zusammen, zieht ein Fazit und diskutiert die Implikationen für die Forschung und Praxis. Es wird auch ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen gegeben. Aufgrund der gewählten Methodik bleiben viele Fragen offen und der Bedarf an weiterer Forschung wird betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE), Mobilität (geographisch, sozial, arbeitsbezogen), soziale Ungerechtigkeit, Armut, ökonomische Auswirkungen, soziale Auswirkungen, qualitative Forschung, explorative Forschung.
- Quote paper
- Felix Zappe (Author), Daniel Gräbener (Author), 2015, Grundeinkommen für alle? Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens auf die Mobilität einer Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318435