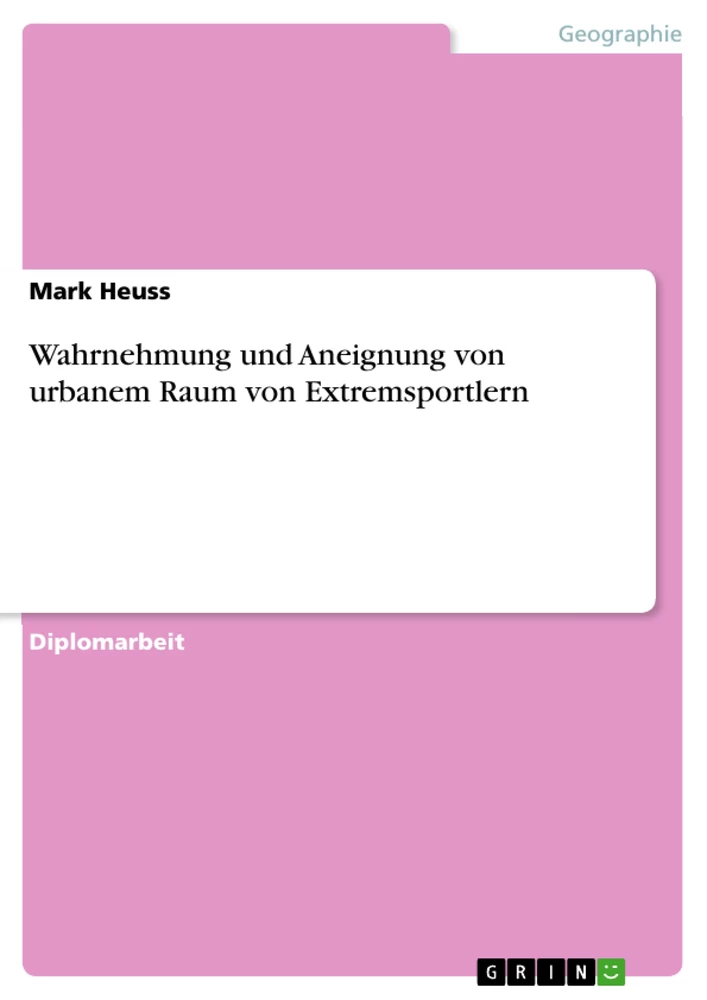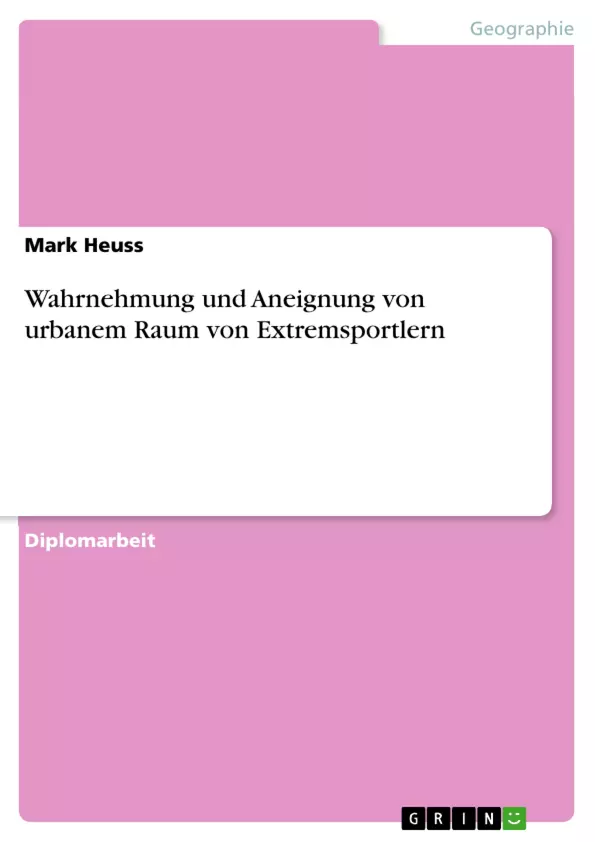Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen die Prozesse der Wahrnehmung und der Aneignung von städtischem Raum durch Extremsportler. Anhand der hierfür gewählten Tätigkeit des Inlineskatings soll dargestellt werden, auf welche Weise die handelnden Individuen unter Verwendung dieser spezifischen Perspektive die Räume ihrer Umwelt wahrnehmen, welche Bewertungskriterien hierfür verwendet werden und wie der subjektive Wahrnehmungsprozess auf die Erschaffung von neuem Raum durch das Handeln der Inlineskater Einfluss nimmt.
Die bestehenden Wechselwirkungen der Wahrnehmung und der Aneignung von Raum werden im Zuge dieser Arbeit anhand des konkreten Beispiels der Inlineskater in München qualitativ erforscht, um so Erkenntnisse über die resultierenden Verhaltensmuster, die bestehenden Handlungsstrategien und die konkreten räumlichen Auswirkungen der stattfindenden Prozesse auf subjektiver und kollektiver Ebene gewinnen zu können.
Nach einer kurzen thematischen Einführung der beschriebenen Sportart wird die theoretische Grundlage der Arbeit anhand von wahrnehmungsgeographischen Ansätzen und einer modifizierten Version des Aneignungskonzeptes dargestellt, woraufhin eine Verbindung der theoretischen Überlegungen zwischen dem Konzept der Raumaneignung sowie der wahrnehmungstheoretischen Ansätze und der Tätigkeit des Inlineskatings vollzogen wird. Für die durch Inlineskating neu erschaffenen Räume wird die Bedeutung der medialen Reproduktion, sowie bestehende Konfliktpotentiale im öffentlichen Raum herausgearbeitet.
Die im Zuge einer qualitativen Multimethodik erhobenen Daten über die Prozesse der Wahrnehmung und Aneignung an den sogenannten „Skate Spots“ werden verglichen und im Bezug zur Forschungsfrage interpretiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- Fragestellung/ Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Ausgewählter Extremsport Inlineskating
- Was ist Inlineskating?
- Geschichte und Entwicklung des Inlineskatings
- Theoretischer Hintergrund
- Raum
- Der Begriff „Raum“
- Das Raummodell von LÖW
- Der öffentliche Raum
- Raumaneignung
- Das Aneignungskonzept
- Modifikation des Aneignungskonzeptes nach LÖW
- Gegenkultureller Raum
- Raumwahrnehmung
- Der Begriff „Wahrnehmung“
- Geschichte der Wahrnehmungsgeographie
- Geographische Wahrnehmungskonzepte
- Mental Map
- Kritik an der Wahrnehmungsgeographie
- Raumaneignung durch Inlineskating
- Das „Skater´s Eye“
- Der „Skate Spot“
- Handlungsursachen
- Reproduktion des Raums
- Konfliktpotential im öffentlichen Raum
- Methodik
- Qualitative Sozialforschung
- Multimethodik
- Teilnehmende Beobachtung
- Mental Maps
- Qualitative Interviews
- Quellenanalyse
- Auswertung und Analyse
- Lokalisierung der Untersuchung
- Wahrnehmung und Aneignung von „Skate Spots“ in München
- Vorstellungsbilder von „Skate Spots“ in München
- Objekte werden zu „Skate Spots“
- Suchen und Finden von „Skate Spots“
- Einfluss der medialen Reproduktion auf die Wahrnehmung
- Münchener „Skate Spots“ als Produkte der Raumaneignung
- Die „Hacker-Curbs“
- Die „Wetterstein-Lowrails“
- Wolfratshausen
- Das Olympiagelände
- Fazit
- Forschungsausblick und Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Wahrnehmung und Aneignung von urbanem Raum durch Inlineskater. Die Arbeit soll untersuchen, wie Inlineskater ihre Umwelt wahrnehmen und welches Verhalten daraus resultiert. Dazu soll zunächst theoretisch erarbeitet werden, wie Inlineskating als ein Prozess der Aneignung von urbanem Raum verstanden werden kann. In Verbindung mit der subjektiven Wahrnehmung soll so dargestellt werden, auf welche Art Räume von Inlineskatern wahrgenommen und selbst im Handeln erschaffen werden.
- Die Bedeutung von Raum und seiner Wahrnehmung durch Inlineskater
- Die Prozesse der Raumaneignung durch Inlineskating
- Die Rolle von Medien und sozialer Interaktion beim Finden und Nutzen von Skate-Spots
- Die Entstehung von Konflikten zwischen Inlineskatern und anderen Nutzergruppen im öffentlichen Raum
- Die Auswirkungen von Verdrängungsversuchen auf das Verhalten von Inlineskatern
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und der Definition von Inlineskating, insbesondere dem Streetskating, als eine Aktivität, die die Funktionszuweisungen von städtischen Elementen neu interpretiert. Im Anschluss wird die Geschichte und Entwicklung des Inlineskatings beleuchtet, wobei ein Schwerpunkt auf den USA liegt, dem Entstehungsgebiet der modernen Inlineskate-Kultur. Kapitel 3 widmet sich dem theoretischen Hintergrund der Arbeit, wobei Raum, Raumaneignung und Raumwahrnehmung unter Berücksichtigung verschiedener wissenschaftlicher Ansätze diskutiert werden.
Kapitel 4 verknüpft die theoretischen Überlegungen mit der Praxis des Inlineskatings. Es wird das Konzept des „Skater´s Eye“ eingeführt, das die spezifische Wahrnehmung von Inlineskatern für befahrbare Objekte im öffentlichen Raum beschreibt. Anschließend werden „Skate Spots“ als von Inlineskatern neu erschaffene Räume genauer untersucht, wobei die Motivation für die Raumaneignung, die Reproduktion von Räumen durch Medien und das Konfliktpotential im öffentlichen Raum thematisiert werden.
Kapitel 5 erläutert die verwendeten Methoden der qualitativen Sozialforschung, insbesondere die teilnehmenden Beobachtung, Mental Maps, qualitative Interviews und die Quellenanalyse. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Untersuchung der Themengebiete Wahrnehmung und Aneignung von „Skate Spots“ anhand von ausgewählten Fallbeispielen des Münchener Raums präsentiert. Es wird gezeigt, wie Inlineskater ihre Umwelt wahrnehmen, „Skate Spots“ finden und nutzen, und welche Bedeutung die mediale Reproduktion von Räumen für sie hat. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der Erkenntnisse und einem Ausblick auf mögliche Forschungsfelder im Bereich der Stadtentwicklung und der Integration neuer Nutzungen des öffentlichen Raums.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Wahrnehmung, Aneignung, Raum, Inlineskating, Skate-Spot, Medien, Konfliktpotential, öffentlicher Raum und Stadtentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit über urbanen Raum?
Die Arbeit untersucht die Prozesse der Wahrnehmung und Aneignung von städtischem Raum durch Extremsportler, am Beispiel von Inlineskatern in München.
Was versteht man unter dem Begriff „Skater’s Eye“?
Das „Skater’s Eye“ beschreibt die spezifische Wahrnehmung von Inlineskatern für befahrbare Objekte im öffentlichen Raum, die über die reine Funktionszuweisung hinausgehen.
Welche Rolle spielen Medien bei der Raumaneignung durch Inlineskater?
Medien dienen der Reproduktion von Räumen; sie beeinflussen die Wahrnehmung von „Skate Spots“ und helfen beim Finden und Nutzen dieser Orte auf kollektiver Ebene.
Welche methodischen Ansätze wurden in der Untersuchung verwendet?
Es wurde eine qualitative Multimethodik angewandt, bestehend aus teilnehmender Beobachtung, Mental Maps, qualitativen Interviews und Quellenanalysen.
Welche Konfliktpotenziale ergeben sich im öffentlichen Raum?
Konflikte entstehen durch die Neuinterpretation von Funktionszuweisungen städtischer Elemente und die daraus resultierenden Verdrängungsversuche durch andere Nutzergruppen.
- Citation du texte
- Dipl. Geograph Univ. Mark Heuss (Auteur), 2010, Wahrnehmung und Aneignung von urbanem Raum von Extremsportlern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318690