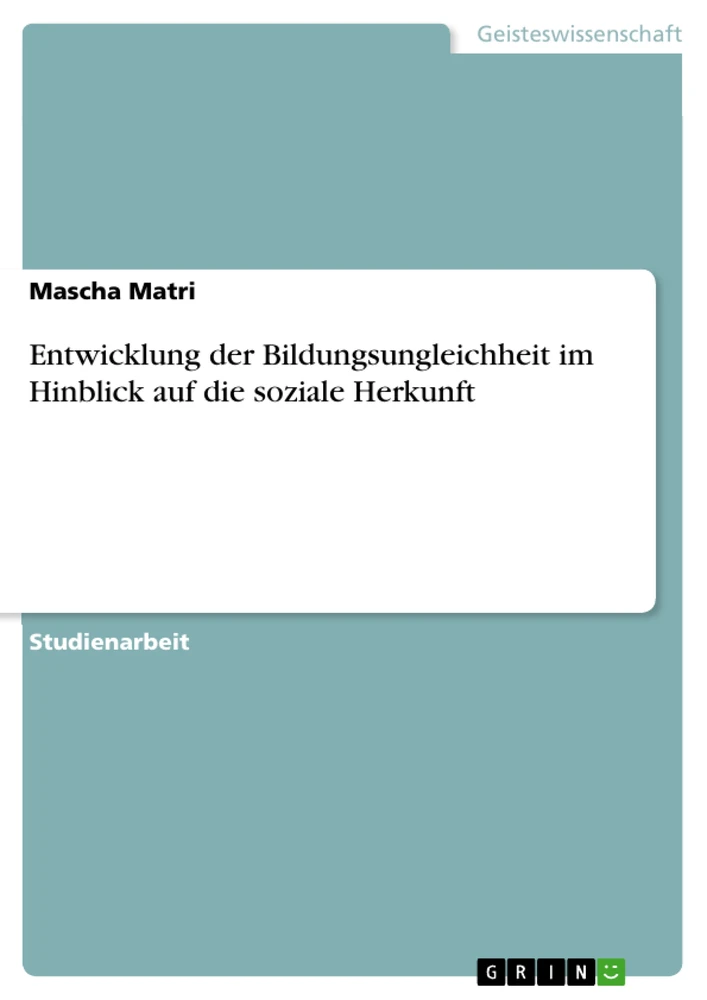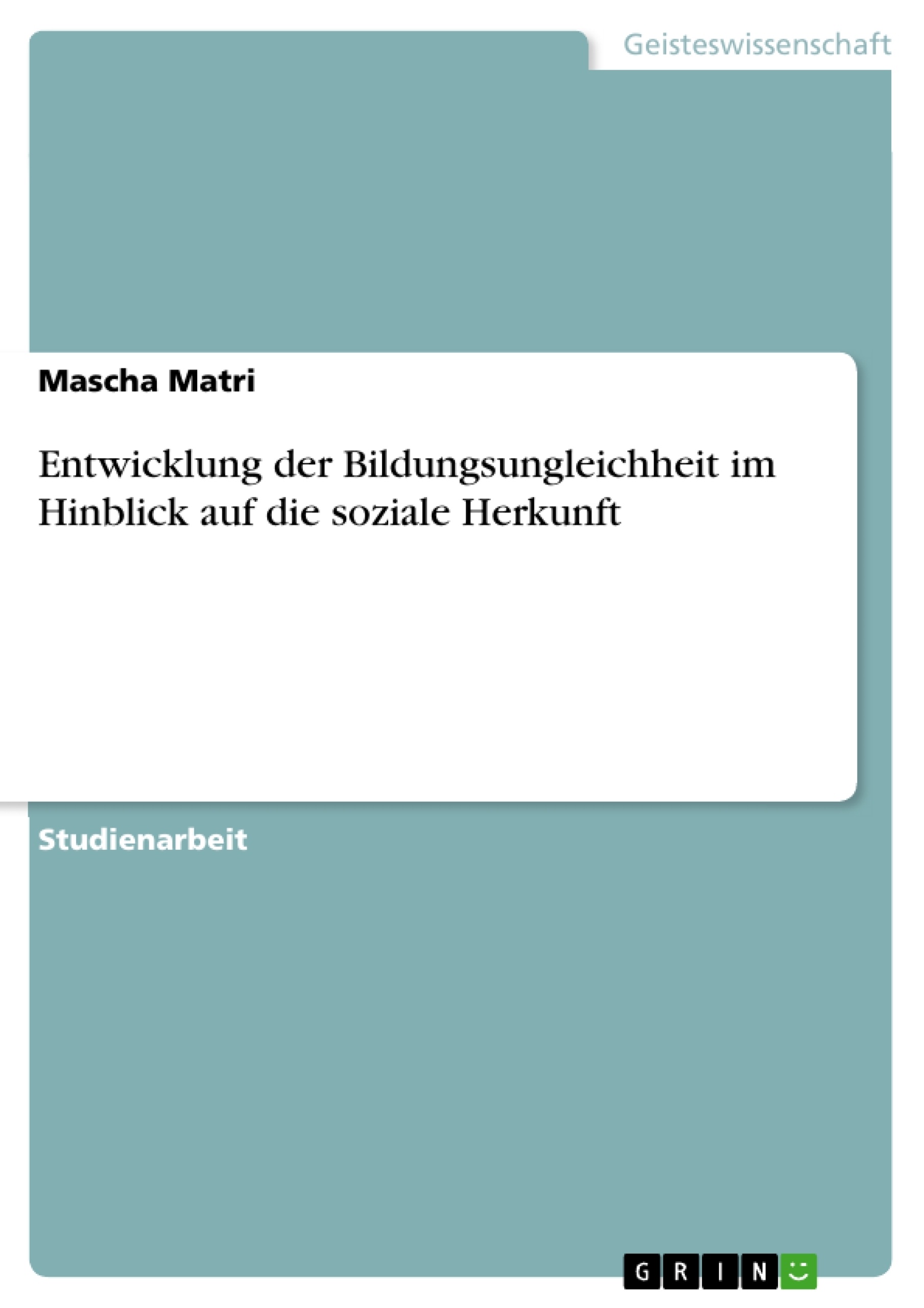Die vorliegende Gruppenarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage: „Inwiefern kann man bezüglich der Bildungsungleichheit in Deutschland von einer positiven Entwicklung sprechen?“. Die Einleitung der Arbeit dient mit einem kurzen Problemaufriss dazu, einen Überblick über die Bedeutsamkeit der Bildungsbenachteiligung in Deutschland zu skizzieren. Durch den Hauptteil wird mit Hilfe von Daten und Studienergebnissen vertieft auf die Entwicklung der Bildungsungleichheit eingegangen und somit versucht, die Forschungsfrage zu beantworten. Im Fazit werden die Ergebnisse zusammenfassend kritisch beleuchtet und ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen des deutschen Bildungssystems gegeben. Als Motivation für die Verfassung der vorliegenden Gruppenarbeit dient das Hervorheben der Relevanz des Themas „Bildungsungleichheit in Deutschland“. Dieses hat für die Autoren als Studierende einen hohen Stellenwert in Bezug auf die berufliche Zukunft.
Im Zuge der Entfaltung des wirtschaftlichen Wachstums, des technischen Fortschritts und individueller Prosperität gewann Bildung einen zunehmenden Stellenwert und rief die Forderung nach einem Ausbau der Bildungsmöglichkeiten hervor. Diese Forderung wurde durch die Bildungsexpansion der sechziger und siebziger Jahre erhört und führte mit dem Ausbau an sekundären und tertiären Bildungseinrichtungen zu einer allgemeinen Verbesserung des Bildungsangebots der Bundesrepublik Deutschland. Der „PISA-Schock“ im Jahr 2000 offenbarte jedoch einen signifikanten Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg der Schüler in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Die nachfolgenden Jahre waren unter der Prämisse einer Reduzierung der sozialen Herkunftseffekte, mitsamt Bildungsreformen, ausschlaggebend für die verstärkte Untersuchung dieser schichtspezifischen Abhängigkeit.
Für eine positive Auswirkung der Bildungsexpansion spricht die Entwicklung der Besucherzahlen von Hauptschulen, welche im Zeitraum von 1952 bis 2003 stark zurückgegangen sind, wohingegen sich die Schülerzahlen von Realschulen verdreifacht und die von Gymnasien verdoppelt haben. Die vorliegende Gruppenarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage: „Inwiefern kann man bezüglich der Bildungsungleichheit in Deutschland von einer positiven Entwicklung sprechen?“. Diese Frage thematisiert die abhängige Variable der Bildungsabschlüsse der Schüler in Relation zu der unabhängigen Variable der Bildungsabschlüsse der Eltern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Bezüge
- 2.1 Ausgangspunkt der Bildungsexpansion
- 2.2 Ursachen der Bildungsungleichheit
- 3. Erlangen der Hochschulreife
- 4. Ergebnisse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland im Kontext der Bildungsexpansion. Ziel ist es, die Forschungsfrage zu beantworten, inwiefern von einer positiven Entwicklung hinsichtlich der Bildungsungleichheit gesprochen werden kann, indem der Zusammenhang zwischen den Bildungsabschlüssen der Eltern und der Kinder analysiert wird.
- Entwicklung der Bildungsexpansion in Deutschland
- Ursachen der Bildungsungleichheit
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg
- Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem
- Bewertung der Wirksamkeit von Bildungsreformen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den historischen Kontext der Bildung in Deutschland, beginnend mit der vorindustriellen Zeit und dem Mangel an formaler Bildung. Sie beschreibt die Entwicklung der Bildungsexpansion ab dem 19. Jahrhundert und den "PISA-Schock" im Jahr 2000, der den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufdeckte. Die Arbeit fokussiert die Forschungsfrage nach einer positiven Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland, indem sie den Zusammenhang zwischen Bildungsabschlüssen von Eltern und Kindern untersucht. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse und stellt die zentrale Forschungsfrage dar.
2. Theoretische Bezüge: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Zuerst wird die Bildungsexpansion in drei Phasen unterteilt und deren Ursachen im Kontext von wirtschaftlichen und politischen Faktoren, aber auch bildungsinternen Prozessen, erläutert. Die steigende Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften, der Einfluss der USA und Großbritanniens, sowie der zunehmende internationale Wettbewerb werden als Triebkräfte der Bildungsexpansion genannt. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit den Ursachen der Bildungsungleichheit und stellt die Hypothese auf, dass die Bildungsexpansion zu einer reduzierten Abhängigkeit des Bildungserfolgs von Kindern vom Bildungsniveau der Eltern geführt hat. Das Kapitel verbindet historische Entwicklungen mit soziologischen Theorien, um den Rahmen für die empirische Untersuchung zu schaffen.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Bildungsexpansion, soziale Herkunft, Bildungserfolg, PISA-Studie, Bildungskapital, Meritokratie, Deutschland, Schulsystem, soziale Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Bildungsungleichheit in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Bildungsungleichheit in Deutschland im Kontext der Bildungsexpansion. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen den Bildungsabschlüssen der Eltern und der Kinder, um die Forschungsfrage zu beantworten, inwieweit von einer positiven Entwicklung hinsichtlich der Bildungsungleichheit gesprochen werden kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Bildungsexpansion in Deutschland, die Ursachen der Bildungsungleichheit, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, die Auswirkungen der Bildungsexpansion auf die soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem und die Bewertung der Wirksamkeit von Bildungsreformen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Bezüge, Erlangen der Hochschulreife, Ergebnisse und Fazit. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext und die Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen, Kapitel 3 behandelt den Erwerb der Hochschulreife, Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Welche theoretischen Bezüge werden in der Arbeit verwendet?
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Die Bildungsexpansion wird in drei Phasen unterteilt und deren Ursachen im Kontext von wirtschaftlichen und politischen Faktoren und bildungsinternen Prozessen erläutert. Es werden Theorien zur Bildungsungleichheit vorgestellt und die Hypothese aufgestellt, dass die Bildungsexpansion zu einer reduzierten Abhängigkeit des Bildungserfolgs von Kindern vom Bildungsniveau der Eltern geführt hat.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die bereitgestellte HTML-Vorschau enthält keine detaillierten Informationen zu den angewendeten Methoden. Die Zusammenfassung legt jedoch nahe, dass eine Analyse des Zusammenhangs zwischen den Bildungsabschlüssen von Eltern und Kindern im Mittelpunkt steht. Weitere Details zur Methodik müssten der vollständigen Arbeit entnommen werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, Bildungsexpansion, soziale Herkunft, Bildungserfolg, PISA-Studie, Bildungskapital, Meritokratie, Deutschland, Schulsystem, soziale Gerechtigkeit.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern kann von einer positiven Entwicklung hinsichtlich der Bildungsungleichheit in Deutschland gesprochen werden, wenn man den Zusammenhang zwischen den Bildungsabschlüssen der Eltern und der Kinder analysiert?
Wie wird die Bildungsexpansion in der Arbeit dargestellt?
Die Bildungsexpansion wird in drei Phasen unterteilt und im Kontext wirtschaftlicher und politischer Faktoren sowie bildungsinternen Prozessen erläutert. Die steigende Nachfrage nach höher qualifizierten Arbeitskräften, der Einfluss der USA und Großbritanniens sowie der zunehmende internationale Wettbewerb werden als Triebkräfte genannt.
Welche Rolle spielt die PISA-Studie?
Die PISA-Studie von 2000 wird im Zusammenhang mit dem "PISA-Schock" erwähnt, der den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg deutlich machte und als Ausgangspunkt für die Forschungsfrage dient.
Wo finde ich die vollständigen Ergebnisse?
Die vollständigen Ergebnisse der Untersuchung sind in der nicht hier präsentierten, vollständigen Arbeit enthalten.
- Quote paper
- Mascha Matri (Author), 2014, Entwicklung der Bildungsungleichheit im Hinblick auf die soziale Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318729