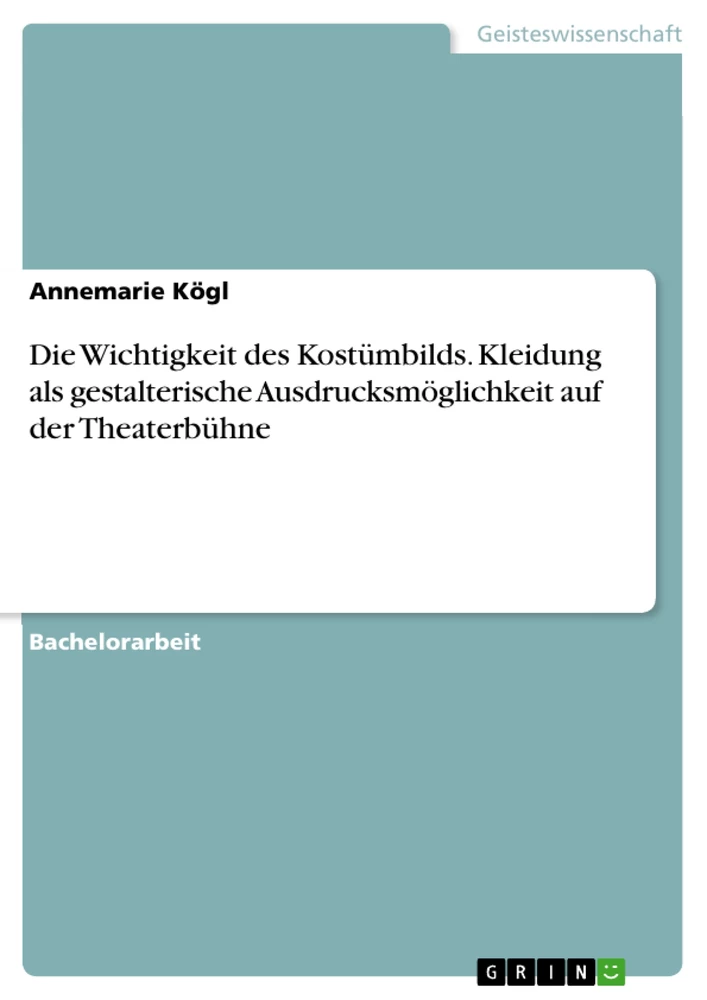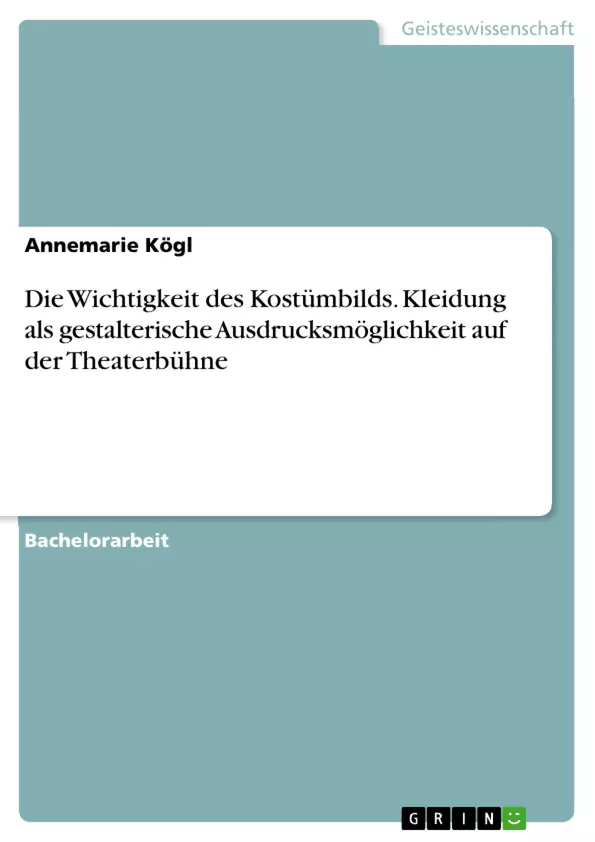Das Kostümbild ist wichtiger Bestandteil einer Inszenierung. Durch die kommunikative Fähigkeit, die die Kleidung im Allgemeinen und Kostüme im Besonderen haben, werden dem Publikum Zeichen vermittelt, die zum Verständnis und Einordung der Inszenierung in historische Kontexte sowie unter anderem die Gefühlslage und den gesellschaftlichen Stand der dargestellten Figuren und deren Beziehung untereinander Aufschluss geben kann. Durch Kenntnisse um Materialeigenschaften, Farb- und Formwirkungen können diese Zeichen sinnstiftend und ästhetisch konstruiert werden damit sie dem Zuschauer als optischen Reiz mit Symbolcharakter dienen.
Im Januar 2015 kamen die beiden aus der griechischen Mythologie stammenden Figuren Elektra und Medea auf der Studiobühne Paderborn zur Aufführung. Seit der Antike werden die tragischen Schicksale der Frauen in verschiedenen Epochen in facettenreicher Form verarbeitet und tauchen so mehrfach in der Kunst, sowie auf der Theaterbühne auf.
Unter dem Motto „Rezeption der Antike“ wollte der Regisseur und Leiter der Studiobühne Dr. Hans Moeller in seiner Interpretation der Stücke von Hugo von Hofmannsthal („Elektra“) und Heiner Müller („Medeamaterial“) jedoch ein „falsches Antikisieren“ vermeiden. Denn die Autoren behandeln zwar den mythologischen Stoff, jedoch setzen sie ihre eigenen Akzente bei den ausschlaggebenden Motiven der Figuren und geben so „auf je unterschiedliche Art die eigentliche Aussage des Stoffes in anderer Form zurück“.
Diese „andere Form“ sollte sich auch in den Kostümen niederschlagen. Bei der Thematik der Antike schnellen einem umgehend Bilder von Menschen in Sandalen, gekleidet mit drapierten Stoffen, den Chitons, welche mit Fibeln teilweise nur an einer Schuler festgemacht werden in den Kopf. Ohne Nähte, nur durch Gürtel werden die Rechtecke in Falten geworfenen, sodass sie den Körper umspielen. Die Schlichtheit der einfarbigen Stoffe ist mit Mäandern, also Bandornamenten an den Tuchrändern verziert. Jedoch sollten genau diese Verbildlichung vermieden werden, um die Aktualität der Stücke nicht zu trüben.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich anhand von Kleidungs- Kostüm- und Gestaltungstheorien aufzeigen, wie anhand des daraus resultierenden Wissens, die Kostümbilder für „Elektra“ und „Medeamaterial“ entstanden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Rahmungen zu Kostümen auf der Theaterbühne
- 2.1. Ursprünge der Kleidung
- 2.2. Kleidung als Kommunikationsmittel
- 2.3. Kostüm als theatrales Zeichen im Theater nach Fischer-Lichte
- 3. Vorstellung der Stücke „Elektra“ und „Medeamaterial“
- 3.1. „Medeamaterial“ von Heiner Müller
- 3.2. „Elektra“ von Hugo von Hofmannsthal
- 4. Funktion und Verhältnis von Gestaltung, Kreativität und Ästhetik für das Kostüm
- 5. Gestalterische Ausdrucksmittel bei „Elektra“ und „Medeamaterial“
- 5.1. Material
- 5.2. Farbe
- 5.3. Form
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Bachelorarbeit „Kostümbild - Kleidung als gestalterische Ausdrucksmöglichkeit auf der Theaterbühne“ analysiert die Gestaltung von Kostümen für zwei Theaterstücke („Elektra“ von Hugo von Hofmannsthal und „Medeamaterial“ von Heiner Müller) und untersucht deren Funktion und Einfluss auf die Inszenierung und die Darstellung der Figuren. Die Arbeit zeigt auf, wie das Kostümbild als ein Mittel der Kommunikation genutzt werden kann, um dem Publikum die Identität, den sozialen Stand und die Emotionen der Figuren zu vermitteln.
- Die Bedeutung von Kostümen als theatrale Zeichen und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Publikums.
- Die Verbindung zwischen Kostümen, Identität und der Inszenierung von Figuren.
- Die Rolle von Gestaltungsmitteln wie Material, Farbe und Form bei der Kreation von Kostümen und deren Wirkung auf das Publikum.
- Die Analyse der Kostümbilder der beiden Stücke „Elektra“ und „Medeamaterial“ im Hinblick auf ihre gestalterischen Komponenten.
- Die Bedeutung von Kreativität und Ästhetik im Prozess der Kostümbildgestaltung.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Motivation und den Hintergrund der Bachelorarbeit vor, die sich mit dem Thema Kostümbild und der Bedeutung von Kleidung als gestalterische Ausdrucksmöglichkeit auf der Theaterbühne auseinandersetzt. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Rahmungen zum Begriff des Bühnenkostüms, betrachtet die Ursprünge der Kleidung und ihre kommunikative Funktion sowie die Bedeutung von Kostümen als theatrale Zeichen nach der Semiotik von Erika Fischer-Lichte. Kapitel 3 gibt eine kurze Vorstellung der Stücke „Elektra“ und „Medeamaterial“ und erläutert das zugrundeliegende Konzept der Dramen sowie die Kostümbilder, die für die jeweilige Inszenierung entworfen wurden.
Kapitel 4 widmet sich der Funktion und dem Verhältnis von Gestaltung, Kreativität und Ästhetik im Kontext des Kostümbildes. Es wird erklärt, wie die Gestaltung eines Kostüms einen kreativen Schaffensprozess darstellt, der mit Material, Farbe und Form arbeitet, um ein bestimmtes Erscheinungsbild zu erzeugen. Kapitel 5 analysiert exemplarisch die Gestaltungskomponenten Material, Farbe und Form anhand der beiden Kostümbilder und untersucht deren Einfluss auf die Darstellung der Figuren und die Wirkung auf das Publikum. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beleuchtet mögliche weitere Forschungsgebiete im Bereich des Kostümbildes.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Bachelorarbeit behandelt die Themen Kostümbild, Theater, Kleidung, Kommunikation, Semiotik, Gestaltung, Material, Farbe, Form, Kreativität, Ästhetik, „Elektra“, Hugo von Hofmannsthal, „Medeamaterial“, Heiner Müller, Inszenierung, Figuren, Rezeption, Wirkung, Zeichensetzung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat das Kostümbild im Theater?
Das Kostümbild dient als visuelles Kommunikationsmittel. Es vermittelt dem Publikum Informationen über den sozialen Stand, die Gefühlslage, die Identität und die Beziehungen der Figuren sowie den historischen Kontext der Inszenierung.
Wie wirken Material, Farbe und Form auf der Bühne?
Diese gestalterischen Mittel erzeugen optische Reize mit Symbolcharakter. Materialien können haptische Qualitäten vermitteln, Farben lösen Emotionen aus und Formen definieren die Silhouette und Präsenz einer Figur im Raum.
Was bedeutet „falsches Antikisieren“ im Kostümdesign?
Damit ist die rein historisierende Darstellung (z. B. klassische Sandalen und Chitons) gemeint. In den untersuchten Stücken „Elektra“ und „Medeamaterial“ wurde dies vermieden, um die zeitlose Aktualität der Stoffe zu betonen.
Welche Rolle spielt die Semiotik nach Fischer-Lichte für Kostüme?
Nach Erika Fischer-Lichte wird das Kostüm als „theatrales Zeichen“ verstanden. Es ist Teil eines komplexen Zeichensystems, das die Wahrnehmung des Zuschauers lenkt und Bedeutung innerhalb der Aufführung generiert.
Welche Stücke dienen als Analysebeispiele in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Kostümbilder für Hugo von Hofmannsthals „Elektra“ und Heiner Müllers „Medeamaterial“, aufgeführt an der Studiobühne Paderborn.
- Quote paper
- Annemarie Kögl (Author), 2016, Die Wichtigkeit des Kostümbilds. Kleidung als gestalterische Ausdrucksmöglichkeit auf der Theaterbühne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318910