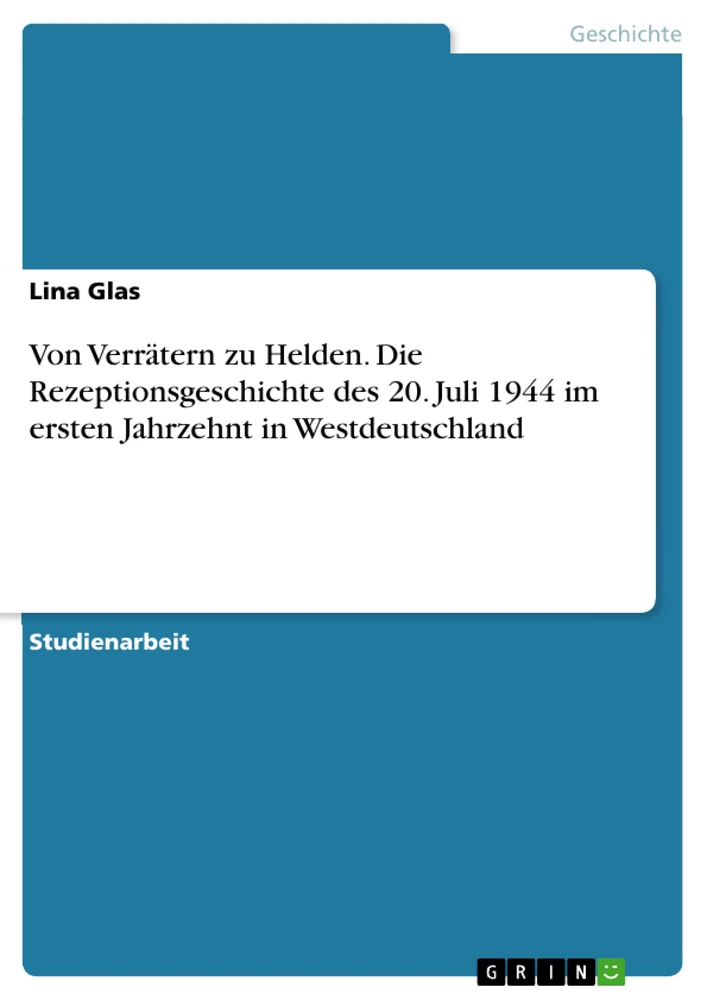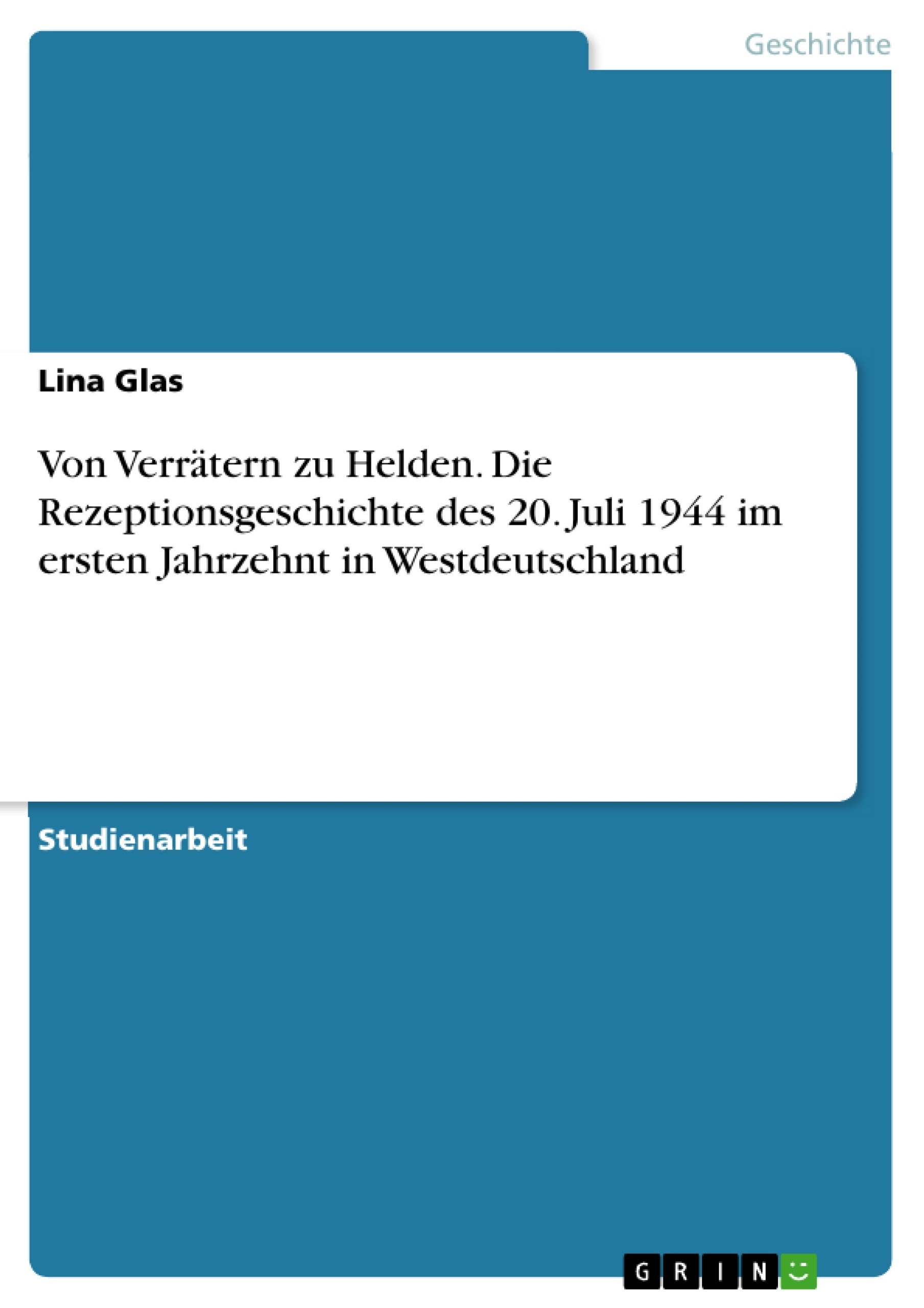In dieser Arbeit wird es um die Frage gehen, wie das deutsche Volk die Männer des 20. Juli im Laufe des ersten Jahrzehntes nach Kriegsende bewertet hat. Dabei wird zu klären sein, wie die NS-Führung die Weichen der Beurteilung stellte, und inwieweit und ob überhaupt diese Propaganda nach dem Kriegsende ihre Wirkung verlor. Auch die Stellung der Alliierten wird eine Rolle spielen.
Eine wichtige Zäsur bilden der Remer-Prozess 1952 und die offiziellen Gedenkreden politischer Persönlichkeiten, die ab dem gleichen Jahr beginnen. Es soll dargestellt werden, inwieweit das Urteil des Prozesses die Meinung der Bevölkerung veränderte und was durch die Reden versucht wurde zu vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1944-1949
- Reaktion der Alliierten
- Reaktion in Deutschland
- NS-Propaganda unmittelbar nach dem Attentat
- Erinnerung an den 20. Juli nach Kriegsende
- 1950-1954
- Der Remer-Prozess
- Umfragen zum 20. Juli
- Erste öffentliche Gedenkreden und –feiern ab 1952
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeptionsgeschichte des 20. Juli 1944 im ersten Jahrzehnt in Westdeutschland und untersucht, wie das deutsche Volk die Männer des 20. Juli bewertet hat.
- Die Reaktion der NS-Führung auf das Attentat und die Auswirkungen ihrer Propaganda auf die öffentliche Meinung.
- Die Rolle der Alliierten in der Beurteilung des 20. Juli und die Bedeutung der Zensur.
- Die Auswirkungen des Remer-Prozesses von 1952 auf die öffentliche Meinung.
- Die Entwicklung der öffentlichen Meinung zum 20. Juli, basierend auf Umfragen des Allensbacher Instituts.
- Die Bedeutung öffentlicher Gedenkreden und -feiern ab 1952 für die Rehabilitierung der Widerstandskämpfer.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler als eine der wichtigsten Widerstandsaktionen gegen das NS-Regime ein. Sie stellt die Motive der Attentäter und die schwierige Situation des Widerstands in den Vordergrund. Anschließend wird die Frage nach der Bewertung des 20. Juli im deutschen Volk nach dem Kriegsende aufgeworfen, die im Fokus dieser Arbeit steht.
- 1944-1949: Dieses Kapitel untersucht die Reaktion der Alliierten und Deutschlands auf das Attentat. Die Alliierten sahen das Attentat zunächst als Risiko für ihre Kriegsführung und stellten teilweise sogar die Glaubwürdigkeit des Attentats in Frage. In Deutschland hingegen wurde der 20. Juli von der NS-Propaganda als Verrat am deutschen Volk dargestellt, wobei die Widerstandskämpfer als ehrgeizige, verbrecherische und dumme Offiziere bezeichnet wurden. Die NS-Führung instrumentalisierte das Attentat für Propaganda und versuchte, ein negatives Bild der Widerstandskämpfer zu zeichnen. Nach dem Krieg war es für die deutsche Bevölkerung schwierig, sich mit dem Widerstand auseinanderzusetzen, da sie mit der Bewältigung der Nachkriegszeit beschäftigt war und sich nicht in eine weitere Debatte über das NS-Regime verwickeln wollte. Trotz anfänglicher Verdrängung gab es erste Versuche, die Erinnerung an den Widerstand zu bewahren, beispielsweise durch autobiografische Publikationen und die Forschungsgesellschaft „Anderes Deutschland“.
- 1950-1954: Dieses Kapitel widmet sich dem Remer-Prozess von 1952, einem wichtigen Wendepunkt in der Rezeption des 20. Juli. Remer, ein ehemaliger NS-Funktionär, verunglimpfte in einer Rede die Widerstandskämpfer und behauptete, dass diese bald vor einem deutschen Gericht für ihren Verrat zur Rechenschaft gezogen werden würden. Der Prozess wurde von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer als Gelegenheit gesehen, die Geschichte und Problematik des 20. Juli zu klären und die Widerstandskämpfer zu rehabilitieren. Durch die Anfertigung moralthologischer Gutachten der Kirchen und durch ein militärisches Gutachten wurde der Widerstand als legitim und teilweise sogar als Pflicht angesehen. Das Gericht stellte im Urteil fest, dass die Männer des 20. Juli keinen Landesverrat begangen hatten und von keinem ausländischen Staat bezahlt wurden. Nach dem Prozess wurde der Widerstand im deutschen Volk zunehmend positiv bewertet. Dies wird durch Umfragen des Allensbacher Instituts belegt, die zeigen, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Widerstand nicht mehr als Verrat am Vaterland ansah. Ab 1952 wurden in Deutschland öffentliche Gedenkreden und -feiern veranstaltet, die die sittlichen, religiösen und patriotischen Motive der Widerstandskämpfer und die Bedeutung des Attentats für den Neubeginn der Bundesrepublik hervorhoben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind der 20. Juli 1944, Widerstand gegen den Nationalsozialismus, Rezeptionsgeschichte, NS-Propaganda, Remer-Prozess, öffentliche Meinung, Gedenkreden und -feiern, Allensbacher Institut für Demoskopie, Volksgemeinschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie bewertete das deutsche Volk den Widerstand vom 20. Juli nach 1945?
Unmittelbar nach dem Krieg wirkte die NS-Propaganda nach, die die Attentäter als Verräter darstellte; erst im Laufe des ersten Jahrzehnts wandelte sich das Bild hin zu Helden.
Was war die Bedeutung des Remer-Prozesses 1952?
Der Prozess stellte gerichtlich fest, dass die Männer des 20. Juli keinen Landesverrat begangen hatten, was maßgeblich zu ihrer Rehabilitierung in der Bevölkerung beitrug.
Welche Rolle spielte Fritz Bauer in der Rezeptionsgeschichte?
Als Generalstaatsanwalt nutzte er den Remer-Prozess, um den Widerstand als legitim und moralisch geboten darzustellen.
Wie reagierten die Alliierten auf das Attentat?
Die Alliierten sahen das Attentat teils skeptisch als Risiko für ihre Kriegsführung oder bezweifelten dessen Ernsthaftigkeit.
Wann begannen die offiziellen Gedenkfeiern in Westdeutschland?
Ab 1952 begannen politische Persönlichkeiten mit Gedenkreden, die die patriotischen und sittlichen Motive der Widerstandskämpfer hervorhoben.
- Citation du texte
- Lina Glas (Auteur), 2015, Von Verrätern zu Helden. Die Rezeptionsgeschichte des 20. Juli 1944 im ersten Jahrzehnt in Westdeutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/318947