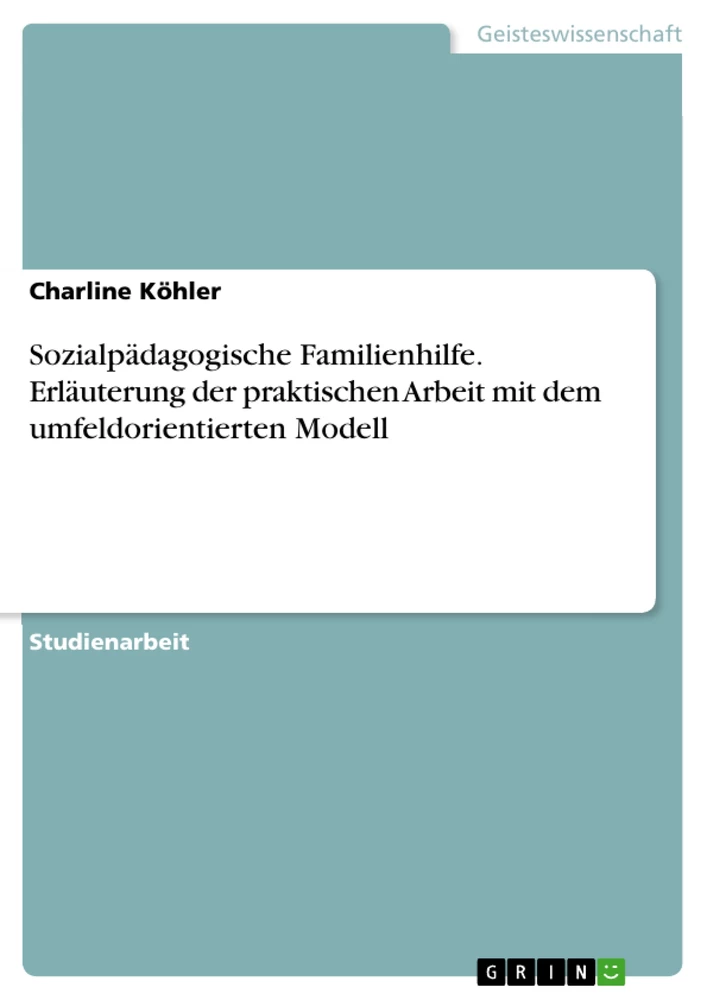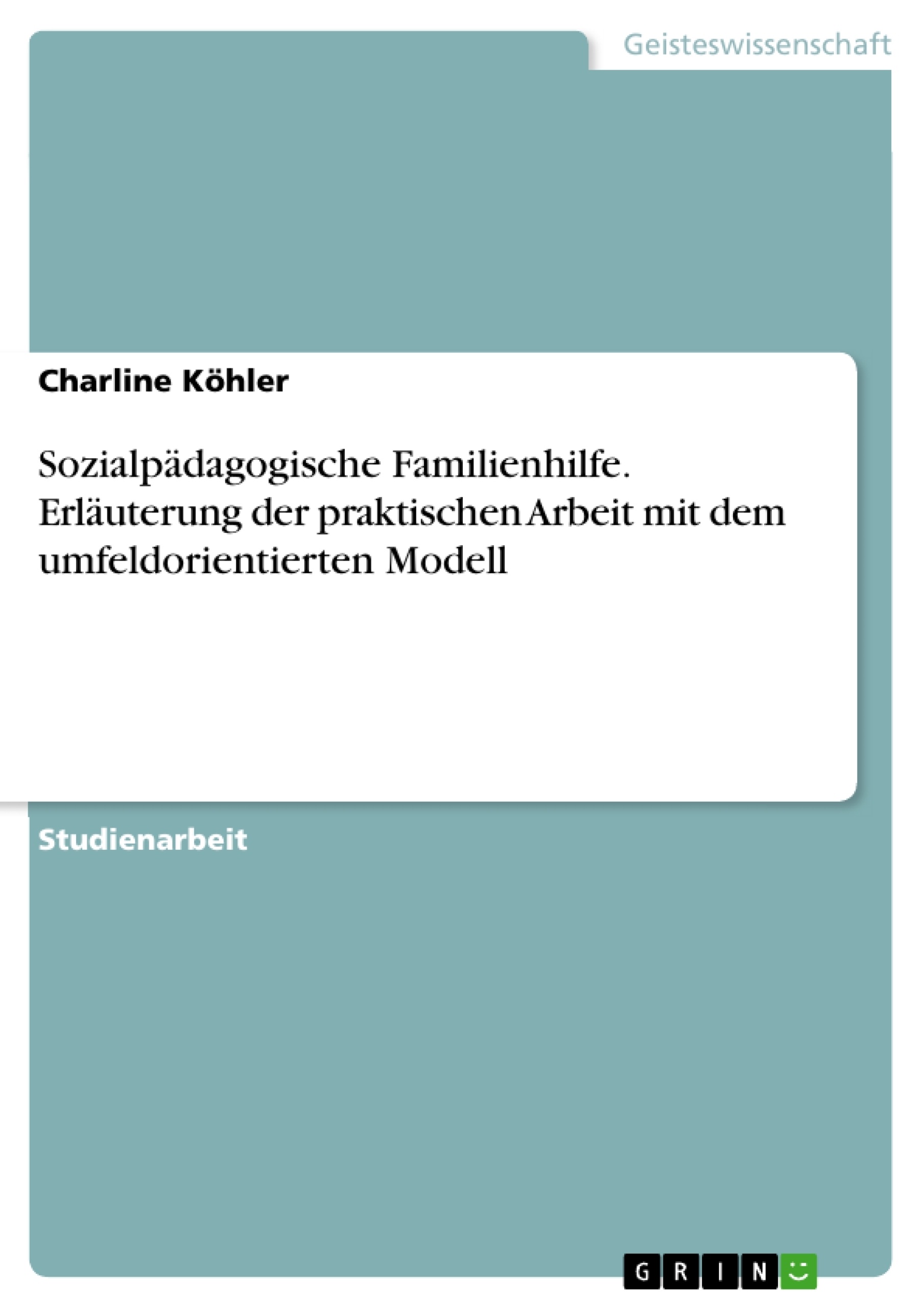Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit der sozialpädagogischen Familienhilfe im Allgemeinen. Dabei möchte ich die rechtlichen Grundlagen klären, auf die sich diese Hilfe bezieht.
Desweiteren soll eine grobe Aufklärung darüber stattfinden, wie eine Familie zu einem Familienhelfer kommt und inwieweit es eine Rolle spielt, ob der Familienhelfer vom Jugendamt oder von den freien Trägern gestellt wird.
Danach werde ich auf die Spezifisierung innerhalb meines Themas eingehen, nämlich das umfeldorientierte Modell. Es soll eine kurze Vorstellung erfolgen sowie eine Beschreibung der Technik des Soziotops.
Das sogenannte Soziotop soll den Kern dieser Arbeit bilden und erklärt sich über ein selbstgewähltes Beispiel einer Familie, die ich innerhalb meiner letzten Praxisphase betreut habe.
Abschließen werde ich mit meinem Fazit. Dies soll sich thematisch mit der Frage befassen, inwiefern das umfeldorientierte Modell, insbesondere das Soziotop, hilfreich für die sozialpädagogische Familiehilfe ist.
Die Sozialpädagogische Familienhilfe stellt einen wichtigen Bereich der Jugendhilfe dar. Im Rahmen eines dualen Studiums konnte ich in meiner letzten Praxisphase für zwei Monate die Tätigkeit einer Familienhelferin ausüben, welche ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld darstellt.
Während dieser Zeit überlegte ich oftmals, mithilfe welcher Techniken ich die zu betreuenden Familien unterstützen und ihnen damit 'Hilfe zur Selbsthilfe' geben kann. Nach einigen Recherchen stieß ich auf einige interessante Modelle und Techniken, die in der sozialpädagogischen Familienhilfe angewandt werden. Bekannte Beispiele wie das Genogramm, die VIP-Karte oder auch der Selbstbericht führten mich zu dem umfeldorientierten Modell. Dies überraschte mich mit seiner Ganzheitlichkeit und das Zusammenfassen aller Bereiche, die für die Familien wichtig sind. Es umfasst das gesamte Spektrum, um nicht nur dem Familienhelfer einen Überblick zu geben, sondern auch den Familien selbst aufzuzeigen, wo ihre Schwächen liegen, in welchen Versorgungsgruppen ein Mangel herrscht usw. Jedoch steht dabei auch im Zentrum, dass die Familien ihre Ressourcen erkennen und merken, was gut läuft und woran sie arbeiten können. Die Familienhilfe soll deshalb nicht vordergründig Fehler aufdecken, sondern gemeinsam mit den Familien erkennen in welchen Bereichen ihre Stärken liegen und vor allem wie sie dem Erziehungsauftrag nachkommen können.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist die Sozialpädagogische Familienhilfe?
- Rechtliche Grundlage und Adressaten
- Auswahl der Familienhelfer und Familien
- Aufgaben des Familienhelfers
- Das umfeldorientierte Modell
- Das Soziotop
- Die Soziotopanalyse von Familie L.
- Regionale Faktoren
- Sozio-Ökonomisches Milieu
- Familiendynamik
- Das Kindsystem
- Auswertung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe und untersucht das umfeldorientierte Modell anhand eines Fallbeispiels. Die Arbeit zielt darauf ab, die rechtlichen Grundlagen und Adressaten der Familienhilfe zu klären, die Auswahl von Familienhelfern und Familien zu beleuchten, die Aufgaben des Familienhelfers zu beschreiben und das umfeldorientierte Modell, insbesondere das Soziotop, vorzustellen.
- Rechtliche Grundlagen und Adressaten der Sozialpädagogischen Familienhilfe
- Auswahl von Familienhelfern und Familien
- Aufgaben des Familienhelfers
- Das umfeldorientierte Modell und seine Anwendung
- Die Analyse des Soziotops anhand eines Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sozialpädagogischen Familienhilfe ein und beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem umfeldorientierten Modell zu befassen. Kapitel 2 erläutert die rechtlichen Grundlagen und Adressaten der Familienhilfe sowie die Auswahl von Familienhelfern und Familien.
Kapitel 3 stellt das umfeldorientierte Modell vor, insbesondere das Soziotop, und analysiert dieses anhand eines Fallbeispiels. Das Kapitel untersucht die regionalen Faktoren, das sozio-ökonomische Milieu, die Familiendynamik und das Kindsystem der Familie L. und zieht eine abschließende Auswertung.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Familienhilfe, umfeldorientiertes Modell, Soziotop, Soziotopanalyse, Fallbeispiel, Familie L., rechtliche Grundlagen, Adressaten, Familienhelfer, Aufgaben, Ressourcen, Stärken, Schwächen, Erziehungsauftrag, Hilfesysteme, soziales Umfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)?
SPFH ist eine intensive Form der Jugendhilfe, die Familien in ihrem Alltag unterstützt, um "Hilfe zur Selbsthilfe" bei Erziehungsproblemen und Krisen zu leisten.
Was versteht man unter dem umfeldorientierten Modell?
Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der nicht nur die Familie intern betrachtet, sondern alle externen Faktoren und Hilfesysteme des sozialen Umfelds einbezieht.
Was ist ein "Soziotop" in der Familienhilfe?
Das Soziotop ist eine Technik zur Analyse des gesamten Lebensraums einer Familie, inklusive regionaler Faktoren, ökonomischem Milieu und Familiendynamik.
Was ist das Ziel einer Soziotopanalyse?
Ziel ist es, Ressourcen und Stärken der Familie sichtbar zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen, in welchen Bereichen (z.B. Versorgungsgruppen) Mangel herrscht.
Wer stellt die Familienhelfer zur Verfügung?
Familienhelfer können entweder direkt vom Jugendamt oder von freien Trägern der Jugendhilfe gestellt werden.
- Quote paper
- Charline Köhler (Author), 2016, Sozialpädagogische Familienhilfe. Erläuterung der praktischen Arbeit mit dem umfeldorientierten Modell, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319044