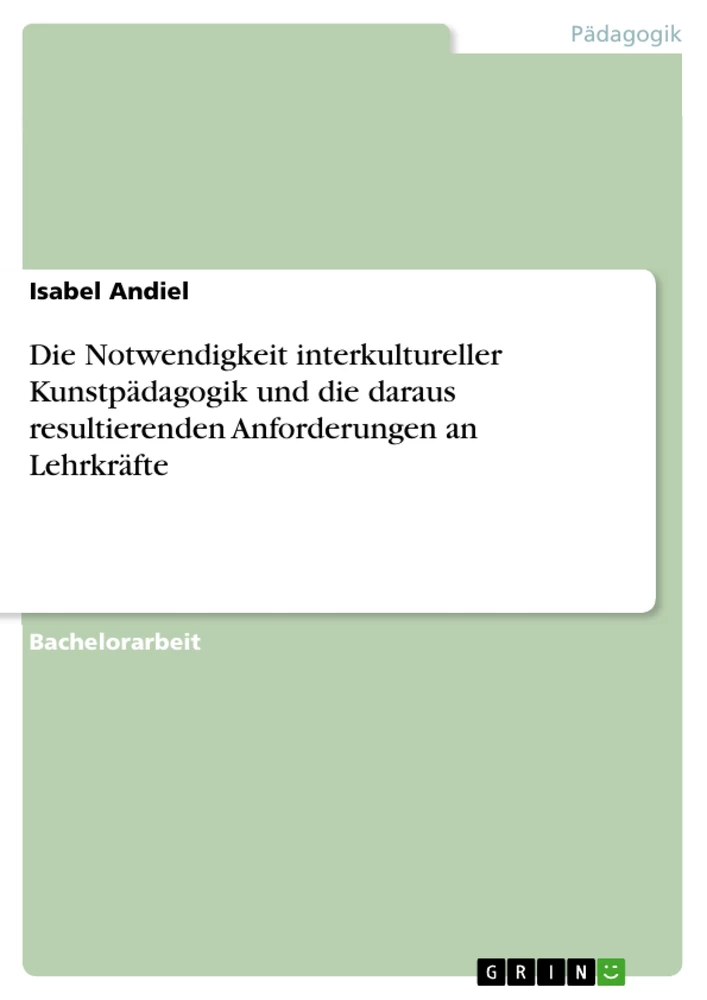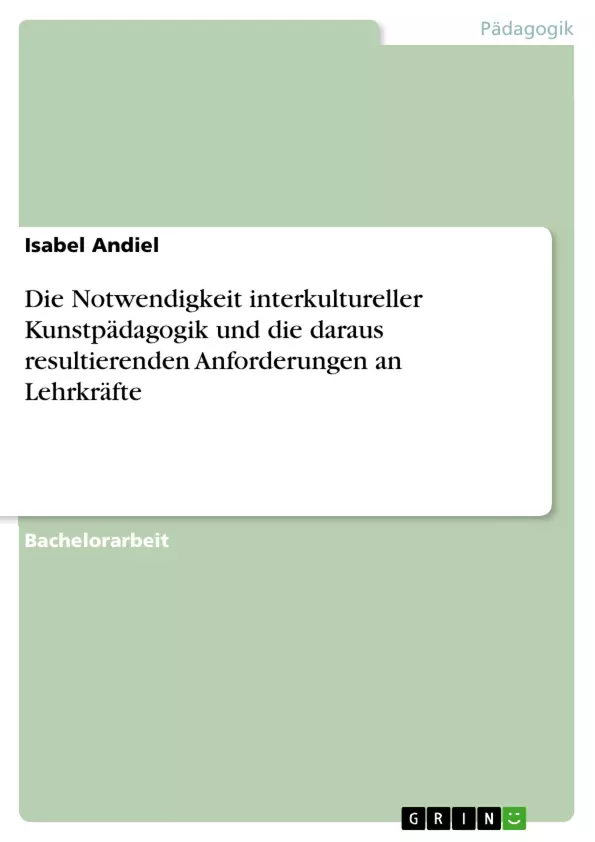Die Gegenwart ist gekennzeichnet von Beschleunigung, internationalen Verflechtungen und einer wachsenden Intensivierung globaler Beziehungen. Die daraus resultierenden Veränderungen und zahlreichen Umstrukturierungen in gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und ökonomischen Bereichen verändern das Gesicht der Gesellschaft. Personen verschiedenster historisch und kulturell geprägter Menschenbilder stoßen aufeinander, die plötzlich mit der Variabilität menschlicher Existenz konfrontiert werden und sich selbst neu verorten müssen.
Bildung hält eine Schlüsselrolle für eine zukunftsfähige Gesellschaft inne, doch wird nun die Globalisierung zu einer der Herausforderungen. Vorherrschende Bildungskonzepte verlieren an Tragfähigkeit und das Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit kultureller Vielfalt und unterschiedlichen Wertehaltungen rückt in den Vordergrund. Der Ansatz der interkulturellen Pädagogik gilt als wichtige Fachrichtung in den Erziehungswissenschaften, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Kinder und Jugendliche bedürfen interkultureller Lernprozesse und dementsprechender Bildungsangebote, um zu offenen Weltbürgern erzogen zu werden.
Die Schule kann trotz schwieriger Rahmenbedingungen dazu beitragen das interkulturelle Verständnis zu verbessern. Eine Möglichkeit stellt die kulturelle Bildung verstanden als „Lern- und Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Umwelt und der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringungen“, dar. Die kulturelle Bildung besitzt großes Potenzial viele jener Bruchstellen zusammenzufügen und aufzuarbeiten, die entlang des Aufpralls der unterschiedlichen in der Schule nebeneinander existierenden Lebenswelten, entstanden sind.
An dieser Stelle ist insbesondere die Kunstpädagogik dazu aufgefordert, sich mit gesellschaftlicher Diversität auseinanderzusetzen und auf neue gesellschaftliche Prozesse zu reagieren. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde in Gesprächen mit Kunstpädagogen jedoch deutlich, dass die Fachdisziplin nur wenig auf die Globalisierungsphänomene und die damit einhergehenden Folgen vorbereitet ist. Das Gefühl tiefer Ratlosigkeit und Verunsicherung wurde benannt, da alt vertraute Konzepte nicht mehr funktionieren und kaum eine fundierte wissenschaftlich als auch praxisorientierte Auseinandersetzung stattgefunden hat, die Lösungsansätze präsentieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Forschungsstand
- Fragestellung und Zielperspektiven
- Begriffserklärung
- Kultur
- Interkulturelle Pädagogik
- Interkulturelle Kompetenz
- Interkulturelle Kunstpädagogik
- Handlungstheoretischer Bezugsrahmen: interkulturelle Pädagogik
- Globalisierung und Lokalisierung
- Postkoloniale Perspektive
- Die Notwendigkeit interkulturellen Lernens
- Neue Anforderungen an das Schulsystem
- Interkulturelle Kunstpädagogik
- Internationale Ausrichtung der Kunstpädagogik
- Das Konzept der Interkulturellen Kunstpädagogik
- Bildwelten in der interkulturellen Kunstpädagogik
- Nürnberger-Paper
- Reaktionen auf das Nürnberger-Paper
- Interkulturalität im Lehrerberuf
- Interkulturelle Erziehung in der Lehrerausbildung
- Kompetenzen interkultureller Kunstpädagogen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit interkultureller Kunstpädagogik und die daraus resultierenden Anforderungen an Lehrkräfte. Das Hauptziel ist aufzuzeigen, wie die Globalisierung und zunehmende gesellschaftliche Diversität die Kunstpädagogik verändern und welche neuen Kompetenzen von Lehrpersonen benötigt werden.
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf das Bildungssystem
- Das Konzept und die Umsetzung interkultureller Kunstpädagogik
- Die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Kunstpädagogen
- Herausforderungen und Lösungsansätze für die interkulturelle Kunstpädagogik
- Die Rolle der kulturellen Bildung im Kontext von Globalisierung und Diversität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass die Kunstpädagogik nur unzureichend auf die Herausforderungen der Globalisierung und der damit verbundenen kulturellen Vielfalt vorbereitet ist. Es wird der Forschungsstand skizziert und die Fragestellung der Arbeit formuliert: Wie kann die Kunstpädagogik interkulturell ausgerichtet werden und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Lehrkräfte? Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Notwendigkeit einer interkulturellen Ausrichtung der Kunstpädagogik aufzuzeigen und die daraus resultierenden Anforderungen an Lehrpersonen zu definieren.
Begriffserklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit: Kultur (im engen und erweiterten Sinne), interkulturelle Pädagogik und interkulturelle Kompetenz. Es wird herausgestellt, dass der Begriff „Kultur“ vielschichtig ist und im pädagogischen Kontext ein erweiterter Kulturbegriff verwendet wird, der Lebenswelten und deren Interaktionen umfasst. Interkulturelle Pädagogik wird als wichtiger Ansatz zur Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dargestellt, wobei interkulturelle Kompetenz als notwendige Fähigkeit für den Umgang mit kultureller Vielfalt definiert wird. Der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und der Interkulturellen Kunstpädagogik wird hergestellt.
Handlungstheoretischer Bezugsrahmen: interkulturelle Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der interkulturellen Pädagogik. Es setzt sich mit den Auswirkungen der Globalisierung und Lokalisierung auseinander und beleuchtet die postkoloniale Perspektive. Die Notwendigkeit interkulturellen Lernens wird begründet, und es wird gezeigt, wie die Globalisierung neue Anforderungen an das Schulsystem stellt. Der Abschnitt veranschaulicht den dringenden Bedarf an interkulturellen Lernprozessen für die Heranwachsenden in einer globalisierten Welt und die Rolle des Bildungssystems bei der Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Diskussion um Globalisierung und Lokalisierung verdeutlicht die komplexen Wechselwirkungen zwischen globalen Prozessen und lokalen Kontexten im Bildungsbereich.
Interkulturelle Kunstpädagogik: Dieses Kapitel behandelt die zentrale Thematik der interkulturellen Kunstpädagogik. Es untersucht die internationale Ausrichtung der Kunstpädagogik und präsentiert das Konzept der interkulturellen Kunstpädagogik, einschließlich der Bedeutung von Bildwelten in diesem Kontext. Das Nürnberger Paper und die darauf folgenden Reaktionen werden beleuchtet und wichtige Beiträge zur Diskussion um die interkulturelle Kunstpädagogik werden präsentiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung eines praxisrelevanten Konzeptes der Interkulturellen Kunstpädagogik.
Interkulturalität im Lehrerberuf: Dieser Abschnitt widmet sich den spezifischen Anforderungen an Lehrpersonen im Kontext der interkulturellen Kunstpädagogik. Es werden die Aspekte interkultureller Erziehung in der Lehrerausbildung und die notwendigen Kompetenzen interkultureller Kunstpädagogen erörtert. Es wird auf die Notwendigkeit einer spezifischen Lehrerausbildung hingewiesen, die die Lehrkräfte auf die Herausforderungen des interkulturellen Unterrichts vorbereitet. Die Kapitel analysieren die Kompetenzen, die zukünftige Lehrkräfte benötigen, um interkulturelle Kunstpädagogik effektiv umzusetzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Interkulturelle Kunstpädagogik
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit interkultureller Kunstpädagogik und die daraus resultierenden Anforderungen an Lehrkräfte. Sie beleuchtet die Auswirkungen der Globalisierung und der zunehmenden gesellschaftlichen Diversität auf die Kunstpädagogik und analysiert die notwendigen Kompetenzen von Lehrpersonen in diesem Kontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Auswirkungen der Globalisierung auf das Bildungssystem, das Konzept und die Umsetzung interkultureller Kunstpädagogik, die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Kunstpädagogen, Herausforderungen und Lösungsansätze für die interkulturelle Kunstpädagogik sowie die Rolle der kulturellen Bildung im Kontext von Globalisierung und Diversität. Sie umfasst eine Begriffserklärung zu zentralen Begriffen wie Kultur, interkulturelle Pädagogik und interkulturelle Kompetenz und analysiert den Handlungsrahmen der interkulturellen Pädagogik, inklusive der postkolonialen Perspektive.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Forschungsstand, Fragestellung und Zielsetzung), Begriffserklärung (Kultur, interkulturelle Pädagogik, interkulturelle Kompetenz, interkulturelle Kunstpädagogik), Handlungstheoretischer Bezugsrahmen: interkulturelle Pädagogik (Globalisierung, Lokalisierung, Postkoloniale Perspektive, Notwendigkeit interkulturellen Lernens, neue Anforderungen an das Schulsystem), Interkulturelle Kunstpädagogik (internationale Ausrichtung, Konzept der Interkulturellen Kunstpädagogik, Bildwelten, Nürnberger Paper und Reaktionen darauf), Interkulturalität im Lehrerberuf (interkulturelle Erziehung in der Lehrerausbildung, Kompetenzen interkultureller Kunstpädagogen) und Fazit.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist aufzuzeigen, wie die Globalisierung und zunehmende gesellschaftliche Diversität die Kunstpädagogik verändern und welche neuen Kompetenzen von Lehrpersonen benötigt werden. Die Arbeit möchte die Notwendigkeit einer interkulturellen Ausrichtung der Kunstpädagogik belegen und die daraus resultierenden Anforderungen an Lehrkräfte definieren.
Welche konkreten Fragestellungen werden bearbeitet?
Die zentrale Fragestellung lautet: Wie kann die Kunstpädagogik interkulturell ausgerichtet werden und welche Anforderungen ergeben sich daraus für Lehrkräfte? Die Arbeit untersucht dazu die Auswirkungen der Globalisierung auf das Bildungssystem und analysiert das Konzept und die praktische Umsetzung interkultureller Kunstpädagogik. Sie beleuchtet die Rolle des Nürnberger Papers und der darauf folgenden Reaktionen in der Diskussion um interkulturelle Kunstpädagogik.
Welche Bedeutung hat das Nürnberger Paper in der Arbeit?
Das Nürnberger Paper und die darauf folgenden Reaktionen werden im Kapitel zur Interkulturellen Kunstpädagogik beleuchtet. Es stellt einen wichtigen Beitrag zur Diskussion um die interkulturelle Kunstpädagogik dar und wird im Kontext der Entwicklung und Umsetzung eines praxisrelevanten Konzeptes analysiert.
Welche Kompetenzen benötigen interkulturelle Kunstpädagogen laut dieser Arbeit?
Die Arbeit erörtert die notwendigen Kompetenzen interkultureller Kunstpädagogen im Kapitel „Interkulturalität im Lehrerberuf“. Es wird auf die Notwendigkeit einer spezifischen Lehrerausbildung hingewiesen, die Lehrkräfte auf die Herausforderungen des interkulturellen Unterrichts vorbereitet. Die konkreten Kompetenzen werden im Detail in der Arbeit beschrieben.
Welche Rolle spielt die Globalisierung in der Arbeit?
Die Globalisierung spielt eine zentrale Rolle als Ausgangspunkt der Problemstellung. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf das Bildungssystem und die Notwendigkeit interkulturellen Lernens als Reaktion auf die zunehmende kulturelle Vielfalt und die damit verbundenen Herausforderungen für die Kunstpädagogik.
- Citation du texte
- Isabel Andiel (Auteur), 2015, Die Notwendigkeit interkultureller Kunstpädagogik und die daraus resultierenden Anforderungen an Lehrkräfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319172