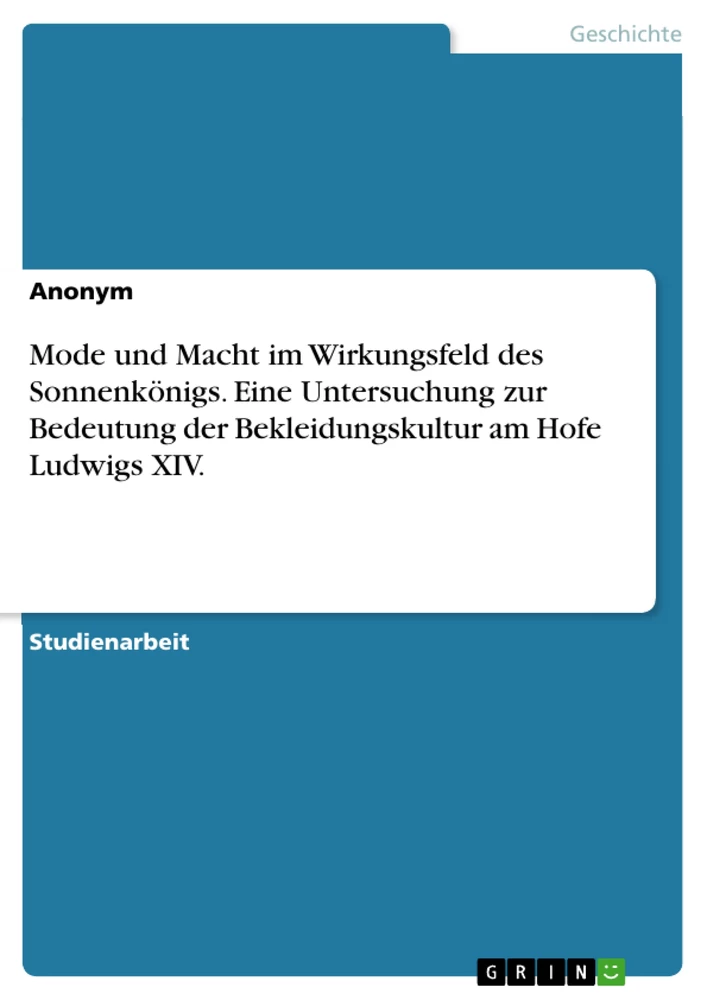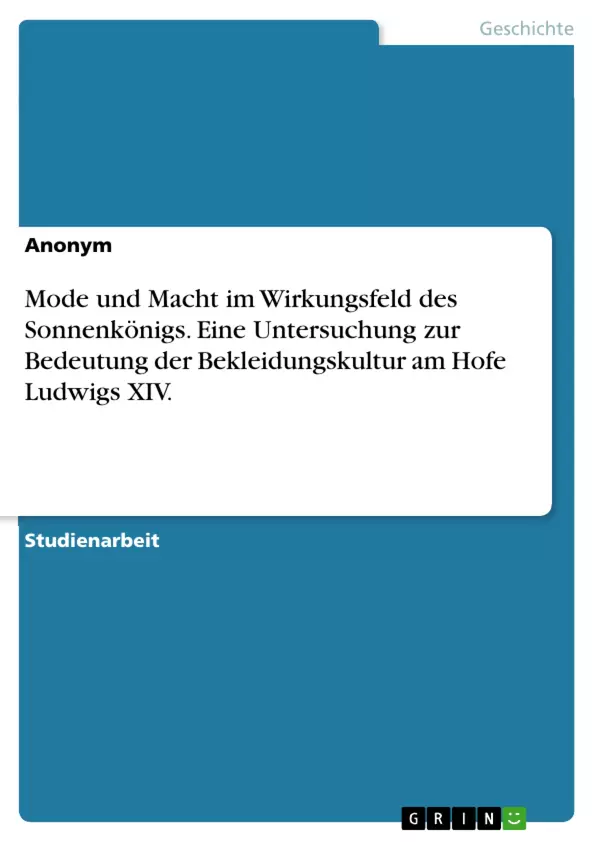Kaum ein anderer Monarch verstand es sich mit Hilfe eines allumfassenden Kommunikationssystems in den Mittelpunkt des höfischen Lebens zu rücken und seine Macht auf eine Weise zu demonstrieren, wie es Ludwig XIV. tat. Unzählige Portraits, Statuen, Standbilder und Medaillen sind Schwerpunkt unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen. Auf berühmten Portraits zeigt sich der Souverän in den kostbarsten Gewändern und in überdimensional anmutender Stofffülle, sodass der König selbst hinter den Mengen an Samt, Seide, Spitze und Fell zu verschwinden scheint.
Daraus entstand die Intention sich im Rahmen der vorliegenden Seminararbeit dieser Thematik fokussiert zu nähern und dabei das Verhältnis von Kleidung, Inszenierung und Machtausübung am Hofe Ludwig XIV. zu untersuchen. Diesbezüglich soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung der Kleidung hinsichtlich der bewussten Inszenierung Ludwigs XIV. zugesprochen werden muss und wie fern sie die Macht des absolutistischen Monarchen widerspiegelt, stabilisiert oder gar verstärkt. Meine These lautet diesbezüglich, dass Kleidung ein Machtinstrument – man könnte sagen ein gewissermaßen vestimentäres Machtinstrument Ludwigs XIV. war, mit dessen Hilfe er Luxus und seine Person inszenierte und dadurch Autorität, Distinktion und Herrschaftsgewalt ausübte.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Kleidung und Mode als Forschungsgegenstand – terminologische Konkretisierung
- 3 Die Intentionebenen der Bekleidungskultur in Frankreich zu Zeiten Ludwigs XIV.
- 3.1 Mode als Kommunikations- und Distinktionsmittel.
- 3.2 Mode als Darstellungs- und Verhaltenstechnik in Hinblick auf die Inszenierung des Königs
- 4 Die Bedeutung der Mode - Frankreich als „Modehaus“ Europas in der frühen Neuzeit.
- 4.1 Zur ökonomischen und politischen Bedeutung...
- 4.2 Seide und Spitze - Motor der textilen Wirtschaft in Frankreich
- 5 Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Ziel dieser Seminararbeit ist es, das Verhältnis von Kleidung, Inszenierung und Machtausübung am Hofe Ludwig XIV. zu untersuchen. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung der Kleidung hinsichtlich der bewussten Inszenierung Ludwigs XIV. zugesprochen werden muss und wie fern sie die Macht des absolutistischen Monarchen widerspiegelt, stabilisiert oder gar verstärkt.
- Die Bedeutung der Kleidung als Machtinstrument im Absolutismus
- Die Rolle der Kleidung in der Inszenierung des Sonnenkönigs
- Die Inszenierung von Luxus und Macht durch Kleidung
- Die ökonomische und politische Bedeutung von Mode in Frankreich
- Die Darstellung von Macht durch Kleidung und die damit verbundene Distinktion
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Kleidung und Mode als Forschungsgegenstand - terminologische Konkretisierung
- Kapitel 3: Die Intentionebenen der Bekleidungskultur in Frankreich zu Zeiten Ludwigs XIV.
- Kapitel 4: Die Bedeutung der Mode - Frankreich als „Modehaus“ Europas in der frühen Neuzeit.
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und erläutert die Forschungsfrage: Welche Bedeutung hat Kleidung hinsichtlich der Inszenierung von Macht am Hofe Ludwig XIV.?
In diesem Kapitel wird der Begriff "Mode" aus kulturgeschichtlicher Perspektive beleuchtet und seine Bedeutung im 17. Jahrhundert in Frankreich erläutert. Die Kleidung als materieller Gegenstand wird als ein stark bedeutungsgeladenes Objekt betrachtet, das Einblicke in kulturelle und gesellschaftliche Prozesse bietet.
Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Intentionebenen der Bekleidungskultur in Frankreich zur Zeit Ludwig XIV. Die Mode dient als Kommunikations- und Distinktionsmittel und gleichzeitig als Darstellungs- und Verhaltenstechnik in Hinblick auf die Inszenierung des Königs.
In diesem Kapitel wird die politische und ökonomische Bedeutung der Mode für Frankreich im 17. Jahrhundert beleuchtet. Die französische Seide und Spitze spielten eine wichtige Rolle als Motor der textilen Wirtschaft und stellten Frankreich zu dieser Zeit zum "Modehaus" Europas.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Mode, Kleidung, Macht, Inszenierung, Absolutismus, Ludwig XIV., Frankreich, 17. Jahrhundert, Distinktion, Luxus, ökonomische und politische Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Warum war Mode für Ludwig XIV. ein Machtinstrument?
Ludwig XIV. nutzte prachtvolle Kleidung, um seine göttliche Erhabenheit zu inszenieren, Distanz zum Adel zu schaffen und seinen Reichtum als Souverän zu demonstrieren.
Was bedeutete "Distinktion" am Hofe von Versailles?
Distinktion beschreibt die Abgrenzung durch Kleidung. Nur wer bestimmte Moden trug, zeigte seine Nähe zum König und seinen sozialen Rang innerhalb der höfischen Hierarchie.
Welche ökonomische Bedeutung hatte die französische Mode?
Unter Ludwig XIV. wurde Frankreich zum Zentrum der Textilindustrie (Seide, Spitze). Die Mode förderte den Export und stärkte die französische Wirtschaft massiv.
Wie wurde der König in Porträts inszeniert?
Porträts zeigten ihn oft in überdimensionalen Stoffmengen aus Samt und Seide, was seine physische Präsenz und seine Macht im absolutistischen Staat unterstrich.
Was war der "Sonnenkönig"-Mythos im Kontext der Kleidung?
Kleidung war Teil eines allumfassenden Kommunikationssystems, das Ludwig XIV. als Zentrum des Universums (die Sonne) stilisierte, um den ergebene Adel kreiste.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Mode und Macht im Wirkungsfeld des Sonnenkönigs. Eine Untersuchung zur Bedeutung der Bekleidungskultur am Hofe Ludwigs XIV., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319274