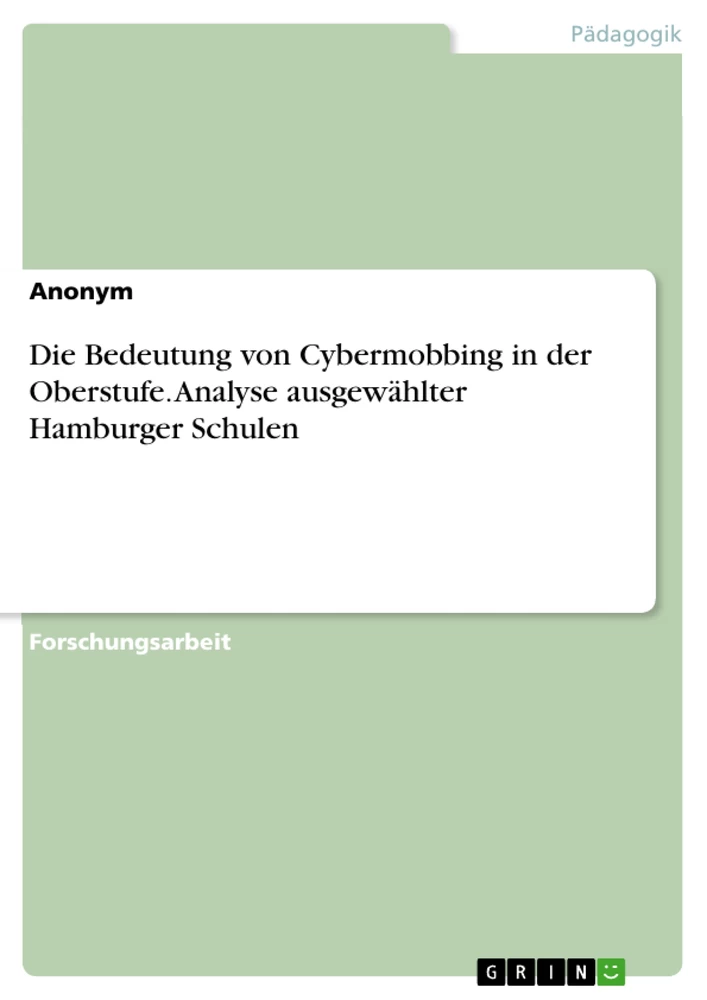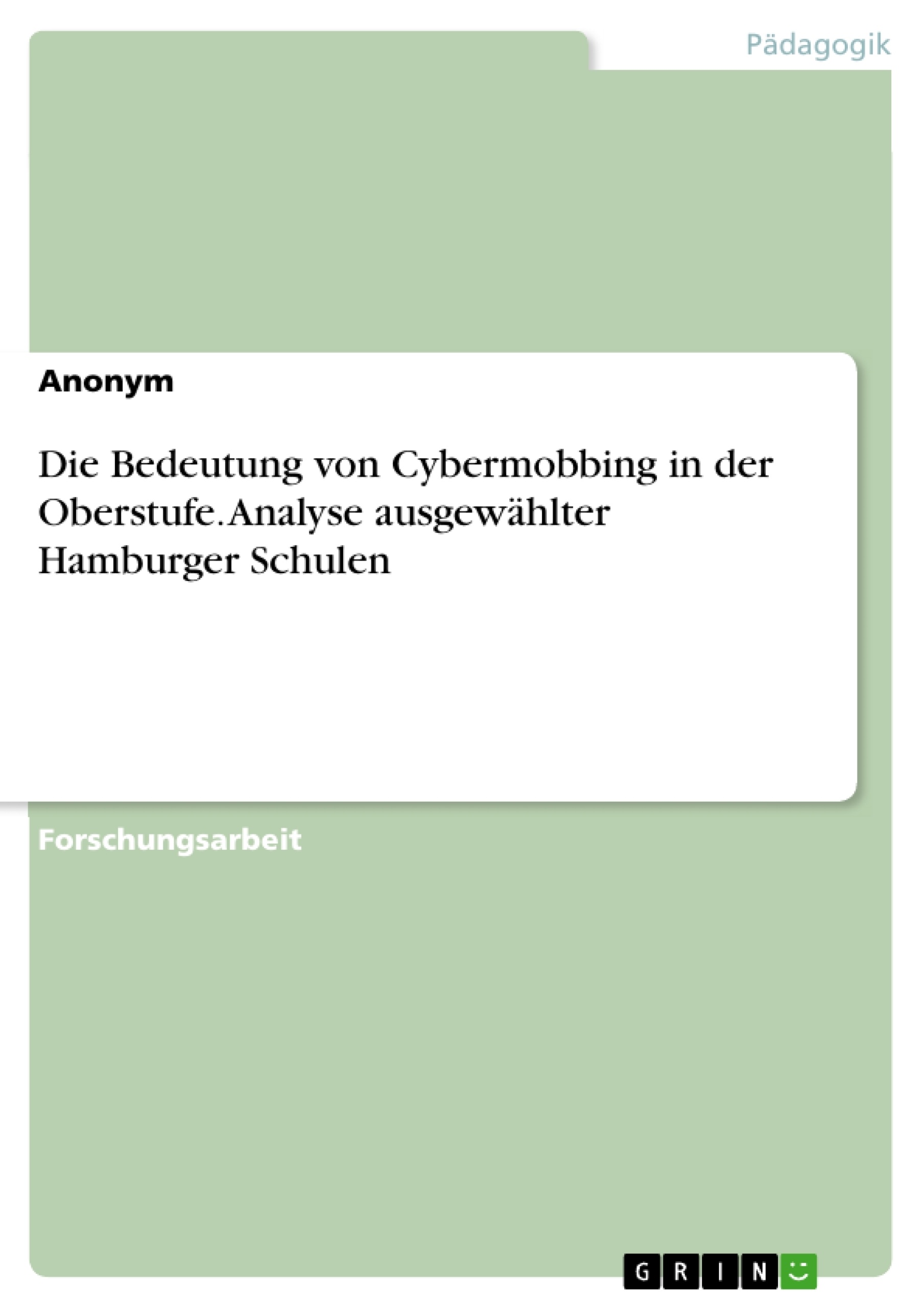In dieser Arbeit geht es um das Thema Cybermobbing und die daraus folgenden Konsequenzen für die Schule. Mit Hilfe eines Fragebogens sollen Häufigkeiten und Formen von Cybermobbing, sowie Lösungsansätze gezeigt werden. Die Arbeit beginnt mit der Darlegung des theoretischen Hintergrunds, sodass der Kontext des Forschungsvorhabens deutlich wird. Hierbei soll der aktuelle Forschungsstand zu Cybermobbing in der Schule aufgezeigt werden. Es wird vor allem ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse der JIM-Studie 2014 geworfen. Im Anschluss an den theoretischen Hintergrund soll das konkrete Forschungsinteresse mit der Fragestellung der Untersuchung, sowie die Hypothesen als Untersuchungsgegenstände dargelegt werden. Es schließt sich die Durchführung der empirischen Studie im Hinblick auf die Stichprobe und die Erhebungs-, sowie Auswertungsmethoden an. Die Ergebnisse werden anschließend in Kategorien eingeteilt und dargestellt. Der Forschungsbericht endet mit einem Ausblick.
Computer, Handys und dazugehörig das Internet gehören heute, wie das Fernsehgerät, zur selbstverständlichen technischen Ausstattung. Die aktuellste JIM – Studie (Jugend, Information, (Multi-) Media) aus dem Jahre 2014 beschreibt den Medienumgang 12- bis 19- Jähriger in Deutschland. Demnach besitzen 76 Prozent aller Jugendlichen einen eigenen Computer und 88 Prozent aller Jugendlichen ein Smartphone. Der Umgang mit neuen Kommunikationstechniken ist heutzutage folglich fester Bestandteil im Leben Jugendlicher geworden und stellt die Gesellschaft damit vor viele neue Herausforderungen.
Soziale Netzwerke sind ein wesentlicher Teil dieser neuen Kommunikationstechniken die Jugendliche heute nutzen. Die JIM – Studie 2014 zeigt, dass Kommunikation inzwischen den größten Teil der Internetnutzung ausmacht. Demnach nutzen 84 Prozent aller jugendlicher Internetnutzer WhatsApp, 43 Prozent Facebook und 11 Prozent Instagram.
Sie bilden damit die zentrale Möglichkeit mit gleichaltrigen in Verbindung zu treten. Die Möglichkeit sich durch unterschiedliche Möglichkeiten zu jeder Zeit auszutauschen bietet dabei Gefahren. Es kann der Eindruck entstehen, dass wir, bzw. Jugendliche nicht nur in einer realen Welt leben, sondern ebenso in einer parallelen Online-Welt. Die Netzwelt ist dabei charakterisiert durch die scheinbar unendlichen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und Kommunikation.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Das Internet als Waffe
- 2.2 Cybermobbing
- 2.3 Rechtliche Situation
- 3. Fragestellung der Untersuchung
- 4. Durchführung der empirischen Studie
- 4.1 Begründung für ein quantitatives Vorgehen
- 4.2 Der Fragebogen
- 4.3 Stichprobe
- 4.4 Auswertung
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Kategorie 1: Internetnutzung
- 5.2 Kategorie 2: Schülerinnen und Schüler und Cybermobbing
- 5.3 Kategorie 3: Lösungsstrategien
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Cybermobbings in der Oberstufe, insbesondere im Kontext von sozialen Netzwerken und Instant Messaging. Sie untersucht die Häufigkeit und Formen von Cybermobbing, die Rolle von Schulen und Lösungsansätze. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen von Cybermobbing in der digitalen Welt zu schaffen.
- Die Auswirkungen des Internets auf das Verhalten von Jugendlichen und die Entstehung neuer Gewaltformen wie Cybermobbing
- Die Verbreitung von Cybermobbing in sozialen Netzwerken und Instant Messaging
- Die Rolle von Schulen im Umgang mit Cybermobbing und die Entwicklung von Lösungsstrategien
- Die Bedeutung von empirischen Studien zur Erfassung von Cybermobbing in der Schule
- Die rechtliche Situation von Cybermobbing in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Cybermobbing ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen digitalen Welt dar. Sie beleuchtet die Verbreitung von Computern, Smartphones und dem Internet unter Jugendlichen und die damit verbundenen Chancen und Risiken. Insbesondere die Nutzung sozialer Netzwerke und Instant Messenger wird als potenzielle Gefahrenzone für Cybermobbing hervorgehoben.
Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund
Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen für die Untersuchung des Cybermobbings. Es betrachtet das Internet als Waffe und beschreibt, wie es neue Formen von Gewalt wie Cybermobbing, Cybercrime und Cyberstalking fördert. Im Anschluss wird eine Definition von Cybermobbing gegeben und die rechtliche Situation von Cybermobbing in Deutschland beleuchtet.
Kapitel 3: Fragestellung der Untersuchung
Dieses Kapitel spezifiziert das konkrete Forschungsinteresse der Arbeit. Die Fragestellung der Untersuchung wird präzisiert und die Hypothesen als Untersuchungsgegenstände dargelegt.
Kapitel 4: Durchführung der empirischen Studie
Hier wird die Durchführung der empirischen Studie beschrieben. Es werden die Gründe für ein quantitatives Vorgehen erläutert, der Fragebogen vorgestellt und die Stichprobe beschrieben. Die Auswertungsmethode der Studie wird ebenfalls detailliert dargestellt.
Kapitel 5: Darstellung der Ergebnisse
Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Studie. Die Ergebnisse werden in Kategorien unterteilt und analysiert. Dabei werden die Nutzung des Internets, das Vorkommen von Cybermobbing und die gefundenen Lösungsstrategien beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Cybermobbing, Schule, Oberstufe, soziale Netzwerke, Instant Messenger, Internet, digitale Welt, Gewalt, Rechtliche Situation, empirische Studie, Fragebogen, Lösungsstrategien, Schülerinnen und Schüler, JIM-Studie.
Häufig gestellte Fragen
Was genau versteht man unter Cybermobbing?
Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen, Bedrohen oder Bloßstellen von Personen über digitale Medien wie soziale Netzwerke oder Instant Messenger.
Welche Ergebnisse liefert die JIM-Studie zum Medienumgang Jugendlicher?
Die Studie zeigt, dass fast alle Jugendlichen Smartphones besitzen und Kommunikation über Dienste wie WhatsApp den größten Teil der Internetnutzung ausmacht.
Warum ist Cybermobbing in der Oberstufe ein Problem?
Durch die ständige Erreichbarkeit und die Anonymität im Netz verlagern sich Konflikte in den digitalen Raum, was für Betroffene rund um die Uhr belastend sein kann.
Wie ist die rechtliche Situation bei Cybermobbing in Deutschland?
Es gibt kein spezielles „Cybermobbing-Gesetz“, aber Handlungen können unter Straftatbestände wie Beleidigung, Üble Nachrede oder Verletzung des Rechts am eigenen Bild fallen.
Welche Lösungsstrategien gibt es für Schulen?
Wichtige Ansätze sind Präventionsprogramme, die Förderung von Medienkompetenz, klare Interventionsregeln und Beratungsangebote für Opfer und Täter.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Bedeutung von Cybermobbing in der Oberstufe. Analyse ausgewählter Hamburger Schulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319346