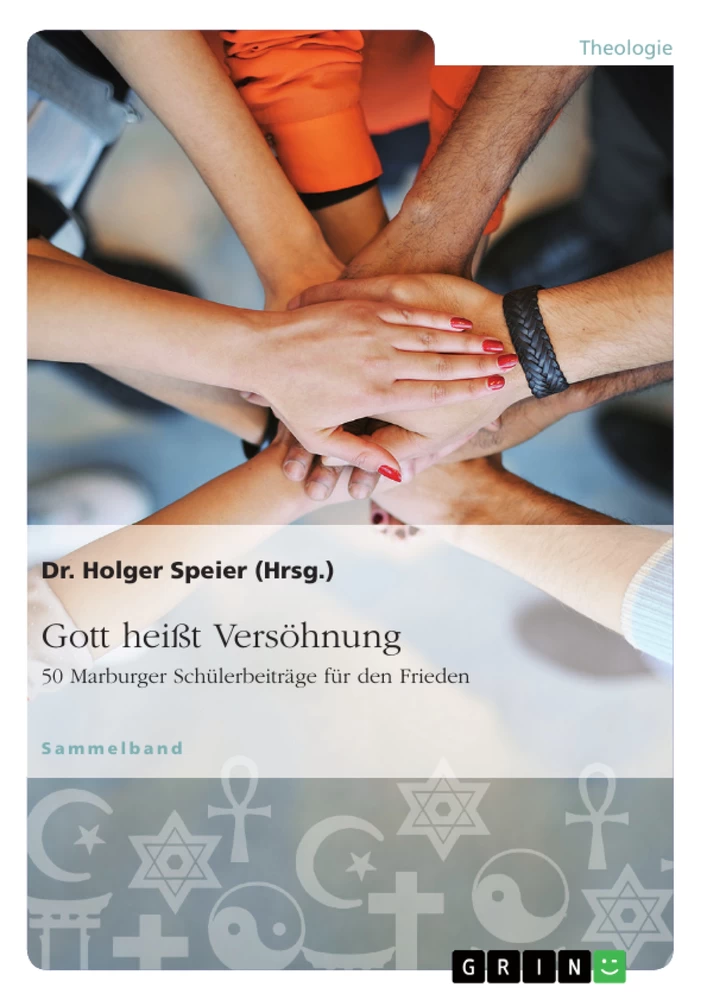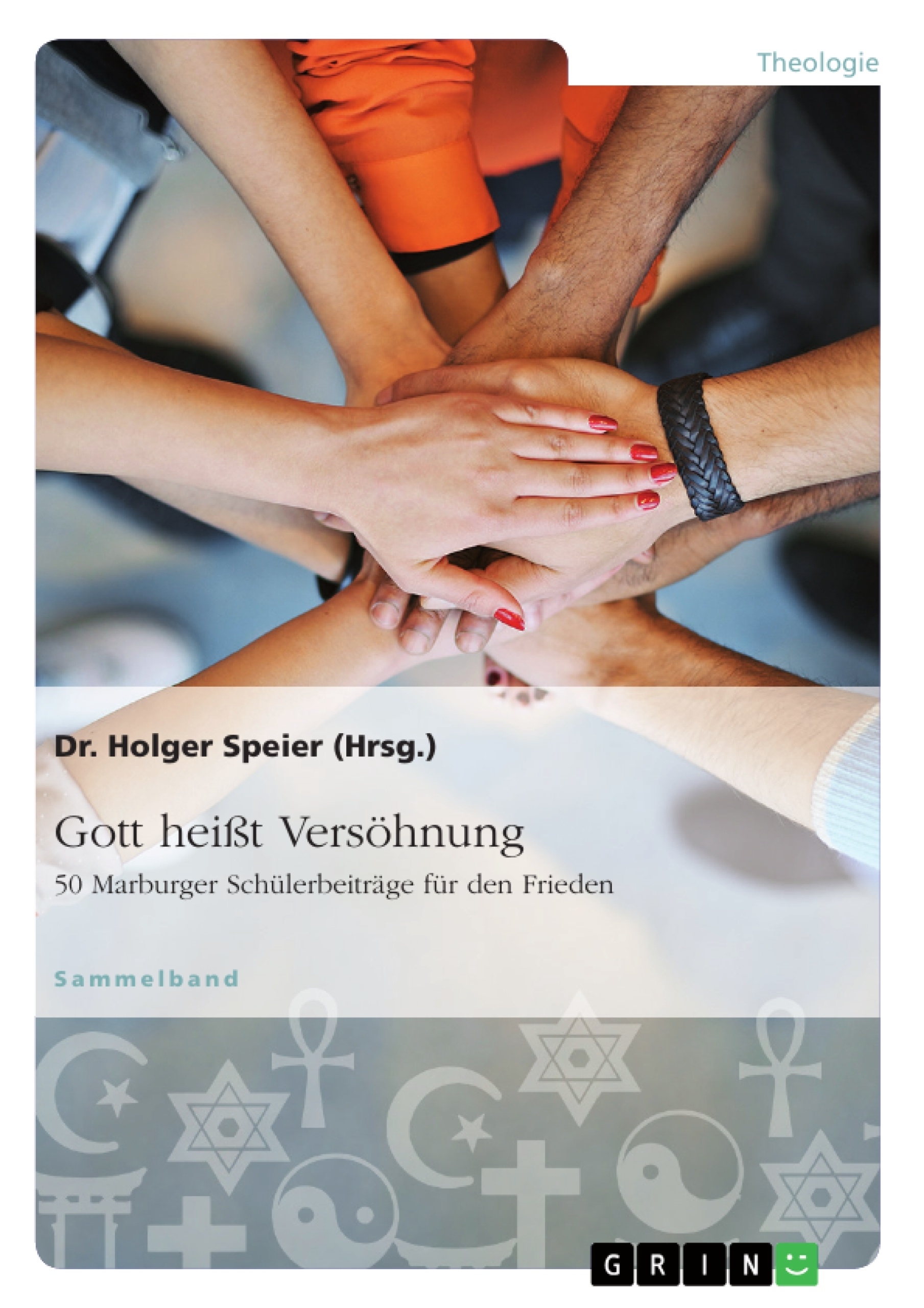In der modernen säkularisierten Welt der westlichen Gesellschaften verblasst immer mehr die Erinnerung daran, dass die Religionen Quellen des Friedens und der Versöhnung sein können. Dabei bieten sie einen wahren Schatz an Hilfestellungen und Anleitungen an, wie Frieden in der Welt verwirklicht werden kann. 50 Marburger Schüler versuchen in ihren Beiträgen diesen Schatz zu bergen, indem sie in sehr persönlicher Weise beschreiben, welche Potenziale zum Frieden und zur Verständigung die Religionen ihrer Meinung nach aufweisen. Dazu wenden sie sich dem Christentum, dem Islam, dem Hinduismus, dem Buddhismus, dem Judentum, dem Daoismus, dem Shintoismus und dem Bahaitum zu.
Fachkundig unterstützt werden sie dabei von ihrem Lehrer Dr. Holger Speier, der ihre Beiträge gesammelt, redigiert und herausgegeben hat.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Frieden im Alltag – Zwischen Schaffner und Flüchtling (Pia Brants)
- Gottes Frieden in Mexiko verbreiten (Fernanda Martinez, Andrea Paulina Brückner Sanchez)
- Die Wohltätigkeit Tzedaka als Friedenspotential des Judentums (Lauryn Krauß)
- Mit gutem Karma zum Frieden (Chantal Rinker)
- Die Zehn Gebote als Wegweiser für den Weltfrieden (Elena Zaslavskaja)
- Der Prophet Mohammed als Vorbild für Frieden und Versöhnung (Pia Wissel)
- „Jeder ist seines Glückes Schmied“ – eine moderne Anwendung des buddhistischen Karmaprinzips (Anna-Lena Dersch)
- Das Doppelgebot der Liebe als Anleitung zum Frieden (Lukas Leidinger)
- Buddhismus als Religion des Friedens (Sarah Opper)
- Die dritte Säule des Islam als Beitrag zum Frieden in der Welt (Anna Abbas)
- Der jüdische Sabbat als Hilfe zum Frieden (Nohoud Yousef)
- Die vierte Säule des Islam als Beitrag zum Frieden in der Welt (Adrian Ungemach)
- Gerechtigkeit und Gleichheit vor Gott – Grundlagen des Judentums als Beitrag zum Frieden (Franziska Schreiber)
- Wer das Wohlgefallen Allahs haben will, der tut nichts Böses (Federica Toson)
- Die Verbindung von Ahimsa und Karma als Grundlage der hinduistischen Friedensethik (Mario Zentner)
- Ein ganzes Leben lang von Gottes Liebe getragen worden – Ein Interview mit meiner Oma (Caroline Schmidt)
- Gottes Plan für mein Leben bedeutet für mich Frieden (Andre Herbolsheimer)
- Alle Religionen sprechen die Sprache des Friedens – oder: Ein Sprachkurs für alle (Nikol Minova)
- Die Bedeutung des christlichen Friedensbegriffes für den einzelnen Menschen (Jacqueline Küthe)
- Karma als „Lifestyle“ (Daniel Gombert)
- Islam heißt Frieden (Josua Schmidt)
- Iqra: Durch Bildung zum Frieden (Canan Genc)
- Die fünf Säulen des Islam wollen die Menschen zum Frieden anleiten (Aylin Koca)
- Die Goldene Regel – das Friedenspotential aller Religionen (Johanna Brüske)
- Das Gehirn Buddhas als Wegweiser zum Frieden (Paulina Detsch)
- Das Bahaitum als Beitrag zum Weltfrieden (Kimia Sahraei)
- Wie man mit Buddha seinen inneren Frieden finden kann (Yentl Brack)
- Der Buddhismus als Lehrlektion für den Weltfrieden (Elena Zimmermann)
- Tue Gutes und dir wird Gutes widerfahren (Anna Schimansky)
- „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Viktoria Kuhlmann)
- Der Ratgeber Karma – ein Anwalt für den Frieden mit sich selbst und seinem Nächsten (Jasmin Koob)
- Die Gebrüder Grimm und das Karma (Lisa Becker)
- Der fünfte edle Vorsatz der buddhistischen Ethik als Hilfe auf dem Weg in eine friedlichere Gesellschaft (Dilan Laylany-Rodriguez)
- Salam Aleikum – Frieden sei mit euch (Sahra Rashid)
- Die Geduld des Heiligen Propheten Mohammed als Wegweiser zum Frieden (Humda Ahmad)
- Gibt es Gott? Wenn ja, hat er etwas mit Frieden zu tun? (Syntia Vidakovics)
- Eine Geschichte über den Frieden (Pauline Pfister)
- „Durch Leichtfertigkeit verliert man die Wurzeln, durch Unruhe die Übersicht.“ (Julie Agel)
- Evangelische Gemeinde und Frieden – ein Interview mit Christoph Maas, dem Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Niederdieten (Maja Lauber)
- Von einer verlorenen Bankkarte und dem hinduistischen Begriff des „Ahimsa“ (Julia Iwich)
- Evangelische Kirche und Frieden – ein Interview mit dem ev. Pfarrer Dr. Matti Schindehütte, Kirchspiel Elnhausen (Christoph Seip)
- Frieden durch die „Vier edlen Wahrheiten“ (Elisa Maria Ortu)
- „Sanatana dharma“ als Friedenspotential (Bersin Nur Haydan)
- ,(Jisrael ma’Sch (ְשׁ ַמע יִ ְשָׂר ֵאל wir wollen Frieden! (Xenia Schmidt)
- Barmherzigkeit ist der Schlüssel zu Glück und Frieden (Can Tas)
- Das Vierte Gebot als Anleitung zum Frieden (Alisa Schmidt)
- Frieden heißt sich selbst finden (Galina Kolvik)
- Die Rolle der Frau im Islam als Weg zum Frieden in der Welt (Arya Karadagli)
- Shintō heißt „Weg der Götter“ und „Weg zum Frieden“ (Saskia Mildebrandt)
- „…und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ (Elena Seitz)
- Die daoistische Ethik als Wegweiser zum Frieden (Chantal Nowak)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen eines an den Kaufmännischen Schulen Marburg durchgeführten Unterrichtsprojekts, dessen Zielsetzung darin bestand, die Friedenspotentiale von Religionen zu erforschen. Dazu wurden Interviews mit den Vertretern des Christentums, des Islams, des Hinduismus, des Buddhismus, des Judentums, des Daoismus, des Shintoismus und des Bahaitums geführt, es wurden religiöse Texte gelesen und es fand eine intensive Beschäftigung mit der Geschichte der Religionen statt.
- Die Absicht, einen essenziellen Beitrag zur Befriedung und zur Versöhnung in der Welt zu leisten, ist zutiefst im Wesen aller Religionen verankert. Allerdings weisen die einzelnen Religionen einen speziellen, für sie selbst charakteristischen Weg zur Befriedung der Welt auf.
- Die Religionen bieten nicht nur Wegweisungen und Orientierungen auf der „horizontalen“ Ebene des Menschseins, d. h. im Blick auf das Selbstverständnis des Menschen, den friedlichen Umgang mit seinen Mitmenschen sowie sein Verhältnis zu den Tieren und Dingen, sondern sie deuten insbesondere auch die „vertikale“ Ebene menschlichen Seins, indem sie von Gott, dem Göttlichen oder den Göttern sprechen und das Verhältnis des Menschen zu diesen beschreiben.
- Jegliche Versuche, Religionen in Verbindung mit Terror, Gewalt und Krieg zu bringen, verbieten sich. Die ureigene Absicht der Religionen besteht darin, aus ihren Deutungen der „vertikalen“ Ebene menschlichen Seins konstruktive und hilfreiche Ordnungen auf der „horizontalen“ Ebene des menschlichen Seins aufzuzeigen.
- Die Anzahl der Religionszugehörigen stellt weltweit eine beachtenswerte Größe dar: Etwa 84% der Weltbevölkerung gehören einer organisierten Religionsgruppe an1 und selbst im säkularen Deutschland bezeichnen sich 52% der Bevölkerung als „religiös“2, 18% sogar als „hochreligiös“3. Die Frage, welchen Beitrag die Religionen zur Versöhnung und zum Weltfrieden leisten können, drängt sich angesichts dieser Zahlen geradezu auf. Schändlich wäre es für die politisch Verantwortlichen, wenn sie das Friedenspotenzial, das die Religionen bieten, im Blick auf die Befriedung der Welt unbeachtet und ungenutzt ließen.
- Religionen können nur dann einen Beitrag zur Versöhnung und zum Frieden leisten, wenn ihre Anhänger auch innerlich von ihrer Religion überzeugt sind. Eine nur formale Mitgliedschaft und rein äußerliche Zugehörigkeit zu einer Religionsgruppe ist zu wenig, als dass sie zu einem religiös motivierenden Versöhnungs- und Friedensprozess anregen könnte.
Zusammenfassung der Kapitel
- Pia Brants beschreibt in ihrem Beitrag, wie ein Banker durch ein scheinbar kleines Detail, einem Fahrkartenkontroll-Zwischenfall, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Respekt und Toleranz im Umgang mit Flüchtlingen lenkt.
- Fernanda Martinez und Andrea Paulina Brückner Sanchez erzählen von der aktiven Rolle der katholischen Kirche in Mexiko, die sich für ein friedliches Miteinander einsetzt und Jugendlichen und Kindern durch verschiedene Aktivitäten gute Werte vermittelt, um sie vor Kriminalität zu schützen.
- Lauryn Krauß beleuchtet das Gebot des Tzedaka im Judentum, welches als Ausdruck von Wohltätigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden kann, und argumentiert, dass die Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung von Bedürftigen einen wichtigen Beitrag für den Frieden darstellt.
- Chantal Rinker erläutert, wie die hinduistischen Prinzipien des Karma und Ahimsa (Gewaltlosigkeit) für ein friedliches Miteinander sorgen können, indem sie die Menschen zu gutem Verhalten und Toleranz anhalten.
- Elena Zaslavskaja beschreibt die Bedeutung der Zehn Gebote für ein geordnetes Zusammenleben der Menschen, indem sie die Notwendigkeit von Respekt, Vertrauen und Gerechtigkeit als Grundlage für Frieden hervorhebt.
- Pia Wissel betont den friedlichen Umgang, den der Islam den Menschen vorschreibt, und veranschaulicht dies anhand einer Geschichte, in der der Prophet Mohammed trotz ständiger Provokation von einem Juden, diesem freundlich und respektvoll begegnet.
- Anna-Lena Dersch beleuchtet das Konzept des Karmas im Buddhismus und erläutert, wie dieses Konzept zu einem selbstverantwortlichen Handeln anregt und Konflikte durch die Suche nach friedlichen Lösungen vermeidet.
- Lukas Leidinger erläutert das Doppelgebot der Liebe im Christentum als Zusammenfassung der Zehn Gebote und betont, dass Gottesliebe und Nächstenliebe die Grundlage für ein friedliches Miteinander bilden.
- Sarah Opper beschreibt den Buddhismus als eine Religion des Friedens, in der die Vorstellung des Karma, die Toleranz gegenüber allen Lebewesen und die Nächstenliebe für ein friedvolles Zusammenleben sorgen sollen.
- Anna Abbas betont die Bedeutung der dritten Säule des Islams, die die Gläubigen dazu auffordert, wohltätig gegenüber Bedürftigen zu sein. Sie argumentiert, dass diese Handlungsweise einen wichtigen Beitrag für den Frieden in der Welt leistet, indem sie die Not der Hilfsbedürftigen lindert und ihnen Gottes Milde und Hilfsbereitschaft zeigt.
- Nohoud Yousef erläutert die Bedeutung des Sabbats im Judentum, der eine Geisteshaltung der Bescheidenheit und Zufriedenheit fördern soll und so den Wunsch nach unmäßigem Besitz und Gewalt zurückdrängt.
- Adrian Ungemach beschreibt die vierte Säule des Islams, das Fasten im Ramadan, als ein Beitrag zum Frieden, da es die Gemeinschaft der Muslime stärkt und ihnen hilft, die Gleichheit aller Menschen vor Allah zu erkennen.
- Franziska Schreiber beleuchtet die Bedeutung der Gerechtigkeit und Gleichheit vor Gott im Judentum als wichtige Grundlagen für ein friedliches Miteinander, indem sie die Selbstverantwortung für das eigene Handeln und die Folgen des Handelns betont.
- Federica Toson erläutert die Friedfertigkeit des Islams, die sich in der Bedeutung der Gebetswaschung und den vielfältigen Regeln zeigt, die dazu beitragen, ein friedvolles und ruhiges Leben zu führen.
- Mario Zentner betont die Verbindung von Ahimsa (Gewaltlosigkeit) und Karma im Hinduismus und erläutert, wie diese Verbindung zu einem friedlichen Umgang miteinander führt, indem man ein gutes Karma durch friedliches Verhalten erlangt.
- Caroline Schmidt interviewt ihre Oma, eine evangelische Christin, und erfährt, wie der Glaube ihr in schwierigen Situationen Kraft gegeben hat und dass sie sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt.
- Andre Herbolsheimer schildert seine persönlichen Lebenserfahrungen als Kind in einem Kinderheim und wie er durch seine Adoptiveltern zum Glauben an Jesus Christus fand. Er betont, dass Gottes Plan für sein Leben ihm inneren Frieden gibt.
- Nikol Minova beschreibt die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz im Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen, die sie durch ihre Erfahrung mit einem jungen afghanischen Flüchtling in einem Sprachkurs gewonnen hat.
- Jacqueline Küthe erläutert die Bedeutung des christlichen Friedensbegriffes für den einzelnen Menschen und zeigt anhand der Geschichte ihrer Oma, wie der Glaube ihr in der schweren Zeit der Krankheit Kraft und inneren Frieden schenkt.
- Daniel Gombert erläutert, wie das Karma-Gesetz des Buddhismus als „Lifestyle“ für alle Menschen zu einer positiveren und friedlicheren Lebensweise führen kann, indem es zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Handeln anregt.
- Josua Schmidt kritisiert den Missbrauch von Begriffen wie „Dschihad“ und „Scharia“ durch einzelne muslimische Gruppen und erklärt, dass der Islam eine friedliche Religion ist, die zu Frieden und Versöhnung aufruft.
- Canan Genc betont die Bedeutung des Wortes „Iqra“ (lies) im Islam und erklärt, dass es die Aufgabe der Muslime ist, sich im Blick auf ihre Religion ständig weiterzubilden, um falsche islamische Lehren zu vermeiden. Sie sieht in Bildung ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung von Intoleranz und Radikalismus.
- Aylin Koca erläutert, wie die fünf Säulen des Islam die Menschen zu einem friedlichen Miteinander anleiten, indem sie zu gutem Verhalten, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit anhalten.
- Johanna Brüske beschreibt, wie die Goldene Regel, die sich in allen Religionen findet, zu einem friedlichen Miteinander führen kann, indem sie Menschen dazu anregt, anderen Gutes zu tun.
- Paulina Detsch erläutert die Bedeutung des Friedens im Buddhismus und betont, dass man durch sein Handeln das Spiegelbild seiner Handlungen ist und dass man durch bewusstes und ethisches Handeln Leid vermeiden und Glück hervorrufen kann.
- Kimia Sahraei beschreibt die Bedeutung des Bahaitum für den Weltfrieden, das sich für Toleranz, Gleichberechtigung und Respekt der Religionen untereinander einsetzt.
- Yentl Brack erläutert, wie man durch den Buddhismus seinen eigenen inneren Frieden finden kann, indem man positiv denkt, sich von übermäßigem Besitz trennt und sich der Meditation widmet.
- Elena Zimmermann beschreibt die „Vier edlen Wahrheiten“ des Buddhismus als Lehrlektion für den Weltfrieden, indem sie die menschliche Gier als Ursache für Leid ausmacht und den „Edlen achtfältigen Pfad“ als Methode zur Beendigung des Leidens darstellt.
- Anna Schimansky erläutert das Karma-Gesetz als ein wichtiges Potential für die Verwirklichung des Weltfriedens, da es die Menschen zu gutem Handeln und friedfertigem Verhalten anregt.
- Viktoria Kuhlmann betont die Bedeutung der Zehn Gebote als Leitlinien für ein friedliches Miteinander, da sie einfache Regeln für ein respektvolles und verantwortungsvolles Zusammenleben der Menschen aufstellen.
- Jasmin Koob beschreibt die hinduistische Vorstellung vom Karma als einen Ratgeber für den Frieden mit sich selbst und dem Nächsten, indem es zu einem bewussteren und verantwortungsvolleren Handeln anregt.
- Lisa Becker zeigt anhand des Märchens vom Sterntaler der Gebrüder Grimm, wie die Wirksamkeit des Karma-Gesetzes „Tue Gutes und dir widerfährt auch Gutes“ veranschaulicht werden kann.
- Dilan Laylany-Rodriguez erläutert den fünften edlen Vorsatz der buddhistischen Ethik, der die Menschen dazu auffordert, sich von Einflüssen fernzuhalten, die das Bewusstsein trüben können, und argumentiert, dass dieser Vorsatz dazu beitragen kann, dass Menschen weniger süchtig nach Alkohol, Drogen oder Computerspielen werden.
- Sahra Rashid beschreibt die Begrüßungsformel „Salam Aleikum“ im Islam als Zeichen für das friedvolle Miteinander der Muslime, die sich gegenseitig Frieden auf ihrem Weg wünschen.
- Humda Ahmad schildert die Geduld des Heiligen Propheten Mohammed als Wegweiser zum Frieden, indem sie erzählt, wie Mohammed einer alten Frau, die ihn immer wieder mit Müll bewarf, geduldig gegenübertrat und ihr schließlich half, als sie krank war.
- Syntia Vidakovics erzählt ihre persönliche Geschichte, wie sie durch den Glauben an Gott inneren Frieden fand.
- Pauline Pfister erzählt eine Geschichte über den Frieden, in der ein kleines Kaninchen und ein Flughörnchen die Welt retten, indem sie gemeinsam mit dem Drachen Aeolus eine „Wolke aus schlechter Laune“ vertreiben.
- Julie Agel erläutert die daoistische Ethik als Wegweiser zum Frieden, der dazu auffordert, die Dinge geschehen zu lassen und sich dem Lauf der Welt anzupassen, um so Harmonie und inneres Gleichgewicht zu erlangen.
- Maja Lauber interviewt ihren Gemeindepastor Christoph Maas zum Thema „Evangelische Gemeinde und Frieden“ und erörtert mit ihm die Bedeutung des christlichen Friedensbegriffes und die Möglichkeiten, Frieden in der Welt zu stiften.
- Julia Iwich beschreibt die Bedeutung des hinduistischen Begriffs „Ahimsa“ (gewaltloses Leben) und erläutert anhand einer persönlichen Geschichte, wie gutes Karma dazu führt, dass man Gutes widerfährt.
- Christoph Seip interviewt den evangelischen Pfarrer Dr. Matti Schindehütte zum Thema „Evangelische Kirche und Frieden“ und erörtert mit ihm die Bedeutung des Friedens aus christlicher Sicht und die Rolle der Kirche im Friedensprozess.
- Elisa Maria Ortu erläutert die „Vier edlen Wahrheiten“ des Buddhismus und argumentiert, dass sie ein Friedenspotential in sich tragen, da sie die menschliche Gier als Ursache allen Leidens identifizieren und den „Edlen achtfältigen Pfad“ als Weg zur Beendigung des Leidens und zur Erlangung von Frieden vorstellen.
- Bersin Nur Haydan erläutert die Bedeutung des „Sanatana dharma“ (ewige Ordnung) im Hinduismus und argumentiert, dass dieses Konzept ein großes Friedenspotential bietet, indem es zu einem friedlichen und respektvollen Umgang mit allen Lebewesen auffordert.
- Xenia Schmidt erläutert das jüdische Glaubensbekenntnis „Sch‘ma Jisrael“ als Ausdruck der Gottesliebe und der Selbstverpflichtung, Gottes Gebote zu halten, und argumentiert, dass dies zu einem friedvollen Miteinander der Menschen führt.
- Can Tas beschreibt die Barmherzigkeit als Schlüssel zu Glück und Frieden und erläutert anhand der Geschichte seines Großvaters, wie die Ausübung von Barmherzigkeit zu einem erfüllten und friedvollen Leben führt.
- Alisa Schmidt erläutert das Vierte Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“ als Anleitung zum Frieden und argumentiert, dass respektvoller Umgang zwischen Eltern und Kindern zu einem friedlichen Familienleben führt.
- Galina Kolvik erläutert die daoistische Lehre, dass Frieden erst dann verwirklicht werden kann, wenn man sich selbst gefunden hat, und betont die Bedeutung von Eigenverantwortung, Individualität und Selbstfindung für ein erfülltes und friedliches Leben.
- Arya Karadagli beschreibt die Rolle der Frau im Islam als einen wichtigen Beitrag zum Frieden in der Welt, indem sie auf die Bedeutung der Mutterrolle, die geschlechtsspezifische Aufgabenverteilung und die Würde der Frau eingeht.
- Saskia Mildebrandt erläutert den Shintoismus als eine Religion des Friedens, die sich durch Respekt vor der Natur, die Anerkennung der Kami (Geister) und die Betonung der Selbstverantwortung für die eigenen Handlungen auszeichnet.
- Elena Seitz schildert ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Glauben an Gott und erläutert, wie er ihr Trost und Hoffnung in schwierigen Situationen schenkt, insbesondere anhand der Geschichte ihrer Urgroßmutter, die während des Zweiten Weltkriegs stark an Gott glaubte und durch ihren Glauben Kraft und Trost fand.
- Chantal Nowak erläutert die daoistische Ethik als Wegweiser zum Frieden mit sich selbst und der Welt, indem sie die Bedeutung von Harmonie mit dem „Dao“ (Weltlauf) und die Anpassung an den stetigen Wandel betont.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Veröffentlichung beschäftigt sich mit dem Thema des Friedens aus der Perspektive verschiedener Religionen. Die zentralen Themenbereiche sind Friedenspotentiale, Religionsvergleich, Versöhnung, Gewaltlosigkeit, Karma, Gottesliebe, Nächstenliebe, Toleranz, Respekt, Gerechtigkeit, Gleichheit, Barmherzigkeit, Bildung, Selbstverantwortung, Ahimsa, Sanatana dharma, Sch‘ma Jisrael, Gebetswaschung, „Vier edle Wahrheiten“, „Edler achtfältiger Pfad“, „Dao“, „Kami“ und „Ahimsa“.
- Quote paper
- Dr. Holger Speier (Editor), 2016, Gott heißt Versöhnung. 50 Marburger Schülerbeiträge für den Frieden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319398