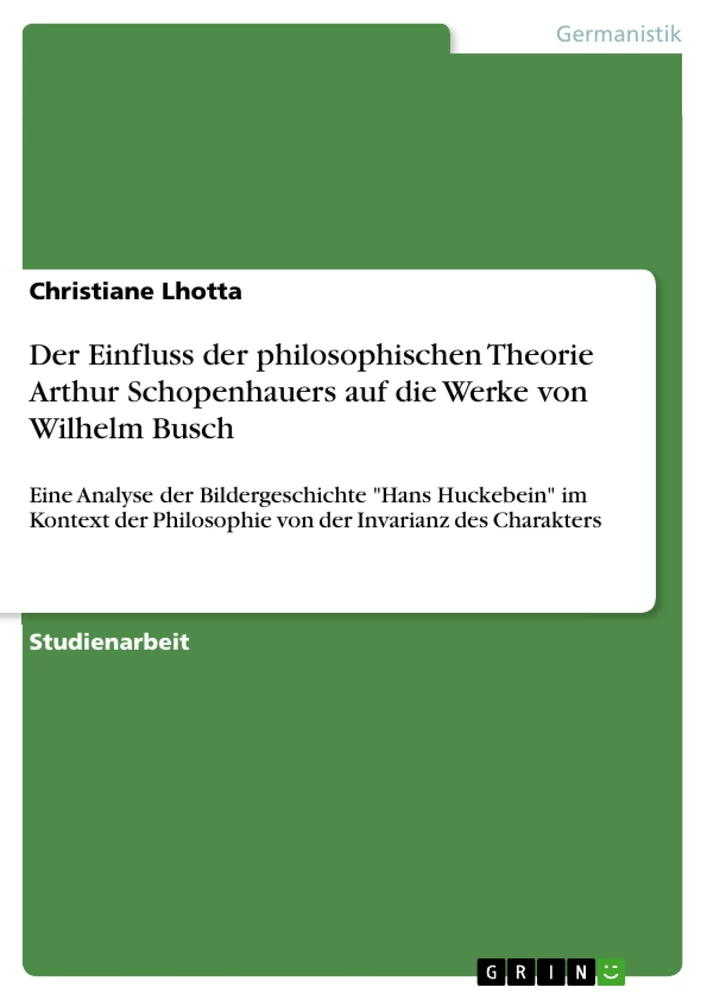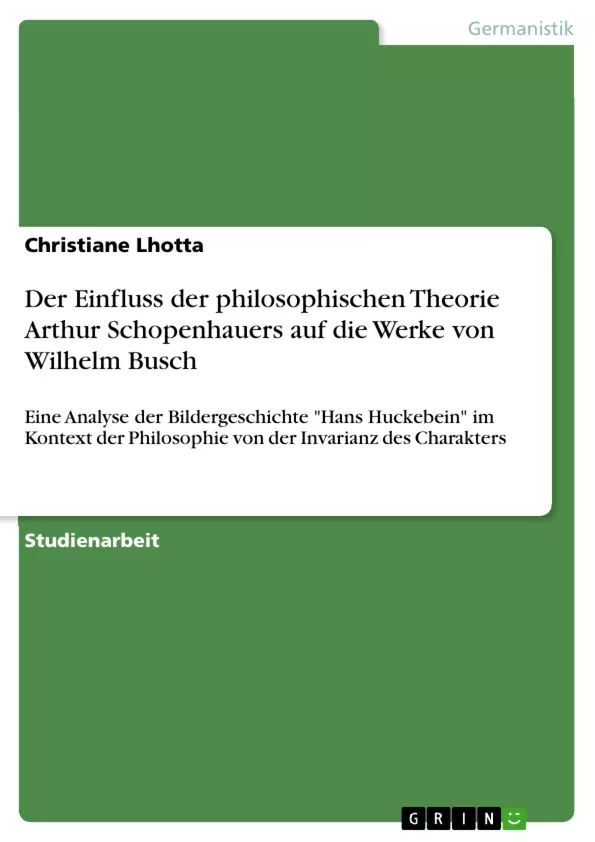Die vorliegende Arbeit nimmt Bezug zur philosophischen Theorie Arthur Schopenhauers und dessen Einfluss auf die Werke des Dichters Wilhelm Busch. Inwiefern eine solche Synthese sinnvoll und möglich ist, wird im folgenden am Beispiel der Bildergeschichte „Hans Huckebein – der Unglücksrabe“ dargestellt. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung liegt der Fokus der Untersuchung auf der Betrachtung der Invarianz des Charakters.
Das erste Kapitel beschränkt sich daher auf eine skizzenhafte Darstellung der Auffassung Schopenhauers über die Welt als Wille und Vorstellung, Intellekt und Erkenntnis sowie das Wesen des Charakters. Darauf aufbauend stellt Kapitel II den Bezug zur Bildergeschichte her, beschreibt das Verhältnis von Autor und Philosoph, um letztlich durch die Interpretation der Bildergeschichte auf dem Hintergrund der philosophischen Theorie eine freie Synthese zu versuchen.
Biographische Hintergründe des Autors sowie des Philosophen wurden nicht untersucht und daher nicht berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Zur Philosophie Arthur Schopenhauers
- 1. Die Welt als Wille und Vorstellung
- 2. Intellekt und Erkenntnis
- 3. Vom Wesen des Charakters
- II. Der Dichter und der Philosoph
- 1. Schopenhauers Einfluß auf Wilhelm Busch
- 2. Die Bildergeschichte
- 3. Die Synthese: Zur Invarianz des Charakters in der Geschichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss der philosophischen Theorie Arthur Schopenhauers auf die Werke des Dichters Wilhelm Busch. Im Fokus steht die Bildergeschichte „Hans Huckebein – der Unglücksrabe“ und die Frage, inwieweit sich die Schopenhauersche Philosophie auf die Darstellung des Charakters und seines Verhaltens im Werk Buschs nachweisen lässt.
- Schopenhauers Vorstellung von der Welt als Wille und Vorstellung
- Schopenhauers Konzeption des Charakters als Ausdruck des Willens
- Die Beziehung zwischen Schopenhauers Philosophie und Wilhelm Buschs Werk
- Die Darstellung des Charakters in „Hans Huckebein – der Unglücksrabe“
- Die Frage nach der Invarianz des Charakters und seiner Bedeutung für die Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel I bietet eine kurze Einführung in die philosophische Theorie Arthur Schopenhauers. Es werden die wichtigsten Elemente seiner Gedankenwelt skizziert, darunter seine Vorstellung von der Welt als Wille und Vorstellung, die Rolle des Intellekts und der Erkenntnis sowie seine Definition des Charakters als ein determiniertes, unveränderliches Wesen.
Kapitel II befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Schopenhauer und Wilhelm Busch. Es werden die Werke des Philosophen diskutiert, die Busch beeinflusst haben könnten, und die Geschichte „Hans Huckebein – der Unglücksrabe“ wird im Kontext von Schopenhauers Theorie analysiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Arthur Schopenhauer, Wilhelm Busch, Philosophie, Charakter, Invarianz, Wille, Vorstellung, Intellekt, Erkenntnis, „Hans Huckebein – der Unglücksrabe“.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Arthur Schopenhauer das Werk von Wilhelm Busch?
Busch übernahm Schopenhauers pessimistische Weltsicht, in der der blinde "Wille" das Handeln bestimmt und der Mensch oft Sklave seiner Triebe bleibt.
Was bedeutet "Invarianz des Charakters" bei Schopenhauer?
Es ist die Lehre, dass der Kerncharakter eines Menschen unveränderlich ist und sich durch äußere Erziehung oder Einsicht nicht grundlegend wandeln lässt.
Wie zeigt sich Schopenhauers Philosophie in "Hans Huckebein"?
Der Unglücksrabe folgt seinem zerstörerischen Trieb (Wille), was zwangsläufig in die Katastrophe führt – ein Spiegelbild der Schopenhauerschen Willensmetaphysik.
Was ist der Unterschied zwischen Wille und Vorstellung?
Der Wille ist die dunkle Urkraft hinter allen Dingen; die Vorstellung ist die Art und Weise, wie unser Intellekt diese Welt wahrnimmt und ordnet.
Gilt Wilhelm Busch als Philosoph unter den Dichtern?
Ja, seine humoristischen Bildergeschichten enthalten oft tiefgründige philosophische Reflexionen über das menschliche Scheitern und das Wesen des Daseins.
- Quote paper
- Christiane Lhotta (Author), 2003, Der Einfluss der philosophischen Theorie Arthur Schopenhauers auf die Werke von Wilhelm Busch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319562