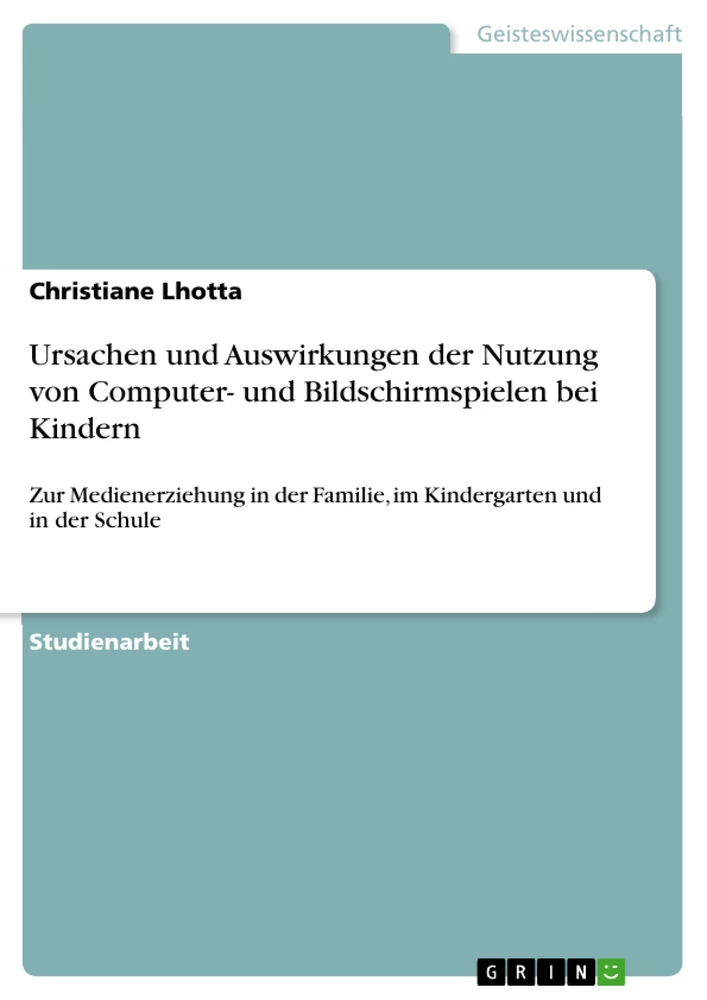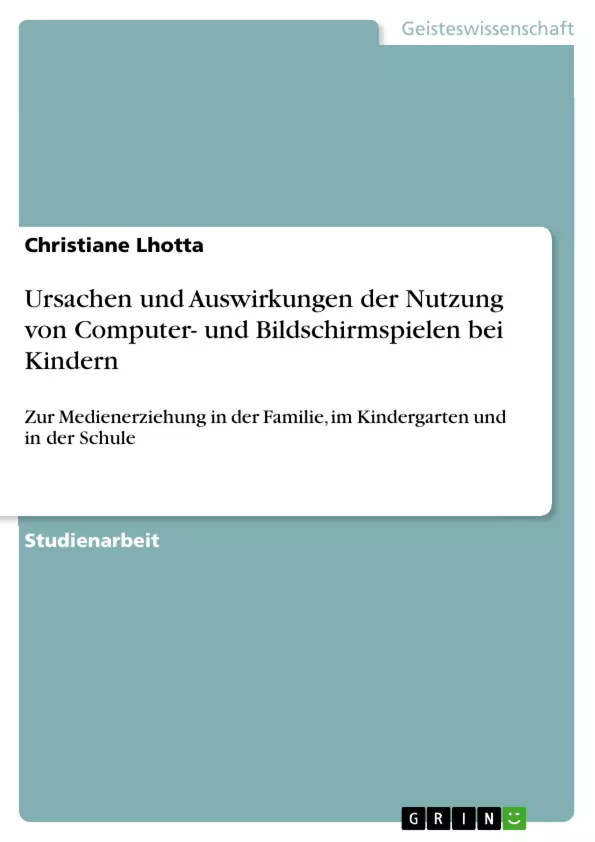Reichweite und Einfluss von Medien sind gegenwärtig so breit gefächert, fast unüberschaubar, dass es unzählige Aspekte gibt, die aufgegriffen, beschrieben und analysiert werden könnten. Ausgehend von einem kurzen Überblick zur Entwicklung der Medientechnologie und dem Spektrum der Medienwelt, in dem Kinder heute aufwachsen (müssen), liegt ein Schwerpunkt dieser Arbeit in der Darstellung unterschiedlicher Typen von Computer- und Bildschirmspielen und der Erklärung des Faszinationspotential, das von diesen Spielen ausgeht.
Weiterhin werden mögliche gesundheitsschädliche und entwicklungshemmende Auswirkungen übermäßiger Computernutzung beschrieben. Abschließend wird versucht, Möglichkeiten einer sinnvollen Medienerziehung aufzuzeigen. Dabei werden sowohl Familien wie auch Kindergärten, Schulen und außerschulischen Freizeiteinrichtungen eine große Bedeutung für die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern zugeschrieben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- I. Mediennutzung von Kindern
- 1. Entwicklungsgeschichte der Medien
- 2. Art und Umfang der Mediennutzung
- II. Der Reiz von Computer- und Bildschirmspielen
- 1. Spielarten
- 1.1 Denkspiele
- 1.2 Actionspiele
- 1.3 Geschichtenspiele
- 2. Spielvoraussetzungen
- 2.1 Sensumotorische Synchronisierung / Pragmatischer Funktionskreis
- 2.2 Bedeutungsübertragung / Semantischer Funktionskreis
- 2.3 Regelkompetenz / Syntaktischer Funktionskreis
- 2.4 Selbstbezug / Dynamischer Funktionskreis
- 3. Funktionsabläufe und Motivationsursachen
- 3.1 Der Spielverlauf
- 3.2 Flow-Spirale
- 3.3 Frustrations-Spirale
- III. Auswirkungen der Computernutzung auf die Gesundheit und Entwicklung von Kindern
- 1. Physische Auswirkungen
- 1.1 Das Auge
- 1.2 Bewegungsmangel und Streß
- 1.3 Gehirnphysiologische Veränderungen
- 1.4 Belastungen durch Elektrosmog
- 1.5 Chronische Krankheiten
- 2. Psychische und soziale Auswirkungen
- 2.1 Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung
- 2.2 Beeinflussung des Wertesystems
- 2.3 Veränderungen des Weltbildes und der Denkweise
- 2.4 Auswirkungen auf soziale Fähigkeiten
- 2.5 Medialer Einfluß auf kommunikative Kompetenzen
- IV. Vom richtigen Umgang mit Computer- und Bildschirmspielen
- 1. Medienerziehung in der Familie
- 2. Medienpädagogik in Kindergärten und Schulen
- 3. Außerschulische Medienarbeit
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Ursachen und Auswirkungen der Nutzung von Computer- und Bildschirmspielen bei Kindern. Die Arbeit analysiert den Reiz dieser Spiele und untersucht die möglichen Folgen für die physische und psychische Gesundheit sowie die Entwicklung von Kindern. Sie beleuchtet außerdem die Bedeutung der Medienerziehung in verschiedenen Bereichen, wie der Familie, Kindergärten und Schulen, sowie in der außerschulischen Medienarbeit.
- Entwicklungsgeschichte von Medien und deren Einfluss auf Kinder
- Die Faszination von Computer- und Bildschirmspielen
- Mögliche gesundheitliche Risiken durch übermäßigen Medienkonsum
- Auswirkungen der Computernutzung auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung
- Wichtige Aspekte der Medienerziehung in der Familie, Schule und außerschulischen Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel I gibt einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte von Medien und deren Einbindung in das Leben von Kindern. Kapitel II beleuchtet den Reiz von Computer- und Bildschirmspielen und erklärt die Funktionsweise der verschiedenen Spielarten. Kapitel III beschäftigt sich mit möglichen gesundheitlichen Auswirkungen übermäßiger Computernutzung auf Kinder, sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht. Kapitel IV befasst sich mit wichtigen Aspekten der Medienerziehung in der Familie, Schule und außerschulischen Einrichtungen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Mediennutzung, Computer- und Bildschirmspiele, Medienerziehung, Kinder, Entwicklung, Gesundheit, Kognition, Sozialisation, Familie, Schule, außerschulische Medienarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum faszinieren Computerspiele Kinder so stark?
Die Faszination liegt in der Flow-Spirale, dem Selbstbezug und dem sensumotorischen Feedback, das die Spiele bieten.
Welche gesundheitlichen Risiken birgt übermäßiger Medienkonsum?
Mögliche Folgen sind Bewegungsmangel, Augenprobleme, Stress sowie negative Auswirkungen auf die Gehirnphysiologie.
Wie wirkt sich Spielen auf die soziale Entwicklung aus?
Es kann soziale Fähigkeiten und kommunikative Kompetenzen beeinflussen, wobei sowohl Risiken als auch Chancen für die kognitive Entwicklung bestehen.
Welche Rolle spielt die Medienerziehung in der Familie?
Die Familie ist die erste Instanz zur Förderung von Medienkompetenz und zur Etablierung eines gesunden Umgangs mit Bildschirmmedien.
Was können Schulen und Kindergärten zur Medienpädagogik beitragen?
Sie sollten Medienkompetenz aktiv vermitteln und Kinder dabei unterstützen, Medieninhalte kritisch zu reflektieren.
- Citation du texte
- Christiane Lhotta (Auteur), 1999, Ursachen und Auswirkungen der Nutzung von Computer- und Bildschirmspielen bei Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319586