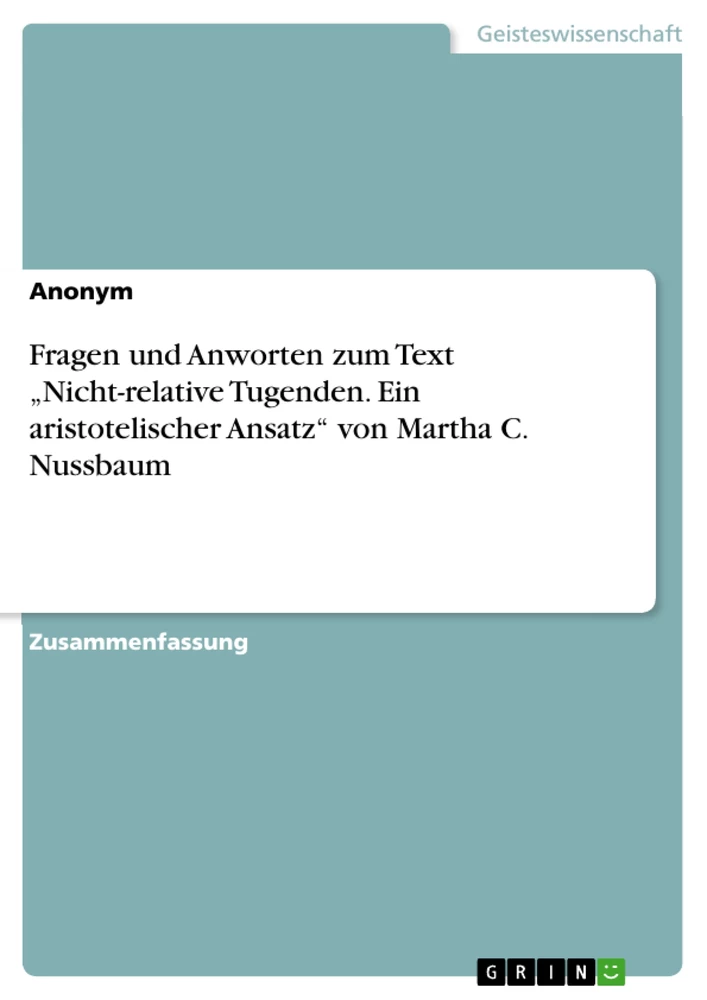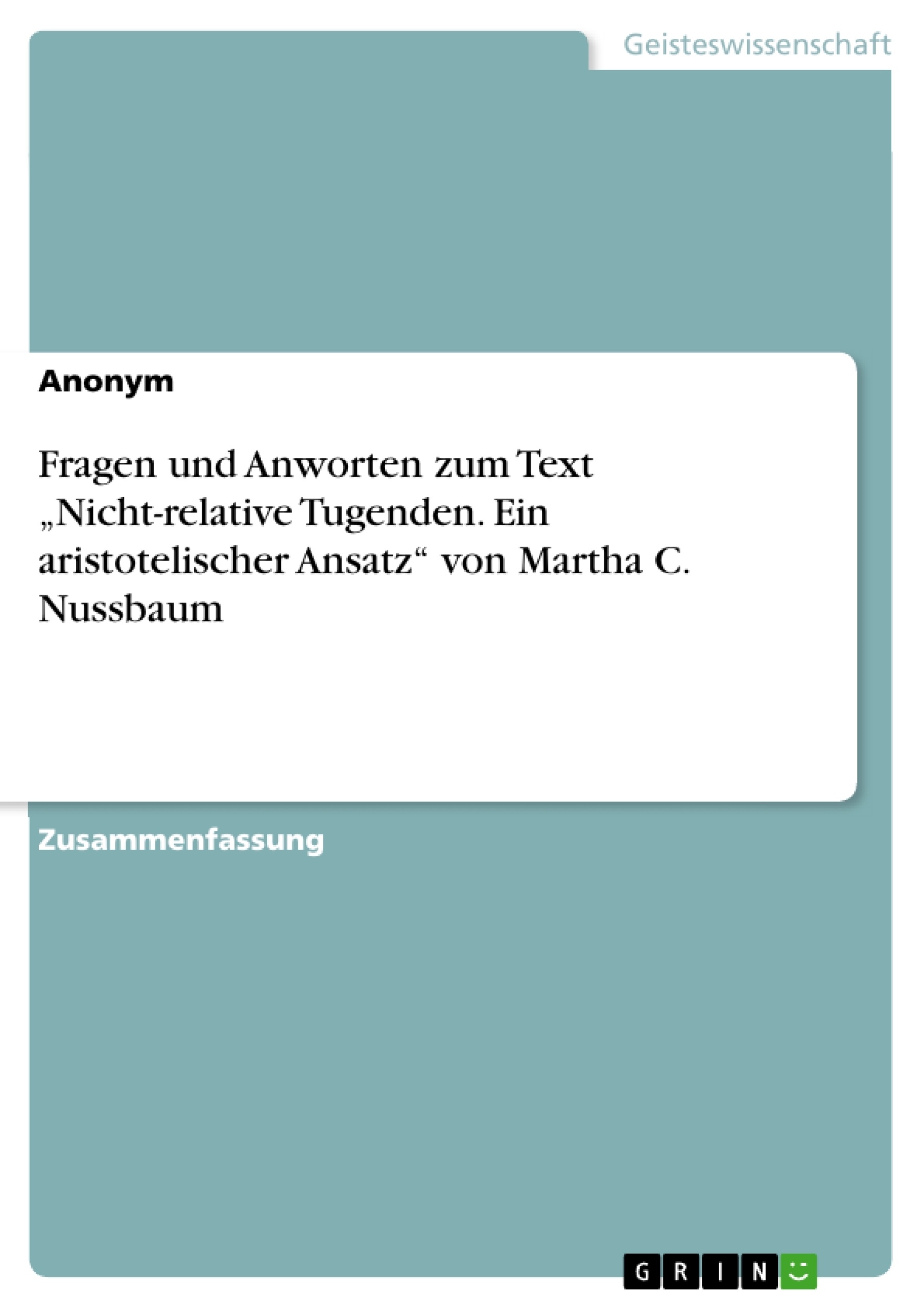In dieser Arbeit werden Fragen beantwortet, deren Grundlage der Text "Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz" von Martha C. Nussbaum ist.
1) Was ist ethischer Relativismus und welche Spielart des Relativismus wird im Text hauptsächlich behandelt?
2) Was ist eine ethische Norm und wie unterscheidet sie sich von einer Tugend?
3) Nussbaum verweist im Text u. a. auf Foucault, der eine Genealogie entwickelt. Was bedeutet Genealogie?
4) Inwiefern sind Tugenden objektiv?
5) Was meint Nussbaum mit „Grunderfahrung“ und was bedeutet es, ein "lebendiges menschliches Wesen zu sein"?
6) Was bringen Kritiker für Einwände gegen eine nicht-relativistische Auffassung der Tugendethik vor?
6.a.1) Wie lautet der erste Einwand?
6.a.2) Was besagt das Donner-Beispiel? Worin unterscheiden sich Tugend und Donner?
6.b) Was besagt der zweite Einwand?
6.c) Wie funktioniert der dritte Einwand und inwiefern unterscheidet er sich vom zweiten bzw. ist radikaler als dieser?
7.) Wie sind der aristotelische Partikularismus und die aristotelische Objektivität "zu vereinbaren"?
8.) Wie versucht Nussbaum, den zweiten Einwand zu entkräften?
Inhaltsverzeichnis
- Fragen zu Nussbaum „Nicht-relative Tugenden: Ein aristotelischer Ansatz“
- 1. Was ist ethischer Relativismus und welche Spielart des Relativismus wird im Text hauptsächlich behandelt? (2 P)
- 2. Was ist eine ethische Norm und wie unterscheidet sie sich von einer Tugend? (1 P)
- 3. N. verweist im Text u. a. auf Foucault, der eine Genealogie entwickelt. Was bedeutet Genealogie? (2 P)
- 4. Inwiefern sind Tugenden objektiv? (1 P)
- 5. Was meint N. mit „Grunderfahrung“ und was bedeutet es, ein \"lebendiges menschliches Wesen zu sein\"? (1 P)
- 6. Was bringen Kritiker für Einwände gegen eine nicht-relativistische Auffassung der Tugendethik vor?
- 6.a.1 Wie lautet der erste Einwand? (1 P)
- 6.a.2 Was besagt das Donner-Beispiel? Worin unterscheiden sich Tugend und Donner? (1 P)
- 6.b Was besagt der zweite Einwand? (2 P)
- 6.c Wie funktioniert der dritte Einwand und inwiefern unterscheidet er sich vom zweiten bzw. ist radikaler als dieser? (2 P)
- 7. Wie sind der aristotelische Partikularismus und die aristotelische Objektivität \"zu vereinbaren\"? (1 P)
- 8. Wie versucht N. den zweiten Einwand zu entkräften? (2 P)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob Tugenden objektiv sind und ob es eine nicht-relativistische Auffassung der Tugendethik gibt. Die Autorin Martha Nussbaum argumentiert, dass Tugenden objektiv sind, da sie auf einem universellen Erfahrungsbereich beruhen, der allen Menschen gemeinsam ist. Sie kritisiert dabei den ethischen Relativismus, der behauptet, dass es keine allgemeingültigen moralischen Werte gibt.
- Objektivität von Tugenden
- Ethischer Relativismus vs. Nicht-relativistische Tugendethik
- Universeller Erfahrungsbereich
- Kritik an Foucault's Genealogie
- Aristotelischer Partikularismus und Objektivität
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Definition des ethischen Relativismus und einer Darstellung seiner verschiedenen Spielarten. Anschließend wird die Frage nach der Objektivität von Tugenden behandelt und die Kritik an einem nicht-relativistischen Ansatz der Tugendethik dargestellt. In den folgenden Kapiteln werden die Einwände gegen die Objektivität von Tugenden näher beleuchtet, wobei der Fokus auf dem Problem der Einzigartigkeit von Lösungen, dem gemeinsamen menschlichen Erfahrungsbereich und der Möglichkeit eines Lebens ohne bestimmte Erfahrungen liegt. Abschließend wird versucht, die Einwände zu entkräften und die Vereinbarkeit von aristotelischem Partikularismus und Objektivität zu zeigen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: ethischer Relativismus, Tugenden, Objektivität, universeller Erfahrungsbereich, Genealogie, Partikularismus, Kritik, Einwände, Aristoteles, Foucault.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2014, Fragen und Anworten zum Text „Nicht-relative Tugenden. Ein aristotelischer Ansatz“ von Martha C. Nussbaum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319698