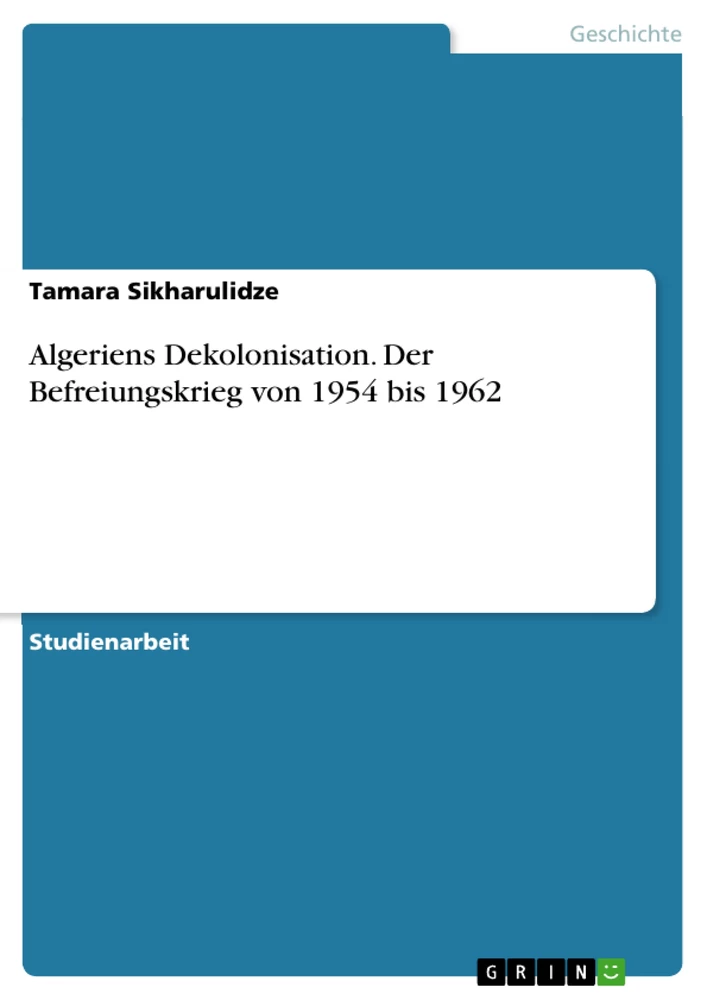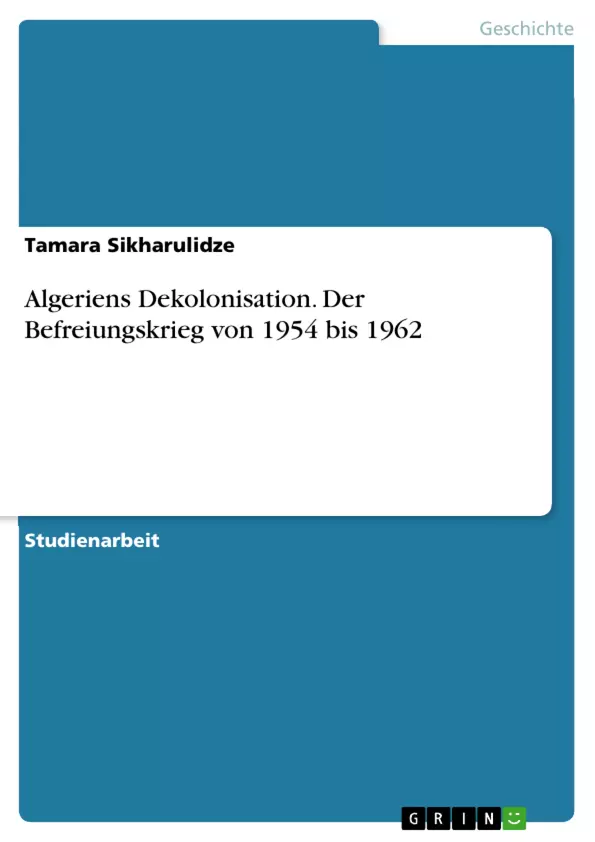Die vorliegende Hausarbeit soll verschiedene Aspekte des Algerienkrieges beleuchten. Wenn man heute durch die Straßen von Paris schlendert, fallen neben den zahllosen Touristen auf den ersten Blick viele Asiaten, Nord- und Schwarzafrikaner auf. Dass die multikulturelle Gesellschaft in Paris aber alles andere als spannungsfrei ist, haben spätestens die Unruhen in den Banlieue, den Pariser Vorstädten, im Jahre 2005 gezeigt. In diesem Jahr war die Massenarbeitslosigkeit und Resignation in den Pariser Vorstädten in einer 20-tägigen Gewaltorgie explodiert.
Die Jugendlichen, die in den Banlieues randalierten, waren überwiegend nordafrikanischer Herkunft. Ihre Eltern oder vielleicht auch schon Großeltern waren aus den ehemaligen Kolonien Frankreichs ins französische Mutterland eingewandert und vielfach in eben jeden Banlieues gestrandet. Man schätzt die Anzahl der arabischstämmigen Einwanderer heute auf etwa 4,5 Millionen. Die Randale in den Vorstädten hat so auch ein Schlaglicht auf die koloniale Vergangenheit Frankreichs geworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Frankreich seine beiden größten Kolonien Algerien und Vietnam in mehrjährigen blutigen Kriegen in die Unabhängigkeit entlassen müssen. Der für Frankreich bis heute traumatischste und als schmerzhaft empfundene Kolonialkrieg war der Algerienkrieg von 1954 bis 1962, lange Zeit der „Krieg ohne Namen“. In der vorliegenden Arbeit sollen verschiedene Aspekte des Algerienkrieges beleuchtet werden.
Der Text gliedert sich nach der Einleitung in 3 wesentliche Abschnitte. Der erste Abschnitt ist eine kurze Einführung zu Algerien. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Konflikt selbst. Nach einer kurzen Darstellung des französischen Kolonialreiches nach dem zweiten Weltkrieg wird die Entwicklung des algerischen Nationalismus aufgezeigt bis hin zur Gründung von FLN und ALN dargestellt. Anschließend werden die beiden wesentlichen Akteure, die französische Armee auf der einen und ALN/FLN auf der anderen Seite, vorgestellt. Der letzte Abschnitt, das Fazit, soll neben einer Bilanz des Krieges Aufschluss darüber geben, welche Rolle Algerien für Frankreich spielte und damit auch die Frage beantworten, warum der Algerienkrieg sich über immerhin 8 Jahre hinzog und bis in die jüngste Vergangenheit in der französischen Öffentlichkeit lediglich als „Operation um die Aufrechterhaltung der Ordnung“ bezeichnet wurde. Hier werden ebenso die Taktiken bewertet, die beide Seiten in Algerien angewendet haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Algerien als Kolonie Frankreichs
- Geographie Algeriens
- Wirtschaftliche Entwicklung Algeriens
- Industrielle Entwicklung
- Landwirtschaftliche Entwicklung
- Bevölkerungsentwicklung
- Wirtschaftliche und soziale Krise
- Der algerische Befreiungskrieg
- Frankreichs Kolonialsituation nach dem 2. Weltkrieg
- Der algerische Nationalismus
- Personelle und materielle Ausstattung der französischen Armee
- Ausgangslage der ALN
- Die Rolle der FLN
- Verlauf der militärischen Auseinandersetzung
- Der Weg zur algerischen Unabhängigkeit
- Fazit
- Die französische Interessenlage in Algerien
- Der Krieg, der keiner sein durfte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Algerienkrieg von 1954 bis 1962, einem der wichtigsten und bis heute traumatischen Ereignisse in der französischen Kolonialgeschichte. Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Aspekte des Konflikts zu beleuchten und ein tieferes Verständnis für die Hintergründe, die Entwicklung und die Folgen des Krieges zu gewinnen.
- Die Kolonialgeschichte Algeriens und die Entwicklung der französischen Interessenlage
- Die Entstehung und Entwicklung des algerischen Nationalismus
- Die militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich und der FLN/ALN
- Die Rolle des Krieges in der französischen Gesellschaft und die Folgen des Konflikts
- Die Auswirkungen des Algerienkrieges auf die Beziehungen zwischen Frankreich und Algerien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Algerienkrieg in den Kontext der französischen Kolonialgeschichte und erläutert die Relevanz des Themas. Der erste Abschnitt befasst sich mit Algerien als Kolonie Frankreichs und beleuchtet die geographischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen vor dem Ausbruch des Krieges.
Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf den algerischen Befreiungskrieg selbst. Er beleuchtet die Entwicklung des algerischen Nationalismus, die militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich und der FLN/ALN, sowie die Rolle der französischen Armee und die Strategien beider Seiten.
Das Fazit bietet eine Bilanz des Krieges und analysiert die französischen Interessen in Algerien. Es beleuchtet die Gründe für die lange Dauer des Konflikts und die Rezeption des Krieges in der französischen Öffentlichkeit.
Schlüsselwörter
Algerienkrieg, Kolonialismus, Frankreich, Algerien, FLN, ALN, Nationalismus, Unabhängigkeit, Militär, Geschichte, Krieg, Politik, Gesellschaft, Kultur, Identität, Erinnerung, Trauma.
Häufig gestellte Fragen
Wann fand der Algerienkrieg statt?
Der algerische Befreiungskrieg dauerte von 1954 bis 1962 und endete mit der Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich.
Wer waren die FLN und die ALN?
Die FLN (Front de Libération Nationale) war die politische Organisation, die den Widerstand anführte. Die ALN (Armée de Libération Nationale) war ihr militärischer Arm im Kampf gegen die französische Kolonialmacht.
Warum war der Algerienkrieg für Frankreich so traumatisch?
Algerien galt nicht als einfache Kolonie, sondern als Teil des französischen Mutterlandes. Der Krieg führte zu tiefen politischen Krisen in Frankreich, zum Ende der Vierten Republik und hinterließ tiefe Wunden in der Gesellschaft.
Was war die Rolle des algerischen Nationalismus?
Der Nationalismus entstand als Reaktion auf soziale Ungleichheit und wirtschaftliche Krisen unter der Kolonialherrschaft. Er einte die arabischstämmige Bevölkerung im Streben nach Selbstbestimmung.
Warum wurde der Konflikt lange Zeit als „Krieg ohne Namen“ bezeichnet?
Die französische Regierung vermied offiziell den Begriff „Krieg“ und sprach stattdessen von „Operationen zur Aufrechterhaltung der Ordnung“, um den Konflikt als innerstaatliches Problem darzustellen.
Wie endete der Algerienkrieg?
Der Krieg endete 1962 mit den Verträgen von Évian, die einen Waffenstillstand und ein Referendum über die Unabhängigkeit vorsahen, das mit überwältigender Mehrheit für die Souveränität Algeriens ausfiel.
- Quote paper
- Tamara Sikharulidze (Author), 2009, Algeriens Dekolonisation. Der Befreiungskrieg von 1954 bis 1962, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319776