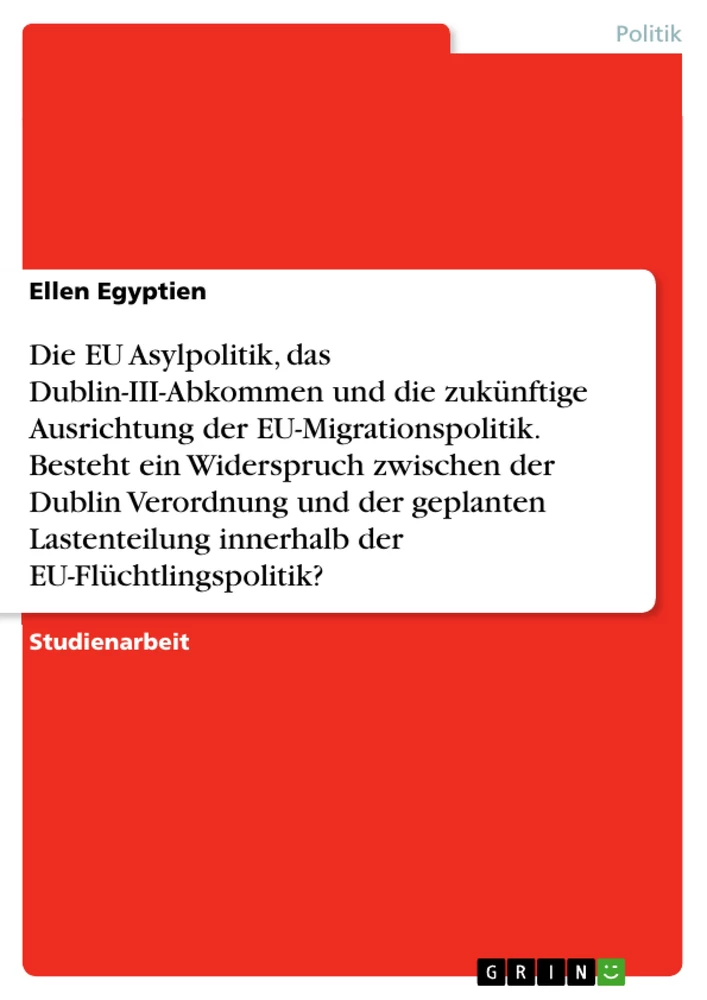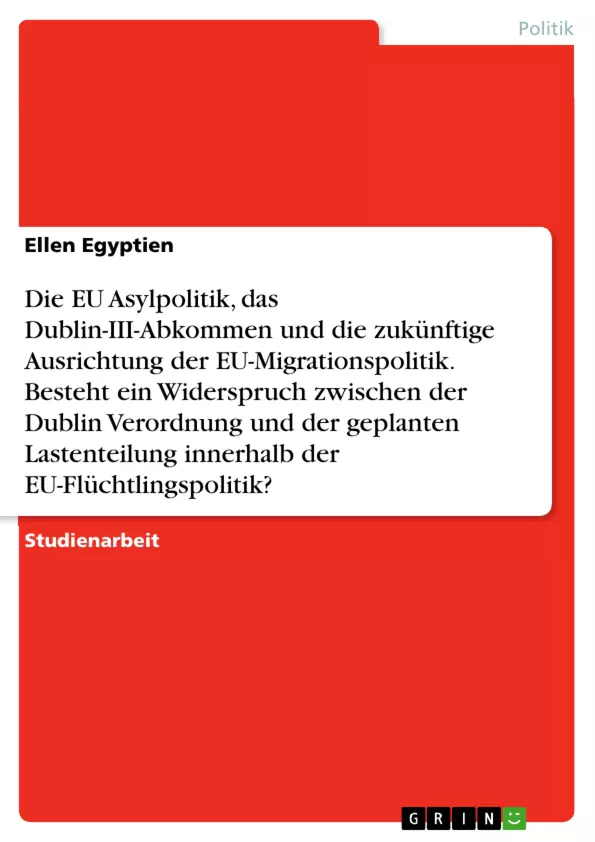Die folgende Arbeit stellt die These auf, dass eine zukünftige, gesamteuropäische Flüchtlingspolitik mit gemeinsamen Standards nur realisiert werden kann, wenn von alten, bereits bestehenden Verordnungen abgesehen wird.
Weltweit befinden sich mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten von ihnen ziehen in direkte Nachbarländer – ein vergleichsweiser kleiner, aber wachsender Teil nimmt den gefährlichen Weg nach Europa auf sich. Obschon der in die EU gelangende Teil der Menschen verglichen mit vielen anderen Ländern noch relativ klein ist, werden die bisherigen Strukturen und Verfahren der EU durch die ansteigende Zahl von Zuwanderern dennoch herausgefordert und auf die Probe gestellt. Als im Jahr 2013 die Ansätze der gemeinsamen europäischen Asylpolitik teilweise überarbeitet wurden, basierten die Verhandlungen auf die vergangene und damals gegenwärtige Zuwanderungssituation.
Das Ausmaß, welches der Flüchtlingsstrom aus sämtlichen Ländern noch erreichen würde, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht genau absehbar. Immer wieder, so auch im Mai 2015, befürwortete die Kommission aufgrund von enormen Flüchtlingsströmen die sich Richtung Europa bewegten eine Einigung der Mitgliedsstaaten bezüglich einer gemeinsamen Quotenregelung, die die Flüchtlinge auf die EU Staaten gerecht und anhand bestimmter Kriterien verteilen sollte. Dieser Lösungsvorschlag der Lastenteilung scheiterte jedoch bei den Verhandlungen im Ministerrat, da sich einige Staaten nicht dazu bereit erklären wollten, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Man konnte sich lediglich auf freiwillige Aufnahmezahlen einigen.
Trotz allem hält die Kommission weiter an ihrem Vorschlag fest, konkrete und vor allem verpflichtende Quoten zu beschließen, da dieser Schritt unter anderen Maßnahmen als eine der wichtigsten Vorgehensweisen gesehen wird, europäische Migrationspolitik gerechter für alle Mitgliedsstaaten, sowie übersichtlicher und menschenwürdiger für Flüchtlinge zu machen. Ein Problem, das diesem Vorhaben entgegensteht, sind nicht nur die nationalstaatlichen Interessen einzelner Mitgliedsstaaten, sondern auch die immer noch bestehende Dublin-III-Verordnung, die nach wie vor vorsieht, dass jeder Flüchtling nur in dem Land Anspruch auf Asyl hat, in dem er als erstes eingetroffen ist (vgl. Art. 3 & 7 VO (EU) Nr. 604/2013).
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Schlüsselbegriffe
- Einleitung und These
- Flüchtlings- und Asylbegriff
- I. Historische Entwicklung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik - Vom Binnenmarktkonzept bis zur Vergemeinschaftung
- Phase I: 1957-1990: koordinierte Politik der Mitgliedstaaten
- Phase II: 1990-1999: zwischenstaatliche Zusammenarbeit
- Phase III: 1999-heute: Migrationspolitik als echte Gemeinschaftsaufgabe
- Zwischenfazit
- II. Zoom - Die Dublin Verordnungen im Detail
- III. Die Problematik: Das zwischenstaatliche Kooperationsdilemma der EU
- Die nationalstaatliche Identität vs. Gemeinsame Werte und gegenseitige Unterstützung
- Die Dublin-III- Verordnung und deren Widerspruch zur eventuellen Quotenregelung
- Kritik am möglichen Quotensystem
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die europäische Asylpolitik und die aktuelle Flüchtlingsproblematik, insbesondere die ungerechte Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Sie analysiert die Entwicklung der Asylpolitik von der koordinierten Politik der Mitgliedstaaten bis hin zur angestrebten Gemeinschaftsaufgabe. Die Arbeit evaluiert den Vergleich zwischen bestehenden EU-Asylrechtsakten und geplanten Veränderungen, mit dem Fokus auf die Dublin-Verordnungen und mögliche Quotenregelungen.
- Entwicklung der europäischen Asylpolitik
- Die Dublin-Verordnungen und ihre Problematik
- Das Kooperationsdilemma der EU-Mitgliedstaaten
- Diskussion um Quotenregelungen zur Lastenteilung
- Konflikt zwischen nationalstaatlichen Interessen und gemeinsamen Werten
Zusammenfassung der Kapitel
Flüchtlings- und Asylbegriff: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Flüchtling“ und „Asyl“, wobei es auf die fehlende explizite Definition in EU-Verträgen hinweist und stattdessen auf das Genfer Flüchtlingsabkommen verweist. Es erläutert den Begriff des Flüchtlings gemäß Artikel 1 der Genfer Konvention und den Ursprung des Wortes „Asyl“ im Griechischen.
I. Historische Entwicklung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik - Vom Binnenmarktkonzept bis zur Vergemeinschaftung: Der Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung der europäischen Asylpolitik, beginnend mit dem Binnenmarktkonzept und dem Schengener Abkommen. Er beschreibt die verschiedenen Phasen der Asylpolitik, von der koordinierten Politik der Mitgliedstaaten über die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bis hin zur angestrebten Gemeinschaftsaufgabe. Die Bedeutung der Einheitlichen Europäischen Akte und des Konflikts nationaler Interessen wird hervorgehoben. Die Entwicklung wird als ein Prozess dargestellt, der durch langsame Fortschritte und ungelöste Herausforderungen gekennzeichnet ist.
Schlüsselwörter
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Flüchtlingskrise, EU-Asylpolitik, Migration, Lastenteilung, Dublin-III-Verordnung, Wertegemeinschaft, Genfer Flüchtlingskonvention, nationalstaatliche Interessen, gemeinsame Standards.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Europäische Asylpolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der europäischen Asylpolitik und der aktuellen Flüchtlingsproblematik, insbesondere der ungerechten Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU. Sie analysiert die historische Entwicklung der Asylpolitik und evaluiert den Vergleich zwischen bestehenden EU-Asylrechtsakten und geplanten Veränderungen, insbesondere die Dublin-Verordnungen und mögliche Quotenregelungen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der europäischen Asylpolitik, die Dublin-Verordnungen und ihre Problematik, das Kooperationsdilemma der EU-Mitgliedstaaten, die Diskussion um Quotenregelungen zur Lastenteilung und den Konflikt zwischen nationalstaatlichen Interessen und gemeinsamen Werten. Die Definition der Begriffe „Flüchtling“ und „Asyl“ wird ebenfalls erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu einem Vorwort, Schlüsselbegriffen, Einleitung und These, der Definition von Flüchtlings- und Asylbegriff, der historischen Entwicklung der gemeinsamen europäischen Asylpolitik (inkl. drei Phasen), einem Zwischenfazit, einer detaillierten Betrachtung der Dublin-Verordnungen, der Problematik des zwischenstaatlichen Kooperationsdilemmas der EU (inkl. nationalstaatlicher Identität vs. gemeinsame Werte, Dublin-III-Verordnung und Quotenregelung und Kritik am Quotensystem), einer Schlussfolgerung und einem Literaturverzeichnis.
Welche Phasen der europäischen Asylpolitik werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet drei Phasen: Phase I (1957-1990): koordinierte Politik der Mitgliedstaaten; Phase II (1990-1999): zwischenstaatliche Zusammenarbeit; Phase III (1999-heute): Migrationspolitik als echte Gemeinschaftsaufgabe.
Welche Rolle spielen die Dublin-Verordnungen?
Die Dublin-Verordnungen stehen im Mittelpunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht ihre Problematik im Kontext des zwischenstaatlichen Kooperationsdilemmas und im Hinblick auf mögliche Quotenregelungen.
Welches Kooperationsdilemma wird behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Konflikt zwischen nationalstaatlichen Interessen und dem Ziel einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, die auf gemeinsamen Werten basiert. Das Dublin-System und die Diskussion um Quotenregelungen werden als zentrale Aspekte dieses Dilemmas dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind u.a.: Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Flüchtlingskrise, EU-Asylpolitik, Migration, Lastenteilung, Dublin-III-Verordnung, Wertegemeinschaft, Genfer Flüchtlingskonvention, nationalstaatliche Interessen, gemeinsame Standards.
Wie werden Flüchtling und Asyl definiert?
Die Arbeit weist auf das Fehlen einer expliziten Definition in EU-Verträgen hin und verweist auf das Genfer Flüchtlingsabkommen und Artikel 1 der Genfer Konvention zur Definition des Flüchtlingsbegriffs. Der Ursprung des Wortes „Asyl“ im Griechischen wird ebenfalls erläutert.
- Citation du texte
- Ellen Egyptien (Auteur), 2015, Die EU Asylpolitik, das Dublin-III-Abkommen und die zukünftige Ausrichtung der EU-Migrationspolitik. Besteht ein Widerspruch zwischen der Dublin Verordnung und der geplanten Lastenteilung innerhalb der EU-Flüchtlingspolitik?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320049