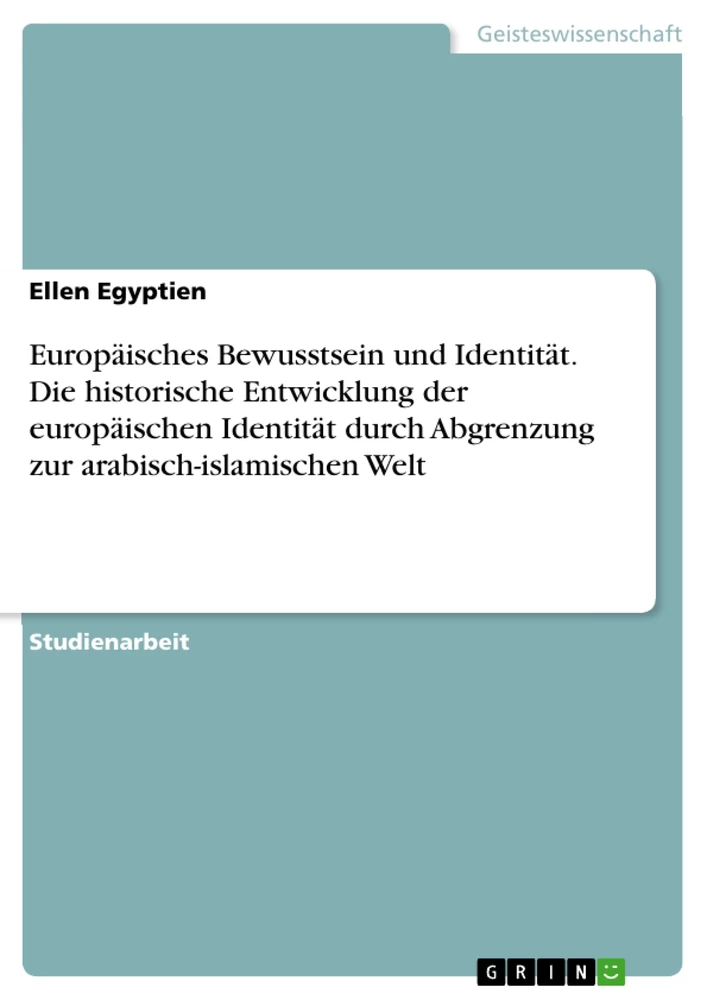Als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu im Januar 2015 eine Äußerung des früheren Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und später auch des Bundespräsidenten Christian Wulff wiederholte, war die Diskussion groß. Damals sagte sie: "Der Islam gehört zu Deutschland – und das ist so, dieser Meinung bin ich auch." Dass über diese Aussage so heftig debattiert werden würde, war absehbar. Nicht umsonst stellt sich seit jeher die Frage, in wie weit der Islam und generell die arabische Kultur den Westen mitgestalten soll. Dabei haben beide Kulturräume eine lange, eng miteinander verbundene Geschichte.
In dieser Arbeit gilt es, diese näher zu erörtern. Wie sehr oder wie wenig gegenseitiger Einfluss von unterschiedlichen europäischen Stimmen akzeptiert oder sogar gewünscht ist, ist entscheidend für den Charakter der Europa zugesprochen werden soll. Wie sich Europa selbst sieht und versteht hat großen Einfluss auf seine Wirkung nach außen. Was also soll typisch europäisch sein? Soll Europa ein einzig europäischer Kulturraum sein, oder definiert Europa sich durch multikulturelles Zusammenleben? Fakt ist, dass man wohl kaum auf einen allgemeingültigen Nenner kommen wird. Auch diese Arbeit soll nicht darauf hinauslaufen, Europa ein Identitätskonstrukt zu geben. Die These, die in folgender Argumentation allerdings aufgestellt wird, ist, dass jegliche Identitätsfindung, egal wie diese schlussendlich nun aussehen soll, sich häufig durch Abgrenzung zum „Anderen“, etwas das als Fremd betrachtet wird, entsteht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung und These
- 2. Der Identitätsbegriff: Kollektive - und nationale Identität
- 2.1. Europäisches Identitätsbewusstsein im Wandel der Zeit
- 2.2. Zwischenfazit: Fehlendes „Wir-Gefühl“ und dessen Wichtigkeit
- 3. Orient vs. Okzident? Wie sich das Morgen - und Abendland gegenseitig beeinflusst haben
- 3.3. Identitätsbildung durch Abgrenzung
- 4. Schlussfolgerung: Neue Angst - alte Vorurteile
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung der europäischen Identität und beleuchtet, wie sich diese Identität durch Abgrenzung zur arabisch-islamischen Welt formt. Sie analysiert, wie westliche und arabische Kultur sich gegenseitig beeinflusst haben und wie diese Einflüsse zu Vorurteilen und Feindbildern in der europäischen Gesellschaft geführt haben. Die Arbeit geht der Frage nach, ob und wie sich Europa durch ein multikulturelles Zusammenleben definiert oder ob es einen gemeinsamen europäischen Kulturraum anstrebt.
- Europäische Identitätsbildung und Selbstverständnis
- Einflüsse der arabisch-islamischen Welt auf die europäische Identität
- Kulturelle und gesellschaftliche Auswirkungen von Abgrenzungsprozessen
- Entstehung von Vorurteilen und Feindbildern
- Die Rolle der historischen und kulturellen Verstrickung von West und Orient
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort erläutert den Hintergrund und die Motivation der Arbeit, die sich mit der Frage der europäischen Identitätsbildung und dem Einfluss der arabisch-islamischen Welt auf diese auseinandersetzt. Kapitel 1 führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Identitätsfindung häufig durch Abgrenzung zum "Anderen" erfolgt. Kapitel 2 definiert den Identitätsbegriff und untersucht die Entwicklung des europäischen Identitätsbewusstseins im Wandel der Zeit. Kapitel 3 analysiert die gegenseitigen Einflüsse von Orient und Okzident und beleuchtet die Rolle der Abgrenzung in der Identitätsbildung.
Schlüsselwörter
Europäische Identität, Bewusstsein, Abgrenzung, Arabisch-islamische Welt, Orient, Okzident, Kulturvergleich, Vorurteile, Feindbilder, historische Einflüsse, Integration, Multikulturalität.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht die europäische Identität laut dieser Untersuchung?
Die Arbeit stellt die These auf, dass europäische Identität oft durch Abgrenzung zum „Anderen“, insbesondere zur arabisch-islamischen Welt, konstruiert wird.
Welchen Einfluss hatte der Orient auf den Okzident?
Beide Kulturräume haben eine lange, eng verwobene Geschichte. Wissenschaft, Philosophie und Handel aus der arabischen Welt haben die europäische Entwicklung maßgeblich mitgestaltet.
Warum wird über die Zugehörigkeit des Islam zu Europa so heftig debattiert?
Die Debatte berührt den Kern des europäischen Selbstverständnisses: Definiert sich Europa als exklusiv christlich-abendländischer Kulturraum oder als multikulturelle Gemeinschaft?
Was ist die Gefahr von Identitätsbildung durch Abgrenzung?
Sie führt oft zur Entstehung von Vorurteilen, Feindbildern und einer künstlichen Trennung zwischen „uns“ und „den anderen“, was die Integration erschwert.
Gibt es eine einheitliche europäische Identität?
Nein, es handelt sich um ein dynamisches Konstrukt, das sich im Wandel der Zeit immer wieder neu definiert und zwischen nationalen und kollektiven Interessen schwankt.
- Quote paper
- Ellen Egyptien (Author), 2016, Europäisches Bewusstsein und Identität. Die historische Entwicklung der europäischen Identität durch Abgrenzung zur arabisch-islamischen Welt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320050