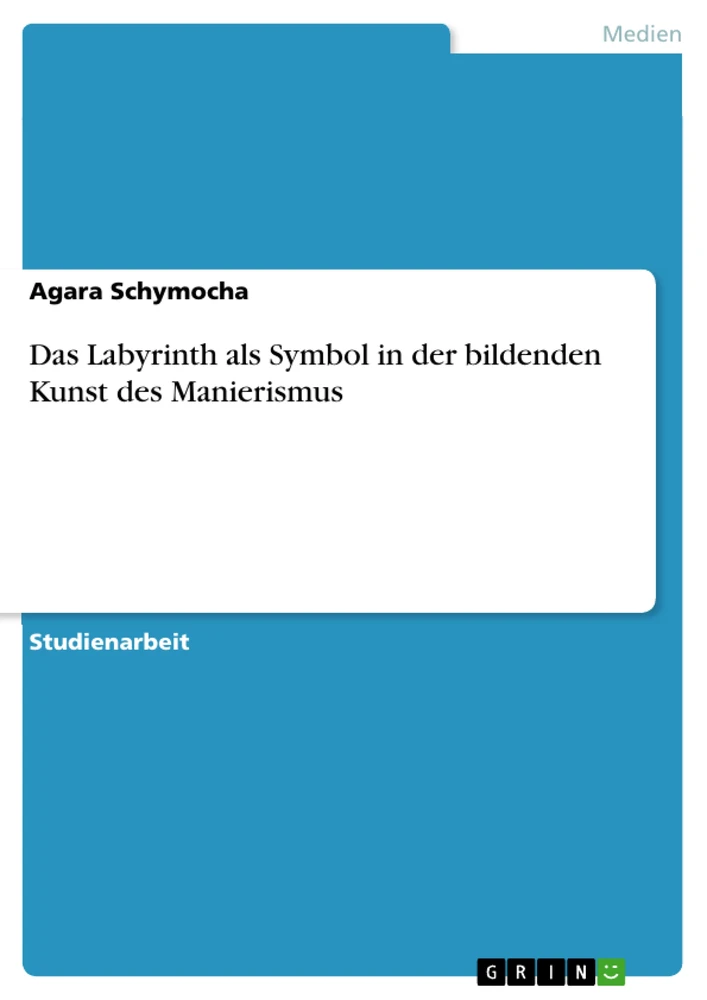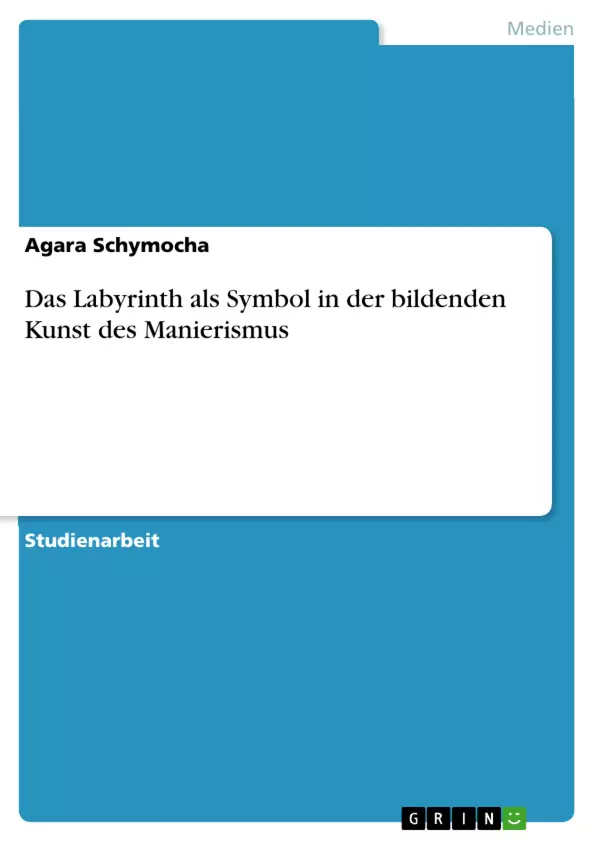Die Arbeit befasst sich mit dem Labyrinth als Metapher innerer, seelischer Ver- und Entwicklungszustände des Menschen. Den Kunsthistorikern Hocke und Curtius folgend wird die Epoche des Manierismus dabei exemplarisch herangezogen, um aus ihr ein 'manieristisches' Lebensgefühl abzuleiten. Dieses gibt sich als zyklisch wiederkehrendes Bewusstseinsmuster zu erkennen, welches insbesondere bei epochalen Übergangsprozessen – gesellschaftlich wie auch biografisch – als Indikator sowie als Katalysator dieser Übergänge dient.
Die Lektüre gewährt aus der Perspektive der Malerei einen klaren Einblick in die Epoche des Manierismus – dem Übergang der Hochrenaissance zum Barock. Dabei wird der Zusammenhang zwischen gesellschaftspolitischem Kontext und der Rolle der Künstler sowie der Entwicklung der Kunst mit ihren typischen 'manieristischen' Stilmerkmalen auf verständliche Weise dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I.) Herkunft und Formen von Labyrinthen und Irrgärten
- II.) Manierismus im 16. Jahrhundert: Historischer Kontext
- III.) Manierismus im 16. Jahrhundert: Ausdrucksformen
- IV.) Manierismus als gegenklassischer Stil
- V.) Das Labyrinth als manieristische Selbstdarstellung
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Labyrinth als Symbol innerer Zustände im Kontext des Manierismus. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Labyrinths, verbindet es mit dem Manierismus des 16. Jahrhunderts und zeigt dessen Bedeutung als Ausdruck eines "labyrinthischen" Lebensgefühls in der bildenden Kunst. Die Arbeit analysiert den Manierismus nicht nur als Stilrichtung, sondern auch als Ausdruck gesellschaftlicher und geistiger Umbrüche.
- Das Labyrinth als Symbol für Orientierungslosigkeit und Selbstfindung
- Der Manierismus als künstlerischer Ausdruck gesellschaftlicher Krisen
- Die Entwicklung des Labyrinths von der Antike bis zum Manierismus
- Der Vergleich zwischen klassischem Labyrinth und Irrgarten
- Die symbolische Bedeutung des Labyrinths im Manierismus
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Labyrinth als uraltes Symbol für den Prozess des Erkennens und verbindet es mit den Versen von T.S. Eliot. Sie führt in die Thematik ein und umreißt den Fokus der Arbeit: die Untersuchung des Labyrinths als Sinnbild innerer Zustände im Zusammenhang mit dem Manierismus, dessen "labyrinthisches" Lebensgefühl in der bildenden Kunst veranschaulicht werden soll. Die Arbeit verspricht eine Beschreibung von Labyrinthen, eine Vertiefung in den historischen Kontext des 16. Jahrhunderts und schließlich die Darstellung des Labyrinths als symbolische Manifestation des Manierismus.
I.) Herkunft und Formen von Labyrinthen und Irrgärten: Dieses Kapitel untersucht die Ursprünge des Labyrinths, beginnend mit seiner Verbindung zu antiken Tänzen und seiner Verbreitung in verschiedenen Kulturen. Es unterscheidet zwischen dem "einfachen" Labyrinth mit nur einem Weg zum Zentrum und dem Irrgarten mit mehreren Wegen und Sackgassen. Der Mythos von Theseus und dem Minotaurus wird kritisch betrachtet, da er laut Kern eine späte Geschichtsklitterung darstellt. Das Kapitel verfolgt die Entwicklung des Labyrinths über die Renaissance bis hin zum Manierismus, wo es sich in Form begehbarer Heckenanlagen in Schlossgärten manifestiert. Der Irrgarten wird als ein späteres Phänomen eingeführt, welches den Verlust der Orientierung und die zunehmende Selbstverantwortung des Menschen symbolisiert.
II.) Manierismus im 16. Jahrhundert: Historischer Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund des Manierismus. Es beschreibt die wirtschaftlichen und politischen Krisen in Italien um 1500, wie die Wirtschaftskrise in Florenz, den Verlust wichtiger Absatzmärkte und die Verschiebung der Handelswege. Die Folge war ein Rückzug des reichen Patriziats auf das Land und eine Refeudalisierung, welche die Macht und kulturelle Entwicklung von den Städten auf verschiedene Höfe verlagerte. Diese gesellschaftlichen und politischen Umbrüche bilden den Nährboden für die Entstehung des Manierismus als künstlerische und geistige Reaktion.
Schlüsselwörter
Labyrinth, Manierismus, 16. Jahrhundert, Selbstfindung, Orientierung, Irrgarten, Renaissance, Krisenbewusstsein, Symbol, Bildende Kunst, Historischer Kontext, Lebensgefühl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Manierismus und Labyrinth
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Labyrinth als Symbol innerer Zustände im Kontext des Manierismus des 16. Jahrhunderts. Sie verbindet die historische Entwicklung des Labyrinths mit dem Manierismus und zeigt dessen Bedeutung als Ausdruck eines "labyrinthischen" Lebensgefühls in der bildenden Kunst. Der Manierismus wird dabei nicht nur als Stilrichtung, sondern auch als Ausdruck gesellschaftlicher und geistiger Umbrüche analysiert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Labyrinth als Symbol für Orientierungslosigkeit und Selbstfindung, den Manierismus als künstlerischen Ausdruck gesellschaftlicher Krisen, die Entwicklung des Labyrinths von der Antike bis zum Manierismus, den Vergleich zwischen klassischem Labyrinth und Irrgarten, und die symbolische Bedeutung des Labyrinths im Manierismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Herkunft und Formen von Labyrinthen und Irrgärten, Manierismus im 16. Jahrhundert: Historischer Kontext, Manierismus im 16. Jahrhundert: Ausdrucksformen, Manierismus als gegenklassischer Stil, Das Labyrinth als manieristische Selbstdarstellung, und Schlussgedanke. Jedes Kapitel bietet eine vertiefende Auseinandersetzung mit den jeweiligen Aspekten.
Wie wird das Labyrinth in dieser Arbeit betrachtet?
Das Labyrinth wird als uraltes Symbol für den Prozess des Erkennens betrachtet und mit den Versen von T.S. Eliot in Verbindung gebracht. Es dient als Sinnbild innerer Zustände im Zusammenhang mit dem Manierismus und veranschaulicht dessen "labyrinthisches" Lebensgefühl in der bildenden Kunst. Die Arbeit unterscheidet zwischen dem einfachen Labyrinth und dem Irrgarten und verfolgt dessen Entwicklung von antiken Tänzen bis hin zu den Heckenanlagen in Schlossgärten des Manierismus.
Welchen historischen Kontext beleuchtet die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen und gesellschaftlichen Hintergrund des Manierismus im 16. Jahrhundert, insbesondere die wirtschaftlichen und politischen Krisen in Italien um 1500 (z.B. Wirtschaftskrise in Florenz, Verlust von Absatzmärkten, Verschiebung der Handelswege). Diese Umbrüche werden als Nährboden für die Entstehung des Manierismus als künstlerische und geistige Reaktion dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Labyrinth, Manierismus, 16. Jahrhundert, Selbstfindung, Orientierung, Irrgarten, Renaissance, Krisenbewusstsein, Symbol, Bildende Kunst, Historischer Kontext, Lebensgefühl.
- Citation du texte
- Agara Schymocha (Auteur), 2013, Das Labyrinth als Symbol in der bildenden Kunst des Manierismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320097