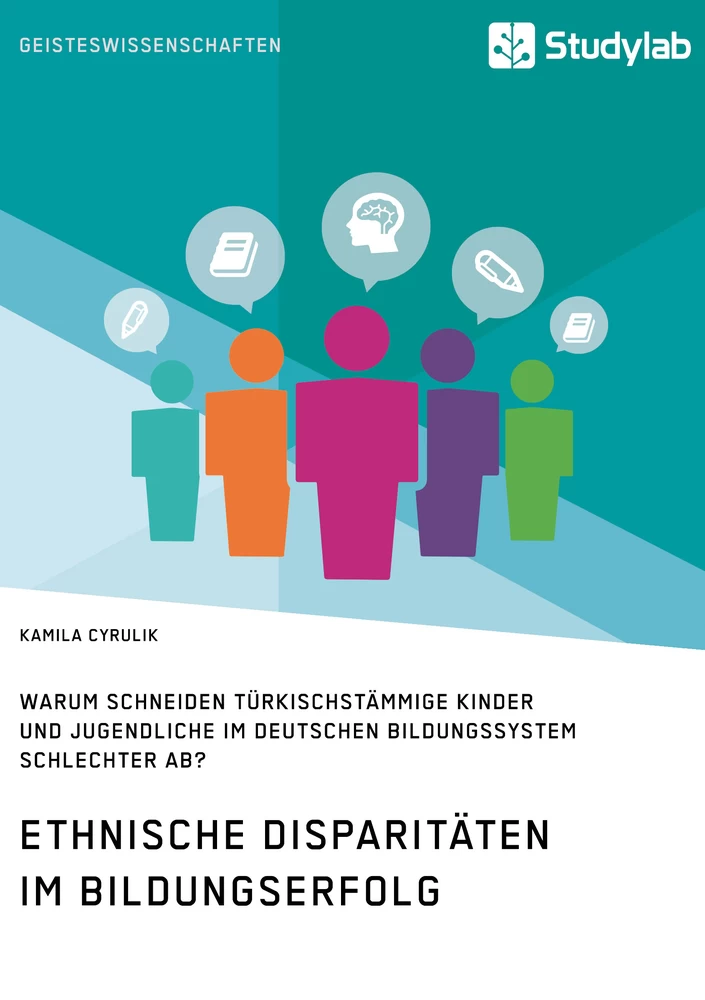Migrantenkinder in Deutschland erzielen im Durchschnitt einen geringeren Bildungserfolg als ihre deutschen Mitschüler. Oft sind Zurückstellung, Klassenwiederholungen sowie überdurchschnittlich häufige und nicht begründete Zuweisungen zu Sonderklassen die Folge. Als Konsequenz verlassen die Migrantenkinder die Schule häufiger als ihre deutschen Mitschüler ohne Abschluss und haben größere Schwierigkeiten einen Ausbildungsplatz zu finden. Innerhalb des Diskurses über die migrationsspezifischen Bildungsungleichheiten fallen vor allem die Misserfolge der türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen auf. Die Nachkommen der sogenannten „Gastarbeiter“, die in der zweiten oder weiteren Generation in Deutschland leben, scheinen besondere Schwierigkeiten in der schulischen Laufbahn zu haben.
Woran könnte dies liegen? Warum schneiden Kinder und Jugendliche aus türkischen Familien so oft schlechter ab, obwohl viele von ihnen von Geburt an in der Bundesrepublik leben und ausschließlich deutsche Bildungseinrichtungen besucht haben? Welche Faktoren sind für diese Diskrepanzen in den Schulleistungen verantwortlich?
Aus dem Inhalt:
- Migranten in Deutschland
- Theorien zur Bildungsungleichheit
- Faktoren des Bildungserfolgs
- Probleme und Ursachen
- Kritische Betrachtung empirischer Studien
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Relevanz der Thematik der Bildungsungleichheit
- Die Arbeitsmigration aus der Türkei: Migrationsgeschichte und der Lebenshintergrund der türkischen Zuwanderer
- ,,Klassische Ansätze“ zur Erklärung von Bildungsungleichheiten
- Sozioökonomische Erklärungen und Ressourcenaustattung
- Kulturalistische Erklärungen
- Stand der empirischen Forschung zu den ethnischen Bildungsungleichheiten
- Türkischstämmige Kinder in Deutschland auf den ersten Stufen des Bildungssystems
- Vorschulische Bildung und ihre Bedeutung
- Einschulung und Grundschule
- Übergang in die Sekundarstufe I
- Bildungsentscheidungen und Handlungsstrategien in den türkischen Familien
- Türkischstämmige Kinder in Deutschland auf den ersten Stufen des Bildungssystems
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der ethnischen Disparitäten im Bildungserfolg und analysiert die Ursachen dafür, warum türkischstämmige Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem schlechter abschneiden als ihre deutschen Altersgenossen.
- Analyse der Migrationsgeschichte und des Lebenshintergrundes der türkischen Zuwanderer
- Bewertung verschiedener Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten, einschließlich sozioökonomischer und kulturalistischer Faktoren
- Prüfung empirischer Studien zu den Bildungschancen türkischstämmiger Kinder in Deutschland
- Untersuchung der Rolle von familiären Bildungsentscheidungen und Handlungsstrategien
- Identifizierung von möglichen Ursachen für den Bildungserfolg türkischstämmiger Kinder und Jugendlichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Thematik der Bildungsungleichheit dar und erläutert den Fokus der Arbeit auf die Bildungschancen von türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Arbeitsmigration aus der Türkei und analysiert den Lebenshintergrund der türkischen Zuwanderer in Deutschland. Dabei werden wichtige Aspekte wie die soziale Integration, die sprachliche Situation und die Bildungskultur der türkischen Familien betrachtet.
Kapitel 3 diskutiert verschiedene „klassische Ansätze“ zur Erklärung von Bildungsungleichheiten. Es werden sowohl sozioökonomische Faktoren wie die finanzielle Situation der Familien und der Zugang zu Ressourcen, als auch kulturalistische Erklärungen, die kulturelle Unterschiede und Wertevorstellungen in den Fokus stellen, beleuchtet.
Kapitel 4 präsentiert den Stand der empirischen Forschung zu den ethnischen Bildungsungleichheiten in Deutschland. Es werden Studien und Forschungsergebnisse zu den Bildungschancen von türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen auf den verschiedenen Stufen des Bildungssystems, von der vorschulischen Bildung bis hin zur Sekundarstufe I, analysiert.
Kapitel 5 untersucht die Bildungsentscheidungen und Handlungsstrategien in den türkischen Familien und analysiert, wie diese den Bildungserfolg ihrer Kinder beeinflussen. Dabei werden verschiedene Faktoren wie die Rolle der Eltern, die Bildungsaspirationen und die Unterstützung im Bildungsprozess berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, ethnische Disparitäten, türkischstämmige Kinder und Jugendliche, Migrationsgeschichte, Lebenshintergrund, sozioökonomische Faktoren, kulturalistische Erklärungen, empirische Forschung, Bildungsentscheidungen, Handlungsstrategien, Familienstrukturen, Bildungserfolg, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben türkischstämmige Schüler oft geringeren Bildungserfolg?
Die Arbeit nennt sozioökonomische Faktoren, sprachliche Hürden sowie strukturelle Benachteiligungen im deutschen Bildungssystem als Hauptursachen.
Was sind sozioökonomische Erklärungsansätze?
Diese Ansätze führen Bildungsungleichheit auf das Einkommen, den Berufsstatus und die Ressourcenausstattung der Elternhäuser zurück.
Welche Rolle spielt die vorschulische Bildung?
Der Besuch von Kindertagesstätten ist entscheidend für den Spracherwerb und die Vorbereitung auf die Grundschule, wird aber von Migrantenfamilien teils unterschiedlich genutzt.
Gibt es eine „kulturalistische“ Erklärung für die Bildungsdisparitäten?
Kulturalistische Ansätze untersuchen, ob unterschiedliche Wertevorstellungen oder Bildungsaspirationen in den Familien den Schulerfolg beeinflussen.
Was zeigt der Stand der empirischen Forschung?
Studien belegen, dass Kinder mit Migrationshintergrund bereits beim Übergang in die Sekundarstufe I häufiger auf Hauptschulen empfohlen werden, selbst bei gleichen Leistungen.
- Quote paper
- Kamila Cyrulik (Author), 2015, Ethnische Disparitäten im Bildungserfolg. Warum schneiden türkischstämmige Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem schlechter ab?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320100