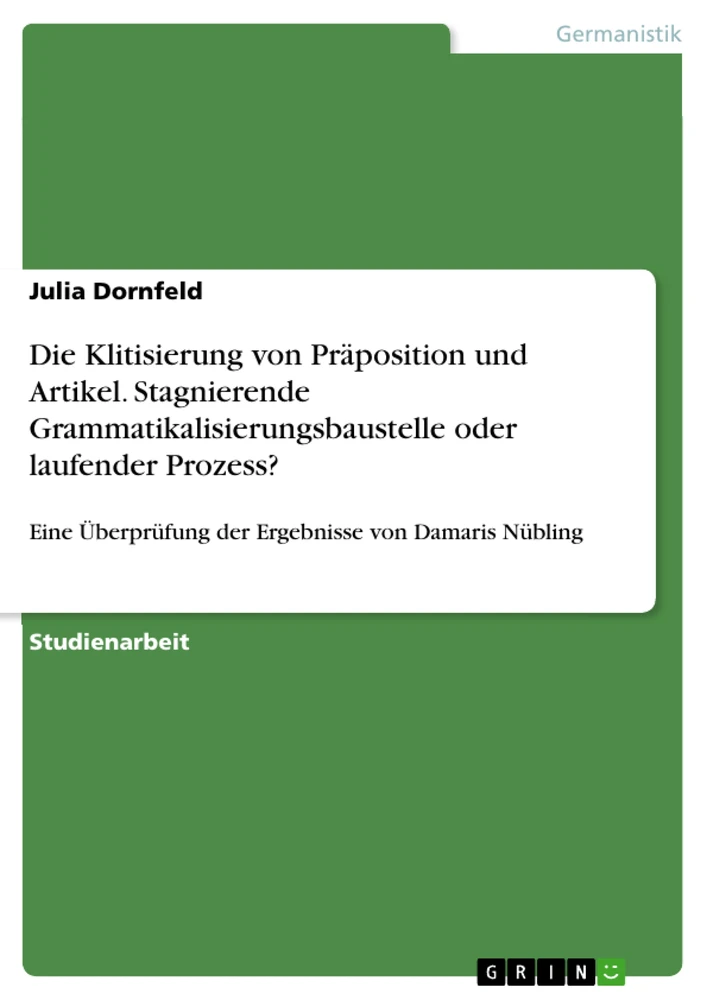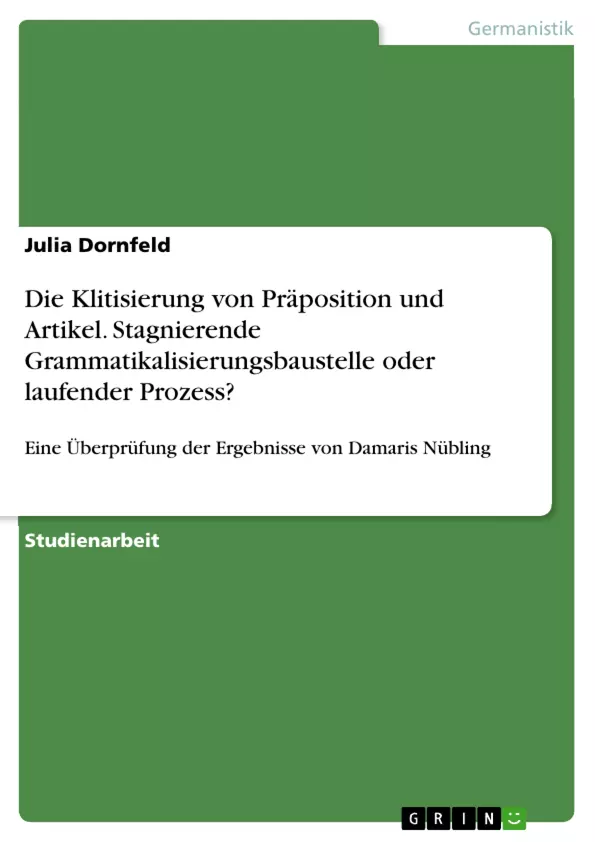Der Duden ordnet die Präpositionen in der deutschen Sprache den unflektierbaren Wortarten zu. Dabei gibt es im Deutschen einige Präpositionen-Artikel-Enklitika, die auf eine Entwicklung hin zu flektierenden Präpositionen hinweisen könnten.
Obwohl es schon im Althochdeutschen „zu Kontraktionen und Zusammenschreibungen zwischen Präposition und Artikel“ kam, findet dieses Phänomen erst seit einigen Jahren in der deutschen Sprachforschung Beachtung. SCHIERING sieht den Grund hierfür in der Heterogenität des Phänomens: Es gibt im heutigen Deutsch einige Verschmelzungsformen, die bereits obligatorisch sind, andere existieren als Varianten neben den unverschmolzenen Formen und einige Formen sind generell blockiert und lassen sich nicht miteinander verbinden.
Beim Versuch dieses Phänomen einzuordnen, war in der Forschung von rein phonologischer Klitisierung bis hin zur Flexion die Rede. Seit der Grammatikalisierungsforschung, die sich mit dem diachronen Prozess beschäftigt, bei dem aus Funktionswörtern und Inhaltswörtern Flexionsmorphologie entsteht, lässt sich das Phänomen besser einordnen. Es ist in der Forschung unbestritten, dass sich die Präposition-Artikel-Enklise mit den Parametern von LEHMANN beschreiben lässt und somit als Grammatikalisierung zu benennen ist.
Da es jedoch einige Präpositionen und Artikel gibt, die nicht verschmelzen, sondern eine Verschmelzungsblockade darstellen, entsteht eine Lücke im Paradigma, die in der Grammatikalisierungsforschung für Diskussion sorgt und den grammatischen Status dieser Formen in Frage stellt.
Insbesondere NÜBLING hat sich in ihrem Aufsatz „Von in die über in’n und ins bis im. Die Klitisierung von Präposition und Artikel als ‚Grammatikalisierungsbaustelle‘“ (2005) mit der Einordnung des Phänomens in die Grammatikalisierungsforschung beschäftigt und schließt ihre Untersuchungen mit der Behauptung, dass die Grammatikalisierung dieses Phänomens seit Jahrhunderten stagniere und in gewisser Hinsicht sogar rückläufig sei. Bei ihrer Untersuchung hat sie sich jedoch auf die synchrone Betrachtung von schriftsprachlichem Material beschränkt und erwähnt, dass eine diachrone Untersuchung und die Einbeziehung der gesprochenen Umgangssprache weitere Erkenntnisse liefern könnten. Daher sollen in der vorliegenden Arbeit zunächst die Ergebnisse von NÜBLING dargestellt und durch eine diachrone Betrachtung ergänzt werden. Schließlich werden die bisherigen Ergebnisse durch die Untersuchung eigener empirischer Daten überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1. NÜBLINGS Grammatikalisierungsbaustelle – synchrone Betrachtung
- 2.2. Ergänzungen durch CHRISTIANSEN – diachrone Betrachtung
- 3. Empirische Untersuchung
- 3.1. Korpus und Methode
- 3.2. Quantitative Analyse
- 3.3. Qualitative Analyse
- 4. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Klitisierung von Präpositionen und Artikeln im Deutschen, insbesondere die Frage, ob es sich dabei um einen stagnierenden oder laufenden Grammatikalisierungsprozess handelt. Die Arbeit überprüft und erweitert die Ergebnisse von Damaris Nübling, indem sie deren synchrone Betrachtung mit einer diachronen Analyse ergänzt und eigene empirische Daten aus der Forenkommunikation einbezieht.
- Analyse der synchronen und diachronen Entwicklung der Präposition-Artikel-Klitisierung
- Bewertung der These einer stagnierenden Grammatikalisierung
- Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Klitisierung (z.B. Kookkurrenzfrequenz, Sonorität)
- Auswertung empirischer Daten aus der Forenkommunikation
- Vergleich der Ergebnisse mit bestehenden Forschungsarbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Präposition-Artikel-Klitisierung ein und beschreibt den Forschungsstand. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der traditionellen Einstufung von Präpositionen als unflektierbar und der Existenz von Präpositionen-Artikel-Enklitika hervor. Die Arbeit von Damaris Nübling, die eine Stagnation der Grammatikalisierung postuliert, wird als Ausgangspunkt genannt. Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, Nüblings Ergebnisse durch die Einbeziehung diachroner Perspektiven und eigener empirischer Daten aus Forenkommunikation zu überprüfen.
2. Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Zuerst werden Nüblings Ergebnisse zur synchronen Betrachtung der Klitisierung detailliert dargestellt, einschließlich ihrer Kategorisierung in spezielle und einfache Klitika und der Analyse der Einflussfaktoren wie Kookkurrenzfrequenz und Sonorität. Anschließend werden die diachronen Ergänzungen von Christiansen vorgestellt, der den Prozess der Grammatikalisierung von Mittelhochdeutsch bis ins Frühneuhochdeutsch untersucht und die Entwicklung verschiedener Klitisierungsschichten aufzeigt. Die beiden Ansätze liefern unterschiedliche Perspektiven auf den Grammatikalisierungsprozess.
3. Empirische Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die eigene empirische Untersuchung. Es wird die Methodik der Korpusanalyse erläutert, wobei der Fokus auf Daten aus drei verschiedenen Online-Foren liegt. Die quantitative Analyse vergleicht die Häufigkeit der Klitika im eigenen Korpus mit den Ergebnissen von Nübling. Die qualitative Analyse untersucht Besonderheiten der gefundenen Klitika, wie z.B. die Verwendung im Kontext semantischer Definitheit und die Auftretenshäufigkeit in verschiedenen Foren. Es werden interessante Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den untersuchten Foren und der Arbeit von Nübling aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Präposition-Artikel-Klitisierung, Grammatikalisierung, synchrone und diachrone Analyse, Kookkurrenzfrequenz, Sonorität, spezielle und einfache Klitika, Forenkommunikation, konzeptionelle Mündlichkeit, Damaris Nübling, Mads Christiansen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Präposition-Artikel-Klitisierung
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Klitisierung von Präpositionen und Artikeln im Deutschen. Im Fokus steht die Frage, ob dieser Prozess stagniert oder weiterhin fortschreitet (Grammatikalisierung).
Welche Forschungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die synchrone Betrachtung der Klitisierung nach Damaris Nübling mit einer diachronen Analyse, die die Entwicklung von Mittelhochdeutsch bis ins Frühneuhochdeutsch (Mads Christiansen) einbezieht. Eigene empirische Daten aus der Forenkommunikation ergänzen die bestehenden Ansätze.
Welche Daten werden verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf Daten aus drei verschiedenen Online-Foren. Diese Daten werden quantitativ (Häufigkeitsvergleiche mit Nüblings Ergebnissen) und qualitativ (Analyse von Besonderheiten der Klitika im Kontext) ausgewertet.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Korpuslinguistik-Methoden, sowohl quantitative als auch qualitative Analysen. Die quantitative Analyse vergleicht die Häufigkeiten von Klitika, während die qualitative Analyse den Kontext und die Verwendung der Klitika untersucht.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse der Forendaten. Diese werden mit den Ergebnissen von Nübling und Christiansen verglichen, um die These einer stagnierenden Grammatikalisierung zu bewerten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Entwicklung der Präposition-Artikel-Klitisierung im Deutschen, basierend auf der Kombination synchroner und diachroner Perspektiven sowie eigener empirischer Daten. Die Bewertung der These einer stagnierenden Grammatikalisierung steht im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Präposition-Artikel-Klitisierung, Grammatikalisierung, synchrone und diachrone Analyse, Kookkurrenzfrequenz, Sonorität, spezielle und einfache Klitika, Forenkommunikation, konzeptionelle Mündlichkeit, Damaris Nübling, Mads Christiansen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Hintergrund (mit synchroner und diachroner Betrachtung), eine empirische Untersuchung (mit quantitativer und qualitativer Analyse) und ein Fazit mit Ausblick.
- Quote paper
- Julia Dornfeld (Author), 2015, Die Klitisierung von Präposition und Artikel. Stagnierende Grammatikalisierungsbaustelle oder laufender Prozess?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320211