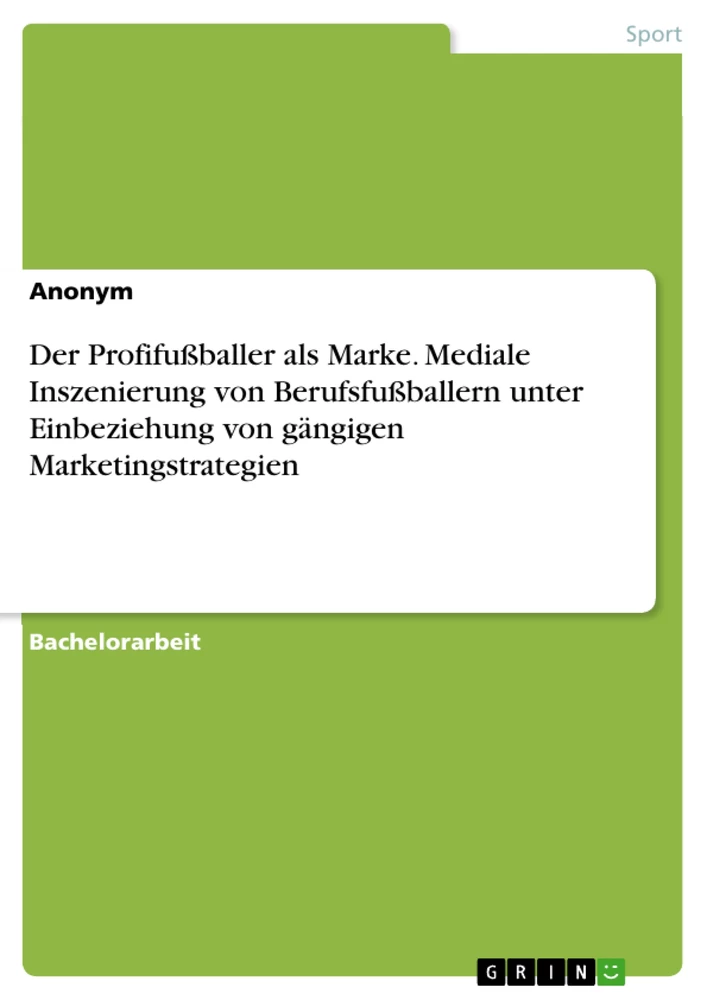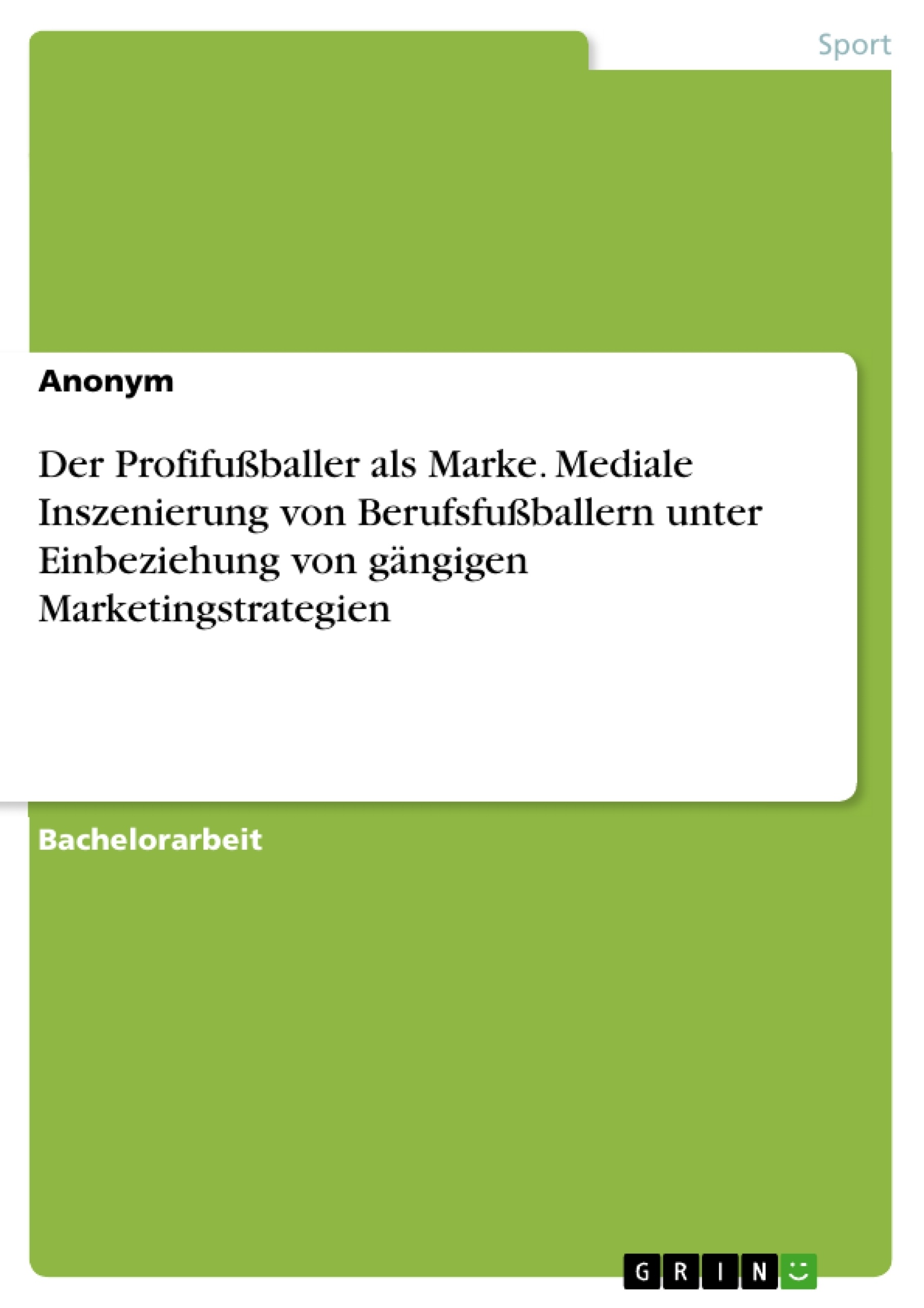Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der medialen Inszenierung von Berufsfußballern unter der Berücksichtigung von gängigen Marketingstrategien und geht der Frage nach, inwieweit die Vermarktungsmöglichkeiten angehender Profifußballer gesteigert werden können, welche angesichts einer zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung im Profifußball einen immer höheren Stellenwert erlangen und unter Berücksichtigung welcher Parameter dieses stattfindet.
Ausgangspunkt bildet hierbei der Befund, dass die Werbung für Unternehmen einen wichtigen Teil bei der Vermarktung und Platzierung ihrer Produkte darstellt und eine immer größer werdende Bedeutung einnimmt, um den Bekanntheitsgrad der unternehmenseigenen Marke zu steigern. In Folge dessen setzen Unternehmen bei der Vermarktung ihres Produkts gezielt auf Prominente als Mensch als Marke, um eine Markenverbindung zwischen den Eigenschaften des Prominenten und denen des Produkts herzustellen. Ziel der Unternehmen ist es, ihr Produkt mit Hilfe des Prominenten image- und daraus resultierend gewinnsteigernd zu bewerben und beim Konsumenten ein Markenvertrauen aufzubauen.
Dabei bedienen sich Unternehmen zu großen Teilen an Spitzensportlern als Werbeträger. Insbesondere im Bereich des Fußballs, als Deutschlands Volkssport Nummer Eins, stellt die professionelle Vermarktung von Fußballprofis durch die Professionalisierung und Kommerzialisierung des Fußballs in den letzten Jahrzehnten einen Großteil dessen dar und erfreut sich bei den Unternehmen großer Beliebtheit als Werbeträger (Herzberger, 2003). Die Testimonialwerbung, bei der sich das Unternehmen an der Bekanntheit bzw. dem Image einer berühmten Persönlichkeit oder eines Sportlers bedient und ihn instrumentalisiert, um wiederum die Bekanntheit des eigenen Produktes zu steigern, damit Unternehmensziele erreicht werden können. Dieser Ansatz gilt als modernes identitätsorientiertes Marketingkonzept. Vorbei sind die Zeiten, als sich der Verdienst von Berufsfußballern fast ausnahmelos durch Spielergehälter und Spielerprämien der Vereine zusammensetzte. Mittlerweile zählen die lukrativen Werbeeinnahmen bestimmter Fußballstars zu einer der Haupteinnahmequellen und übersteigen nicht selten das Gehalt, welches der Spieler vom Verein erhält.
Inhaltsverzeichnis
- Synopsis
- 1. Vorgehensweise
- 2. Professionalisierung der Sportart Fußball
- 3. Mensch als Marke
- 3.1 Testimonialwerbung
- 4. Bedingungsfelder für die erfolgreiche Vermarktung eines Fußballers
- 4.1 Sportlicher Erfolg
- 4.2 Bekanntheit und Medienpräsenz
- 4.3 Persönlichkeit und Image
- 4.4 Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit
- 4.5 Attraktivität
- 5. Schlussfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die mediale Inszenierung von Berufsfußballern im Kontext gängiger Marketingstrategien. Sie befasst sich mit der Frage, wie die Vermarktungsmöglichkeiten von aufstrebenden Profifußballern optimiert werden können, angesichts der zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung des Profifußballs.
- Die Bedeutung von Testimonials in der Werbung und die Verbindung von Marken mit prominenten Persönlichkeiten.
- Die Faktoren, die die Vermarktung eines Fußballers als Marke beeinflussen, wie sportlicher Erfolg, Bekanntheit, Persönlichkeit und Image.
- Die Rolle der Medien und der medialen Inszenierung im Aufbau eines starken Markenimages für einen Fußballspieler.
- Die Analyse von Marketingstrategien, die die Werbewirksamkeit eines Fußballspielers steigern können.
- Die Untersuchung des Konzepts "Mensch als Marke" im Kontext des Profifußballs.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einem kurzen historischen Abriss der Professionalisierung des Fußballs und stellt exemplarische Fußballspieler aus verschiedenen Epochen vor. Anschließend wird das moderne Marketingkonzept "Mensch als Marke" eingeführt und auf die Besonderheiten der Vermarktung von Sportlern, insbesondere Fußballern, eingegangen. Die Kapitel beleuchten die verschiedenen Faktoren, die die Vermarktung eines Fußballers als Marke beeinflussen, wie sportlicher Erfolg, Bekanntheit, Persönlichkeit und Image. Dabei werden die Auswirkungen der medialen Inszenierung und die Bedeutung von Testimonialwerbung im Profifußball untersucht. Die Arbeit analysiert die Wechselwirkungen zwischen den Markenkonzepten von Produkt und Spieler und untersucht, welche Faktoren die Werbewirksamkeit eines Fußballers bestimmen.
Schlüsselwörter
Profifußball, Marketing, Markenbildung, Testimonialwerbung, Medieninszenierung, Mensch als Marke, Sportlermarketing, Werbewirksamkeit, Kommerzialisierung, Professionalisierung, Fußballer-Image.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept „Mensch als Marke“ im Fußball?
Es beschreibt die gezielte Vermarktung der Persönlichkeit und des Images eines Fußballprofis, um ihn als eigenständige Marke zu etablieren, die unabhängig vom Verein Werbeeinnahmen generiert.
Was ist Testimonialwerbung?
Dabei nutzt ein Unternehmen die Bekanntheit und das positive Image eines Prominenten (hier eines Fußballers), um das eigene Produkt glaubwürdiger und attraktiver zu machen.
Welche Faktoren sind für die erfolgreiche Vermarktung eines Fußballers wichtig?
Zu den wichtigsten Parametern zählen sportlicher Erfolg, hohe Medienpräsenz, eine ausgeprägte Persönlichkeit, Glaubwürdigkeit sowie optische Attraktivität.
Warum übersteigen Werbeeinnahmen oft das Gehalt der Spieler?
Durch die zunehmende Kommerzialisierung suchen Unternehmen nach globalen Werbeträgern. Top-Stars erreichen durch soziale Medien und globale TV-Präsenz Millionen Menschen, was sie für Sponsoren extrem lukrativ macht.
Wie beeinflussen Medien das Image eines Profifußballers?
Medien sorgen für die notwendige Inszenierung. Durch gezielte Platzierung in Sport- und Lifestyle-Medien wird ein spezifisches Image aufgebaut, das die Werbewirksamkeit des Spielers erhöht.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Der Profifußballer als Marke. Mediale Inszenierung von Berufsfußballern unter Einbeziehung von gängigen Marketingstrategien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320442