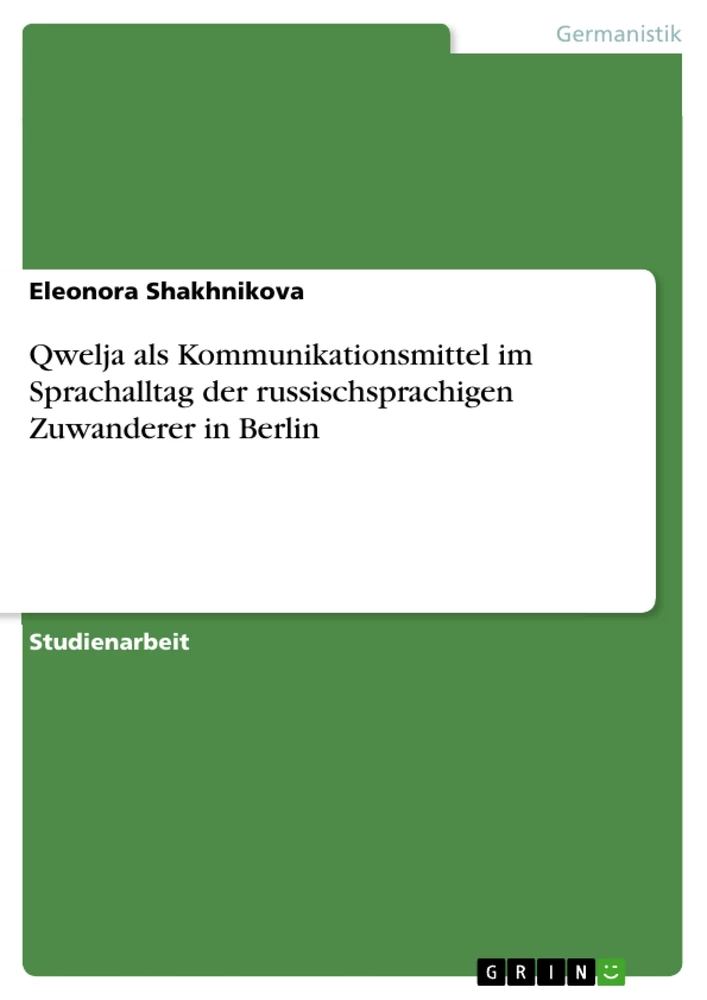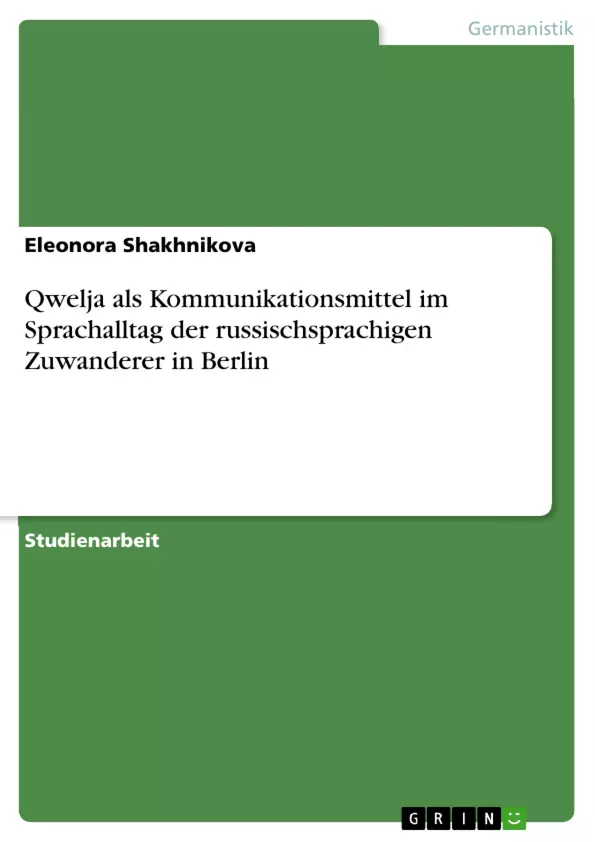Diese Hausarbeit versteht sich als Beitrag zu einer Diskussion über die Entwicklung der deutsch-russischen Mischsprache Qwelja in Deutschland. Mit dieser Arbeit wird versucht, die Bedeutung der Untersuchung des Problems der Hybridwortbildung zu betonen und gleichzeitig einen Beitrag zur Entwicklung der allgemeinen Theorie der Wortbildung in der Emigrantensprache zu leisten. Kultur- und Sprachwissenschaftler, Historiker und Soziologen erforschen verschiedene Aspekte der Existenz und Integration von russischsprachigen Migranten. Das soziolinguistische Phänomen Qwelja zeigt die Probleme der Zweisprachigkeit bei den russischsprachigen Einwanderern, die schon eine lange Zeit in Deutschland leben.
Die Arbeit geht hauptsächlich der Frage nach, ob und inwieweit die Sprache der russischsprachigen Zuwanderer in Deutschland entwicklungs- und lebensfähig ist. Sie hat zum Ziel, die auf der Basis der Verbindungen von exogenen (russischen) und endogenen (deutschen) Elementen gebildeten Einheiten der deutsch-russischen Lexik der russischsprachigen Zuwanderer, deren Sprachgebrauch und Veränderungen des Sprachstands unter den Verhältnissen des Emigrantenlebens in Deutschland zu untersuchen. Ein weiteres Ziel ist die exemplarische Beschreibung der Entstehung, Entwicklung und Ausprägung von deutsch-russischer Mischsprache unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen von Migration. Die Grundlage für eine solche Verbindung bildet die Erscheinung der Hybridwortbildung, die teilweise ein Ergebnis der Lehnübersetzung darstellt. Die vorliegende Arbeit beinhaltet die Präsentation der Kompilation von Forschungs- und Literaturrecherchen sowie auch Beispiele aus dem alltäglichen Sprachgebrauch von russischsprachigen Zuwanderern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Vorklärung
- Definition Mischsprache
- Gründe der Entstehung von Qwelja („Kwelja“)
- Einige Merkmale des Deutschrussischen
- Funktionen und Verwendung von Qwelja
- Beispiele des alltäglichen praktischen Sprachgebrauchs von Qwelja
- Beispiele der gesprochenen Sprache
- Inserate in den russischsprachigen Printmedien
- Die Lebensfähigkeit des Deutschrussischen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die deutsch-russische Mischsprache, die von russischsprachigen Zuwanderern in Deutschland verwendet wird. Sie analysiert die Entstehung, Entwicklung und Ausprägung dieser Sprache unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen von Migration. Ein weiteres Ziel ist es, die Lebensfähigkeit der deutsch-russischen Mischsprache zu beleuchten.
- Entstehung und Entwicklung der deutsch-russischen Mischsprache
- Merkmale und Struktur der Sprache russischsprachiger Migranten
- Funktionen und Verwendung der deutsch-russischen Mischsprache
- Beispiele des alltäglichen Sprachgebrauchs in Berlin
- Lebensfähigkeit der deutsch-russischen Mischsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel erklärt den Begriff Mischsprache. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Gründen der Entstehung der deutsch-russischen Hybridsprache. Das vierte Kapitel beschreibt die Merkmale und die Struktur der Sprache russischsprachiger Migranten in Deutschland. Das fünfte Kapitel widmet sich der Funktion der deutsch-russischen Mischsprache. Das sechste Kapitel präsentiert Beispiele des alltäglichen Sprachgebrauchs der russischsprachigen Migranten in Berlin anhand von Anzeigen in der Presse und mündlicher Rede.
Schlüsselwörter
Deutsch-Russisch, Mischsprache, Migrantenlinguistik, Sprachwandel, Interkulturelle Kommunikation, russischsprachige Zuwanderer, Berlin, Lebensfähigkeit, Hybridwortbildung, Ex-UdSSR, Soziolekt
Häufig gestellte Fragen
Was ist Qwelja?
Qwelja (oder Kwelja) ist eine deutsch-russische Mischsprache, die sich im Alltag russischsprachiger Zuwanderer in Deutschland entwickelt hat.
Wie entsteht eine solche Mischsprache?
Sie basiert auf der Verbindung von russischen (exogenen) und deutschen (endogenen) Elementen, oft durch Hybridwortbildung und Lehnübersetzungen.
Wo wird Qwelja im Alltag verwendet?
Die Sprache findet sich sowohl in der mündlichen Kommunikation als auch in schriftlichen Inseraten russischsprachiger Printmedien in Berlin.
Ist das Deutschrussische dauerhaft lebensfähig?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert, inwieweit die Sprache unter den Bedingungen der Migration entwicklungsfähig bleibt.
Welche wissenschaftlichen Disziplinen beschäftigen sich mit diesem Phänomen?
Vor allem die Migrantenlinguistik, Soziolinguistik und Kulturwissenschaften erforschen die Aspekte der Integration und des Sprachwandels.
- Quote paper
- Eleonora Shakhnikova (Author), 2015, Qwelja als Kommunikationsmittel im Sprachalltag der russischsprachigen Zuwanderer in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320480