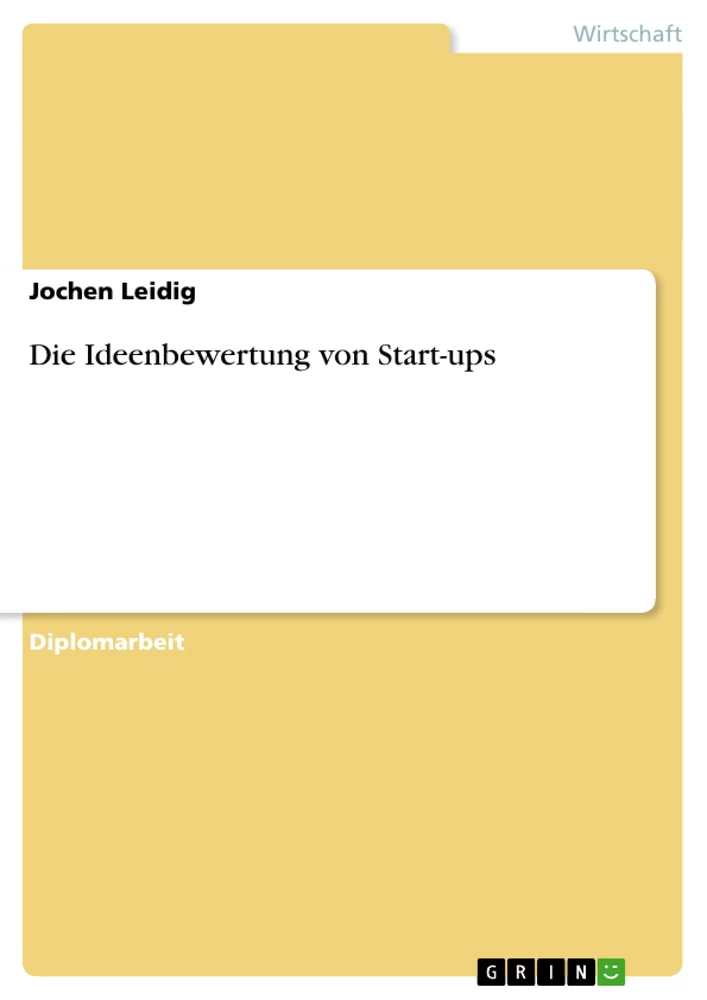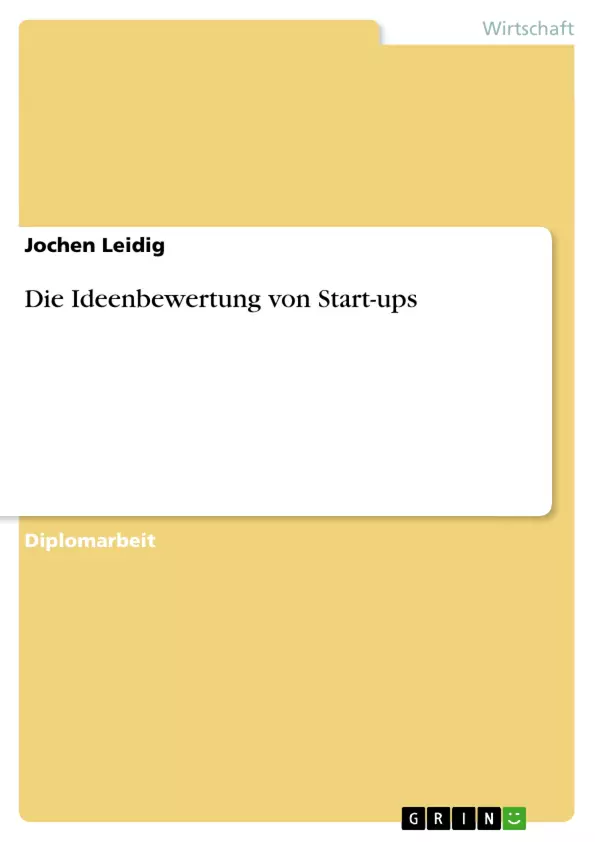1. Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Betriebswirtschaftslehre widmete sich bis weit ins letzte Viertel des vergangenen Jahrhunderts vor allem der Welt der Großunternehmen. Dies wird durch einen Vergleich anhand der aktuellen Ausgabe des Handwörterbuchs der Betriebswirtschaftslehre deutlich: Auf 5000 Seiten wird der Entrepreneur einmal erwähnt – genauso oft wie die Personengruppe der Sänger, die Organisationsform des Kibuzzes und die Jagd- und Fischereisteuer. Von etwa 400 Beiträgen widmet sich nur einer dem Thema Gründung.1
So wurden in der klassischen Betriebswirtschaftslehre Prozesse und die Zusammenarbeit von Personen effizient gestaltet, Material- und Finanzströme rationalisiert und versucht, die Beziehungen zwischen Beschaffungs- und vor allem Absatzmärkten zu optimieren.2 Im Vordergrund stand somit die Optimierung, Rationalisierung und die Steigerung der Effektivität des bestehenden Unternehmens.
Bei dieser Betrachtungsweise wurde jedoch unterschlagen, dass Unternehmen und Innovationen nicht einfach aus dem Nichts auftauchen, sondern dass diese aktiv von Entrepreneuren3, die damit „schöpferische Zerstörung“4 begehen, gestaltet werden müssen. Neue Unternehmungen und deren Innovationen stehen außerhalb der betrieblichen Routine und passen nicht zu den optimierten Prozessen von etablierten Unternehmen.5
Die Bedeutung dieser Prozesse nimmt vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland und anderen Ländern zu; denn es sind vor allem die kleinen, neu geschaffenen Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen.6 Analysen der Beschäftigung in Europa und den USA bestätigen, dass die Großunternehmen jedes Jahr netto Arbeitsplätze abbauen. In den USA waren dies in den Jahren zwischen 1980 und 2000 mehr als fünf Millionen Stellen, die von den Top-500-Unternehmen gestrichen wurden. Im gleichen Zeitraum wurden im Gegenzug durch schnell wachsende Neugründungen in den USA 34 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Neue Unternehmungen dienen auch noch in anderer Weise dem Wohlstand, indem sie Innovationen schaffen. Die meisten radikalen Innovationen, wie z.B. das elektrische Licht, werden meist nicht von bestehenden Großunternehmen geschaffen, sondern stammen fast immer von neugegründeten, innovativen Start-ups .7 [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Anlass der Ideenbewertung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Definitionen und Zusammenhänge der zentralen Begriffe
- Die Start-up-Idee
- Erfolg und Ideenbewertung
- Start-up und Gründungsunternehmen
- Formen der Unternehmensgründung
- Die Ideenbewertung im Start-up-Prozess
- Einordnung der Ideenbewertung in den Start-up-Prozess
- Businessplan und Ideenbewertung
- Ideenbewertung im Zusammenhang mit Start-ups und Innovationen
- Determinanten der Ideenbewertung von Start-ups
- Prozess der Ideenbewertung
- Grenzen und Probleme der Ideenbewertung von Start-ups
- Ideenbewertung und Strategie
- Chancen und Risiken bei der Ideenbewertung und -verwirklichung von Start-ups
- Risiken und Unsicherheiten der Ideenbewertung
- Risiken und Unsicherheiten der Ideenverwirklichung
- Bewertungsbereiche und Erfolgsfaktoren
- Bestimmung der relevanten Bewertungsbereiche
- Bewertungsbereich und Erfolgsfaktoren „Gründer“
- Bewertungsbereich und Erfolgsfaktoren „Technologie“
- Bewertungsbereich und Erfolgsfaktoren „Markt“
- Zusammenführung der Erfolgsfaktoren zu einem ganzheitlichen Bewertungsmodell
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Ideenbewertung von Start-ups und zielt darauf ab, ein ganzheitliches Bewertungsmodell zu entwickeln. Ziel ist es, die relevanten Bewertungsbereiche und Erfolgsfaktoren zu identifizieren und in einem praxisorientierten Modell zusammenzuführen.
- Der Prozess der Ideenbewertung im Start-up-Kontext
- Die Bedeutung des Businessplans für die Ideenbewertung
- Die Rolle von Innovationen bei der Ideenbewertung
- Die Identifizierung von Erfolgsfaktoren in verschiedenen Bewertungsbereichen
- Die Entwicklung eines ganzheitlichen Bewertungsmodells für Start-up-Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit dar. Anschließend werden wichtige Begriffe wie Start-up-Idee, Erfolg und Ideenbewertung definiert und in ihren Kontext gesetzt. Im dritten Kapitel wird die Ideenbewertung im Start-up-Prozess eingeordnet und die Bedeutung des Businessplans für die Bewertung hervorgehoben. Es werden die Determinanten der Ideenbewertung von Start-ups sowie deren Chancen und Risiken diskutiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den relevanten Bewertungsbereichen und Erfolgsfaktoren für Start-ups. Dabei werden die Bereiche „Gründer“, „Technologie“ und „Markt“ näher beleuchtet und die jeweiligen Erfolgsfaktoren herausgearbeitet.
Im fünften Kapitel wird ein ganzheitliches Bewertungsmodell für Start-up-Ideen vorgestellt, welches die in den vorherigen Kapiteln identifizierten Erfolgsfaktoren zusammenführt.
Schlüsselwörter
Start-up, Ideenbewertung, Businessplan, Innovation, Erfolgsfaktoren, Bewertungsbereiche, ganzheitliches Bewertungsmodell, Gründer, Technologie, Markt.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Ideenbewertung für Start-ups so wichtig?
Da Start-ups außerhalb etablierter Routinen agieren, hilft eine systematische Bewertung dabei, die Erfolgsaussichten einer Innovation frühzeitig einzuschätzen und Risiken zu minimieren.
Welche drei Hauptbereiche werden bewertet?
Die Arbeit identifiziert die Bereiche „Gründer“ (Persönlichkeit/Kompetenz), „Technologie“ (Innovationsgrad/Umsetzbarkeit) und „Markt“ (Potenzial/Wettbewerb) als entscheidend.
Welche Rolle spielt der Businessplan bei der Ideenbewertung?
Der Businessplan dient als Instrument, um die Idee zu strukturieren, Strategien festzulegen und potenziellen Investoren eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.
Was ist mit „schöpferischer Zerstörung“ gemeint?
Basierend auf Schumpeter beschreibt es den Prozess, bei dem Entrepreneure durch radikale Innovationen alte Strukturen und Unternehmen verdrängen und so wirtschaftlichen Fortschritt erzielen.
Welche Risiken bestehen bei der Ideenverwirklichung?
Risiken umfassen technisches Scheitern, mangelnde Marktakzeptanz, Finanzierungslücken oder Probleme im Gründerteam.
- Quote paper
- Jochen Leidig (Author), 2004, Die Ideenbewertung von Start-ups, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32049