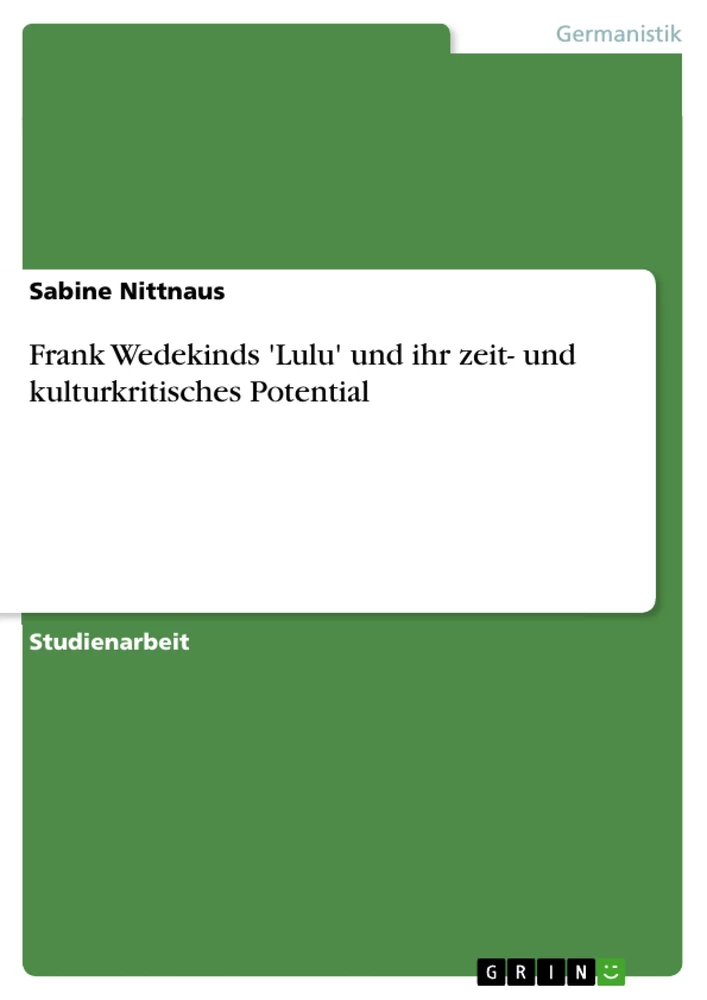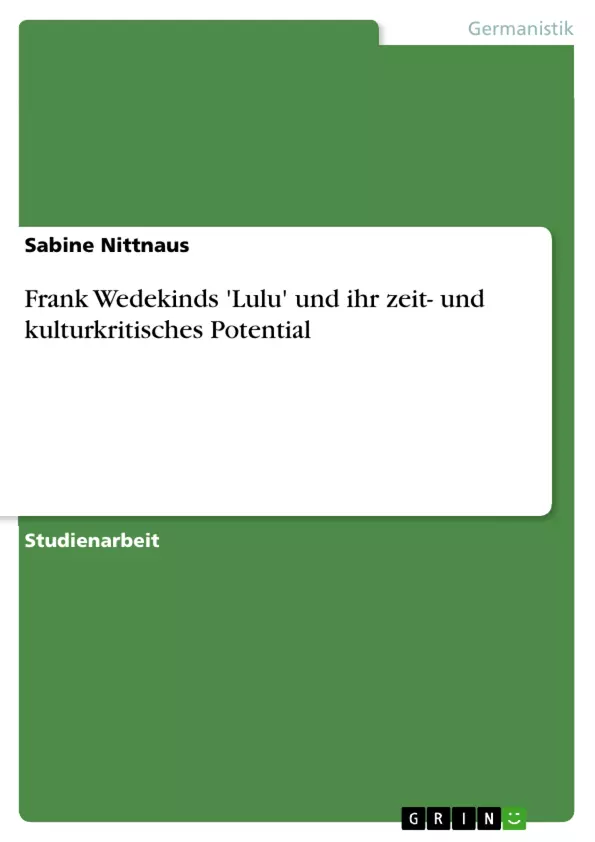Diese Arbeit untersucht das kritische Potenzial der Hauptfigur aus Frank Wedekinds ‚Lulu-Dramen‘, der schillernden und schwer fassbaren Figur der Lulu. Auffallend ist die Pluralität der Lulu-Interpretationen im Laufe der Rezeptionsgeschichte von Wedekinds Drama. Lulu wurde von den Kritikern als das ewig Weibliche, als Femme fatale, als Femme enfant, als Naturprinzip, als Verkörperung einer ursprünglichen Sinnlichkeit, als Verkörperung des reinen Triebes oder in krassem Gegensatz dazu, sogar der unbedingten Moral gesehen. Die Uneinheitlichkeit der Darstellung der Hauptfigur, sowie der Interpretationen scheint dabei das einzig zentrale Merkmal des Lulu-Dramenkomplexes zu sein.
Dies geht soweit, dass es angesichts der gegensätzlichen Interpretationen angemessen erscheint, auch abgesehen von den verschiedenen Textfassungen von den verschiedenen ‚Lulus‘ der Interpreten zu sprechen. Gerade die Tatsache, dass Wedekinds ‚Lulu‘ bis in die jüngste Zeit auf das lebhafteste kritische Interesse gestoßen ist und auf sehr unterschiedliche Weise rezipiert wurde und wird, zeigt, dass die Diskussion noch lange nicht erschöpft ist und ‚Lulu‘ eine Schlüsselfigur ist, an der sich unterschiedliche Vorstellungen von Weiblichkeit entzünden. Die vorliegende Arbeit versucht die Lulu-Gestalt – oder Lulu-Gestalten zu fassen, indem sie allgemein fragt, inwiefern die Lulu Figur als Teil des Weiblichkeitsdiskurses ihrer Zeit, also der Zeit um 1900 gesehen werden kann und inwiefern sie diesen Bezugsrahmen transzendiert und schon auf ein moderneres Frauenbild hinweist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte
- Textfassungen
- Intertextuelle Bezüge
- Lulu als Kaleidoskop unterschiedlicher Vorstellungen von Weiblichkeit
- Lulu in der Rezeptionsgeschichte
- Lulu: Femme fatale oder Femme enfant?
- Lulu als Opfer
- Lulu als Projektionsfläche
- Lulu im Weiblichkeitsdiskurs ihrer Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das kritische Potential der Figur Lulu in Frank Wedekinds Dramen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Vielschichtigkeit der Lulu-Interpretationen und ihrer Einbettung in den Weiblichkeitsdiskurs um 1900. Die Arbeit beleuchtet, inwiefern Lulu diesen Kontext transzendiert und möglicherweise bereits auf ein modernes Frauenbild verweist.
- Die unterschiedlichen Textfassungen von Wedekinds Lulu-Dramen und ihre Auswirkungen auf die Interpretation.
- Die verschiedenen Rezeptionsgeschichten und die daraus resultierenden widersprüchlichen Darstellungen Lulus.
- Die Rolle Lulus als Femme fatale, Femme enfant, Opfer und Projektionsfläche.
- Die Positionierung Lulus im Weiblichkeitsdiskurs des frühen 20. Jahrhunderts.
- Das kritische Potential der Figur Lulu und ihre Bedeutung für die Auseinandersetzung mit Frauenbildern.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem kritischen Potential der Figur Lulu in Wedekinds Dramen. Sie beschreibt die große Bandbreite an Interpretationen der Figur in der Rezeptionsgeschichte und hebt die Widersprüchlichkeit ihrer Darstellung hervor. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Aspekte, die im weiteren Verlauf untersucht werden, wie die Entstehungsgeschichte, die verschiedenen Rezeptionsansätze und die Einordnung Lulus in den zeitgenössischen Weiblichkeitsdiskurs. Die Komplexität der Textgeschichte wird als Ausgangspunkt für die Analyse der Figur genannt.
Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplizierten Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte der Lulu-Dramen. Es wird die Vielfalt der Textfassungen, beginnend mit der Urfassung "Die Büchse der Pandora", bis hin zu den überarbeiteten Versionen "Der Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora", detailliert dargestellt. Die unterschiedlichen Bearbeitungsstufen und die damit verbundenen Änderungen werden beleuchtet, ebenso wie die Kontroversen um den künstlerischen Wert der verschiedenen Fassungen und die Rolle der Zensur. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der komplexen Textgeschichte und ihrer Bedeutung für das Verständnis der Figur Lulu.
Lulu als Kaleidoskop unterschiedlicher Vorstellungen von Weiblichkeit: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Interpretationen der Figur Lulu in der Rezeptionsgeschichte. Es werden verschiedene Lesarten und Perspektiven beleuchtet, angefangen von der Darstellung Lulus als „ewig Weibliches“ bis hin zur Betrachtung als Femme fatale, Femme enfant, Opfer und Projektionsfläche. Die Kapitel untersuchen, wie die Figur Lulu als Ausdruck der widersprüchlichen und ambivalenten Vorstellungen von Weiblichkeit um 1900 fungiert, und wie diese Darstellung gleichzeitig über den historischen Kontext hinausweist. Der Fokus liegt auf der Synthese dieser verschiedenen Ansätze, um die Komplexität der Figur zu erfassen.
Schlüsselwörter
Lulu, Frank Wedekind, Weiblichkeitsdiskurs, Rezeptionsgeschichte, Femme fatale, Femme enfant, Textfassungen, kritisches Potential, Moderne, 1900.
Häufig gestellte Fragen zu: Wedekinds Lulu - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das kritische Potential der Figur Lulu in Frank Wedekinds Dramen. Der Fokus liegt auf der Vielschichtigkeit der Lulu-Interpretationen und ihrer Einbettung in den Weiblichkeitsdiskurs um 1900. Untersucht wird, inwiefern Lulu diesen Kontext transzendiert und möglicherweise bereits auf ein modernes Frauenbild verweist.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die unterschiedlichen Textfassungen von Wedekinds Lulu-Dramen und deren Auswirkungen auf die Interpretation, die verschiedenen Rezeptionsgeschichten und die daraus resultierenden widersprüchlichen Darstellungen Lulus, Lulus Rolle als Femme fatale, Femme enfant, Opfer und Projektionsfläche, die Positionierung Lulus im Weiblichkeitsdiskurs des frühen 20. Jahrhunderts und das kritische Potential der Figur Lulu und ihre Bedeutung für die Auseinandersetzung mit Frauenbildern.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehungsgeschichte (inklusive Textfassungen und intertextueller Bezüge), ein Kapitel zur Analyse von Lulu als Kaleidoskop unterschiedlicher Vorstellungen von Weiblichkeit (inkl. Rezeptionsgeschichte, verschiedenen Rollen Lulus und ihrer Position im damaligen Weiblichkeitsdiskurs) und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit vor. Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in die jeweiligen Themen.
Welche Textfassungen von Wedekinds Lulu-Dramen werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt die Vielfalt der Textfassungen, beginnend mit der Urfassung "Die Büchse der Pandora", bis hin zu den überarbeiteten Versionen "Der Erdgeist" und "Die Büchse der Pandora". Die unterschiedlichen Bearbeitungsstufen und die damit verbundenen Änderungen werden beleuchtet, ebenso wie die Kontroversen um den künstlerischen Wert der verschiedenen Fassungen und die Rolle der Zensur.
Wie wird Lulu in der Arbeit interpretiert?
Die Arbeit analysiert die vielschichtigen Interpretationen der Figur Lulu. Es werden verschiedene Lesarten und Perspektiven beleuchtet, von der Darstellung Lulus als „ewig Weibliches“ bis hin zur Betrachtung als Femme fatale, Femme enfant, Opfer und Projektionsfläche. Der Fokus liegt auf der Synthese dieser verschiedenen Ansätze, um die Komplexität der Figur zu erfassen und ihre Bedeutung im Kontext des Weiblichkeitsdiskurses zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lulu, Frank Wedekind, Weiblichkeitsdiskurs, Rezeptionsgeschichte, Femme fatale, Femme enfant, Textfassungen, kritisches Potential, Moderne, 1900.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Was ist das kritische Potential der Figur Lulu in Wedekinds Dramen?
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für Frank Wedekind, seine Dramen, die Figur Lulu, den Weiblichkeitsdiskurs um 1900, Literaturwissenschaft und Gender Studies interessieren.
- Arbeit zitieren
- Sabine Nittnaus (Autor:in), 2014, Frank Wedekinds 'Lulu' und ihr zeit- und kulturkritisches Potential, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320522