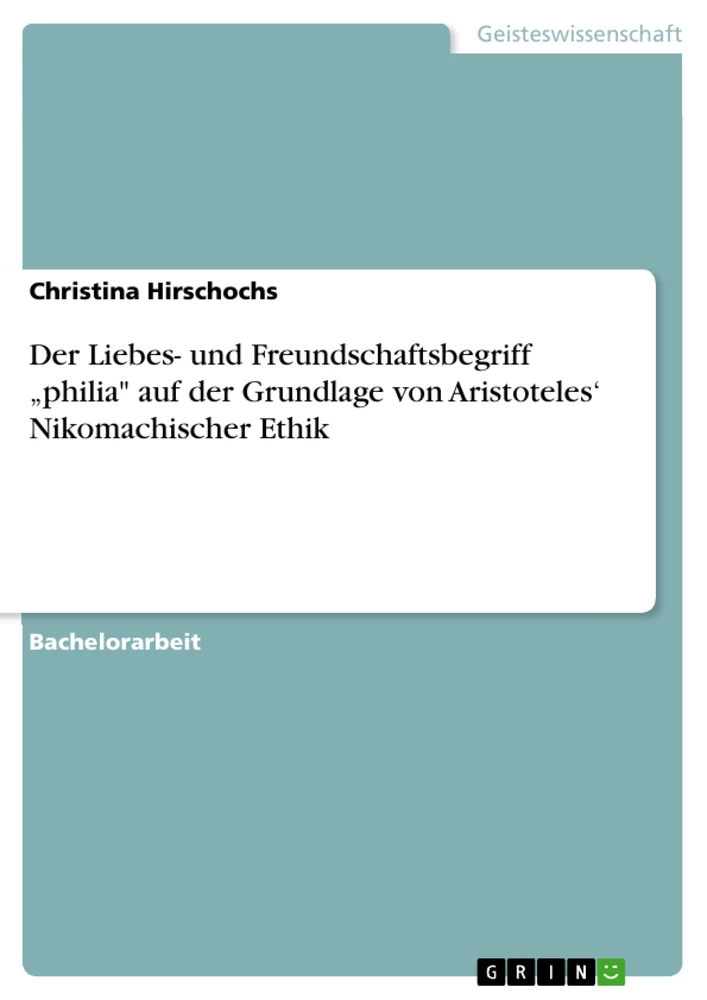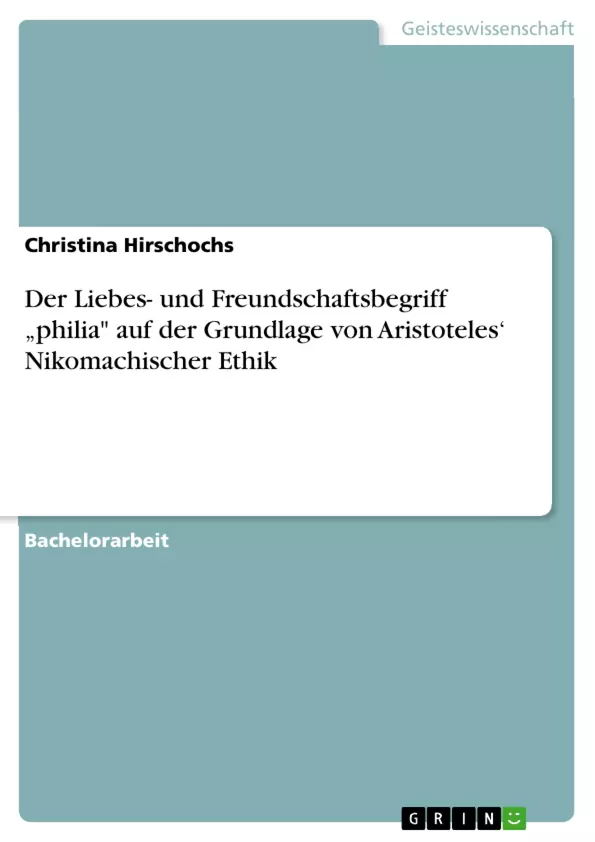Reflexionen auf die Freundschaft durchziehen die Praktische Philosophie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Von Platon bis Foucault, von Aristoteles bis Derrida scheint das Nachdenken über Freundschaft immer wieder neu und anders anzusetzen. Noch vor zwanzig Jahren wurden Interpretationen über die Freundschaftsabhandlung in der Nikomachischen Ethik mit dem Hinweis eingeleitet, dieses Thema sei, obwohl es bei Aristoteles breiten Raum einnimmt, in der Forschung wenig beachtet worden. Das hat sich offenbar geändert. In jüngerer Zeit findet das Thema Freundschaft vermehrt Interesse. Nicht nur in philosophischen Abhandlungen als Aristoteles-Rezeptionen- und Interpretationen, Veröffentlichungen über Glück und Lebenskunst6, sondern auch in den populärwissenschaftlichen Medien erscheinen Bücher und Zeitschriftenartikel über Freundschaft, Liebe, Glück und Lebenskunst.
Zeeb bemerkt, daß in den letzten Jahren das Interesse der zeitgenössischen philosophischen Forschung an der Thematik der Freundschaft stetig gestiegen ist. Sie weist dabei auf drei unterschiedliche Arten der Annäherung hin: Die erste reflektiert die Wirkung der Freundschaft auf die Identität der Freunde, die zweite widmet sich dem komplexen Zusammenhang von Freundschaft und Moral, die dritte untersucht das politische Potential der Freundschaft. Die Soziologie befaßt sich mit dem Phänomen Freundschaft als einer zwischenmenschlichen Beziehung. Soziologische Theorien sehen die Lebensbedingungen in den gegenwärtigen westlichen Gesellschaften durch Prozesse der Individualisierung und Ausdifferenzierung gekennzeichnet. Der Einzelne findet sich in seinem Lebensvollzug aus historisch vorgegebenen Sozialformen wie Ehe und Familie weitgehend herausgelöst. Instanzen normierender Sinnstiftung wie Religion, Beruf oder Geschlecht verlören an unhinterfragter Akzeptanz. Freundschaft könne eine Alternative zu nicht vorhandenen traditionellen Bindungen darstellen, wie zu Ehe oder Familie und Verwandtschaft. Bei Aristoteles war die Freundschaft Bestandteil der Beziehungen innerhalb der Familie und Verwandtschaft. Freundschaft kann individuelle und soziale Bedürfnisse abdecken, ohne die soziale Autonomie und Unabhängigkeit zu beschneiden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Fragestellung und Vorgehensweise
- Einleitung
- Begriffsbestimmung (semantisch)
- Zur Unterscheidung von eros, philia und ágápe
- Zum Begriff der Liebe
- Zum Liebesbegriff bei Luhmann
- Historischer Rückblick
- Aristotelische Konzeption
- Zum Zusammenhang von eudaimonia, areté und philia
- areté und philia
- eudaimonia und philia
- Die Arten der Freundschaft in Aristoteles' Nikomachischer Ethik
- Die vollkommene, wahre oder eigentliche Freundschaft
- ,,Und wo bleibt die Liebe?"
- Schlußbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Der Freundschaftsbegriff „philia" in der Nikomachischen Ethik
- Die verschiedenen Arten der Freundschaft nach Aristoteles
- Die Bedeutung von philia für das glückliche Leben (eudaimonia)
- Der Zusammenhang von philia und areté (Tugend)
- Die Beziehung zwischen philia und Liebe (eros, agapé)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Freundschafts- und Liebesbegriff „philia", wie er von Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik behandelt wird. Sie untersucht, wie Aristoteles den Begriff philia im Kontext seiner ethischen Philosophie definiert und welche Arten von Freundschaft er unterscheidet. Die Arbeit beleuchtet auch die Beziehung zwischen philia, eudaimonia (Glück) und areté (Tugend) in Aristoteles' Denken.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Vorgehensweise. Kapitel 1 beschäftigt sich mit der semantischen Bestimmung des Begriffs philia im Vergleich zu eros und agapé. Es werden verschiedene Interpretationen des Liebesbegriffs diskutiert, insbesondere die von Luhmann. Kapitel 2 bietet einen historischen Rückblick auf die Entwicklung des Freundschaftsbegriffs. Kapitel 3 analysiert die aristotelische Konzeption von philia und erörtert den Zusammenhang zwischen philia, eudaimonia und areté. Es werden die verschiedenen Arten der Freundschaft nach Aristoteles erläutert, insbesondere die „eigentliche“ oder vollkommene Freundschaft.
Schlüsselwörter
Philia, Freundschaft, Liebe, Aristoteles, Nikomachische Ethik, eudaimonia, areté, Tugend, eros, agapé, semantische Analyse, historische Entwicklung.
- Quote paper
- B.A. Christina Hirschochs (Author), 2012, Der Liebes- und Freundschaftsbegriff „philia" auf der Grundlage von Aristoteles‘ Nikomachischer Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320710