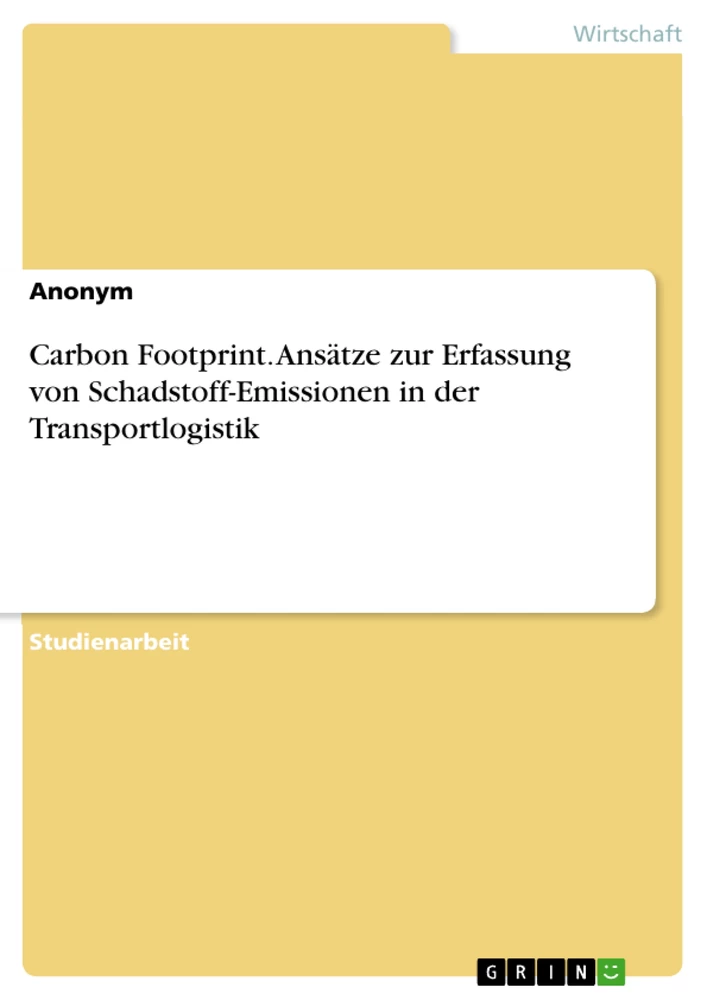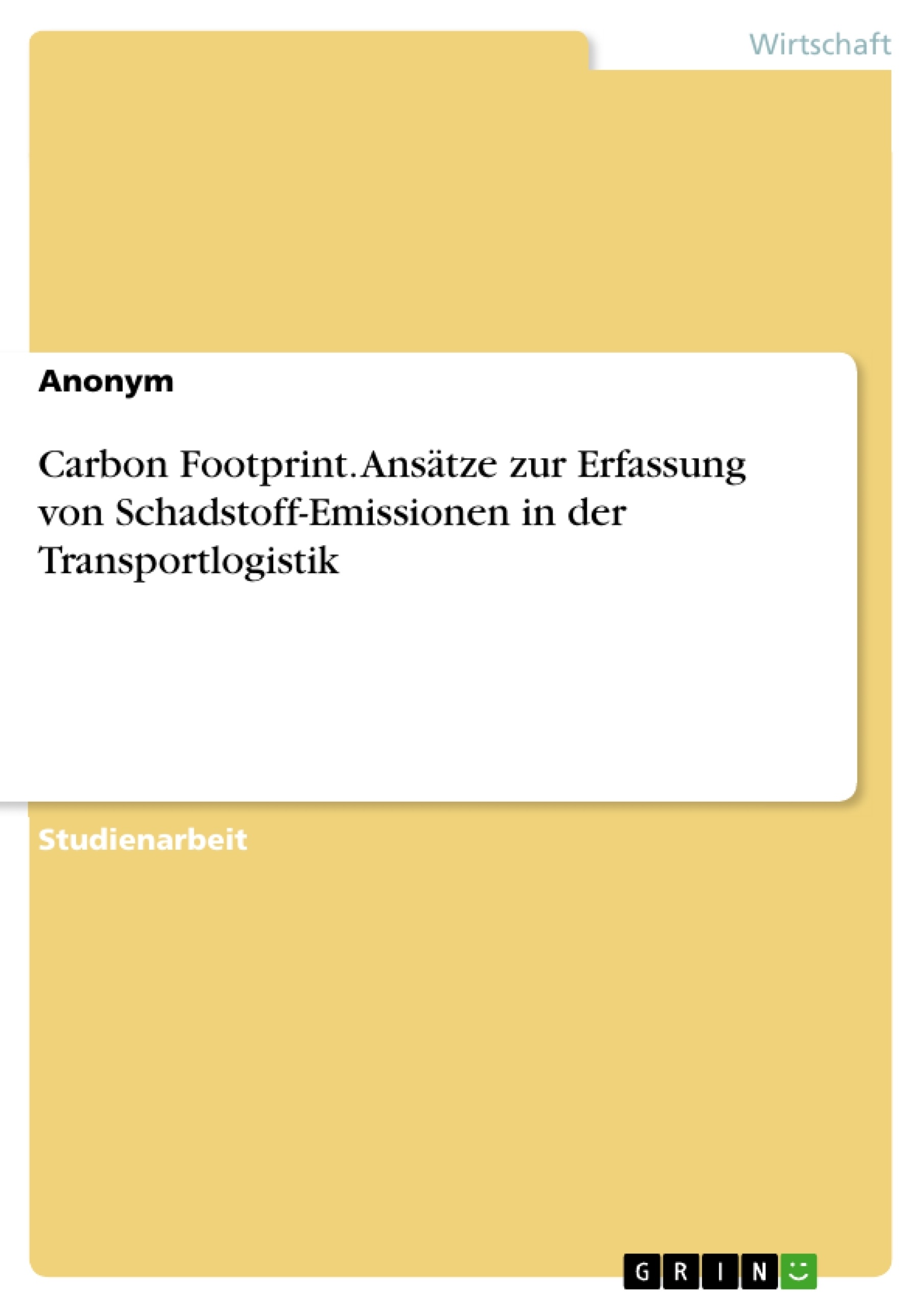In dieser Arbeit werden die Begriffe Transportlogistik, Nachhaltigkeit, Carbon Footprint und auch Kennzahlen erläutert, welche ausschlaggebend für die Trendstudie der Deutschen Post DHL ist. Darüber hinaus wird die Aussagekraft des Carbon Footprints als Kennzahl verdeutlicht. Das nächste Kapitel gibt Auskünfte über die „GoGreen“ Maßnahme von der Deutschen Post DHL und ihre Einstellung zu einer nachhaltigen Logistik laut Trendstudie. Im Fazit wird ein abschließender Blick auf diese Studie und ihre mögliche Anwendung für andere Transportunternehmen geworfen.
Immer häufiger berichten Medien über das topaktuelle Thema rund um den Klimawandel und der damit unweigerlich einhergehenden globalen Erwärmung. Gleichzeitig werden die Aufforderungen zum nachhaltigen Handeln immer eindringlicher und lauter. In diesem Zusammenhang fällt auch immer öfters der Begriff des sogenannten „Carbon Footprints“, welcher die Menge an CO2 ermisst, die ein Unternehmen oder auch eine einzelne Person ausstößt. Die Transportlogitsik gilt als einer der größten C02-Ausgeber überhaupt.
2010 veröffentlichte die Deutsche Post DHL eine Trendstudie, um auf das Thema der nachhaltigen Logistik aufmerksam zu machen. In Anlehnung an diese Studie wird mit dieser Arbeit behandelt, wie große Transportunternhmen einen Beitrag zum Umweltschutz mit der Erfassung der Kennzahl Carboon Footprint leisten oder sogar verbessern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gliederung
- 2 Begriffliche Abgrenzungen
- 2.1 Transportlogistik
- 2.2 Nachhaltigkeit
- 2.3 Carbon Footprint
- 2.4 Kennzahlen
- 3 Die Berechnung des Carbon Footprints
- 3.1 Berechnungsgrundlagen
- 3.2 Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens
- 3.3 Sachbilanz
- 3.4 Wirkungsabschätzung
- 3.5 Auswertung
- 4 Deutsche Post DHL „GoGreen“
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema des Carbon Footprints in der Transportlogistik und untersucht, wie große Transportunternehmen durch die Erfassung dieser Kennzahl einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können.
- Definition und Bedeutung des Carbon Footprints in der Transportlogistik
- Analyse der Berechnungsgrundlagen und -methoden des Carbon Footprints
- Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Transportlogistik
- Vorstellung des „GoGreen“-Programms der Deutschen Post DHL
- Potenziale und Herausforderungen bei der Reduzierung des Carbon Footprints in der Transportlogistik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema des Carbon Footprints und seiner Relevanz in der heutigen Zeit. Anschließend werden wichtige Begriffe wie Transportlogistik, Nachhaltigkeit und Kennzahlen erläutert. Im dritten Kapitel wird die Berechnung des Carbon Footprints im Detail betrachtet, einschließlich der Berechnungsgrundlagen, der Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens, der Sachbilanz, der Wirkungsabschätzung und der Auswertung. Das vierte Kapitel stellt das „GoGreen“-Programm der Deutschen Post DHL vor und zeigt, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit in seine Logistik integriert. Im Fazit werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und mögliche Anwendungen für andere Transportunternehmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Carbon Footprint, Transportlogistik, Nachhaltigkeit, Kennzahlen, Deutsche Post DHL, GoGreen, Umweltschutz, CO2-Emissionen, Logistikkette, Transportmittel, Berechnungsgrundlagen, Sachbilanz, Wirkungsabschätzung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Carbon Footprint?
Der Carbon Footprint (CO2-Fußabdruck) misst die Menge an Treibhausgasemissionen, die ein Unternehmen, ein Prozess oder eine Person verursacht.
Warum ist der Carbon Footprint in der Transportlogistik wichtig?
Die Transportlogistik ist einer der größten CO2-Emittenten weltweit; die Erfassung ermöglicht es, Einsparpotenziale zu identifizieren und nachhaltiger zu handeln.
Was beinhaltet das „GoGreen“-Programm von DHL?
Es ist eine Initiative zur Verbesserung der CO2-Effizienz und zum Angebot klimaneutraler Versandlösungen durch Emissionsausgleich und Prozessoptimierung.
Wie wird der Carbon Footprint berechnet?
Die Berechnung basiert auf einer Sachbilanz und Wirkungsabschätzung unter Berücksichtigung von Transportmitteln, Kraftstoffverbrauch und zurückgelegten Distanzen.
Können auch kleine Transportunternehmen den Carbon Footprint nutzen?
Ja, die Kennzahl dient als Instrument für alle Logistikunternehmen, um ihre Umweltbilanz zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Carbon Footprint. Ansätze zur Erfassung von Schadstoff-Emissionen in der Transportlogistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320808