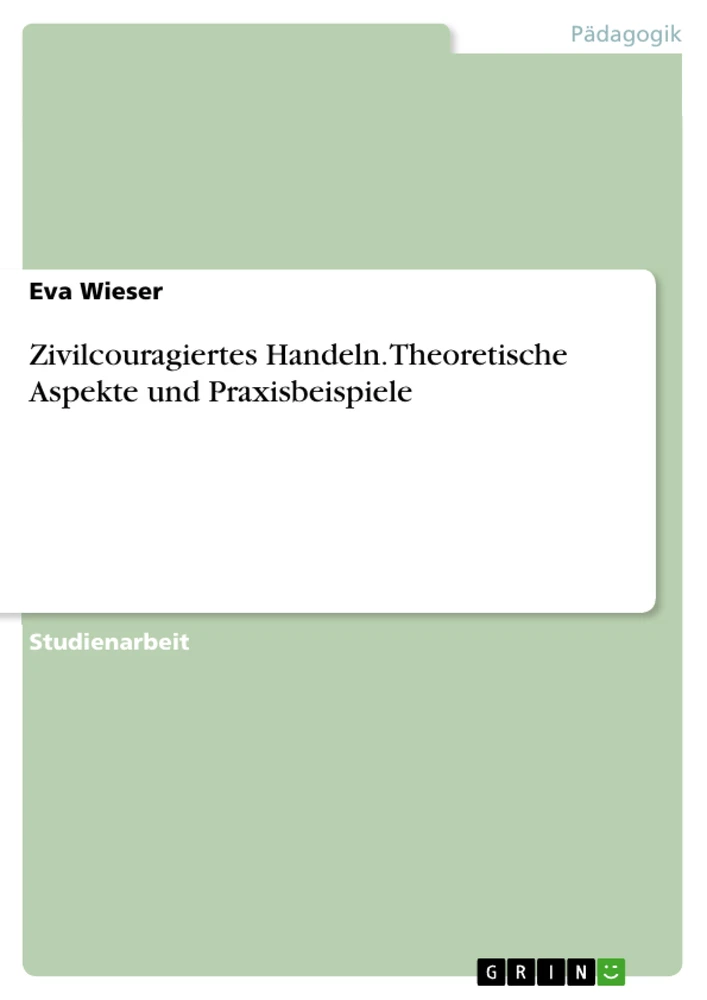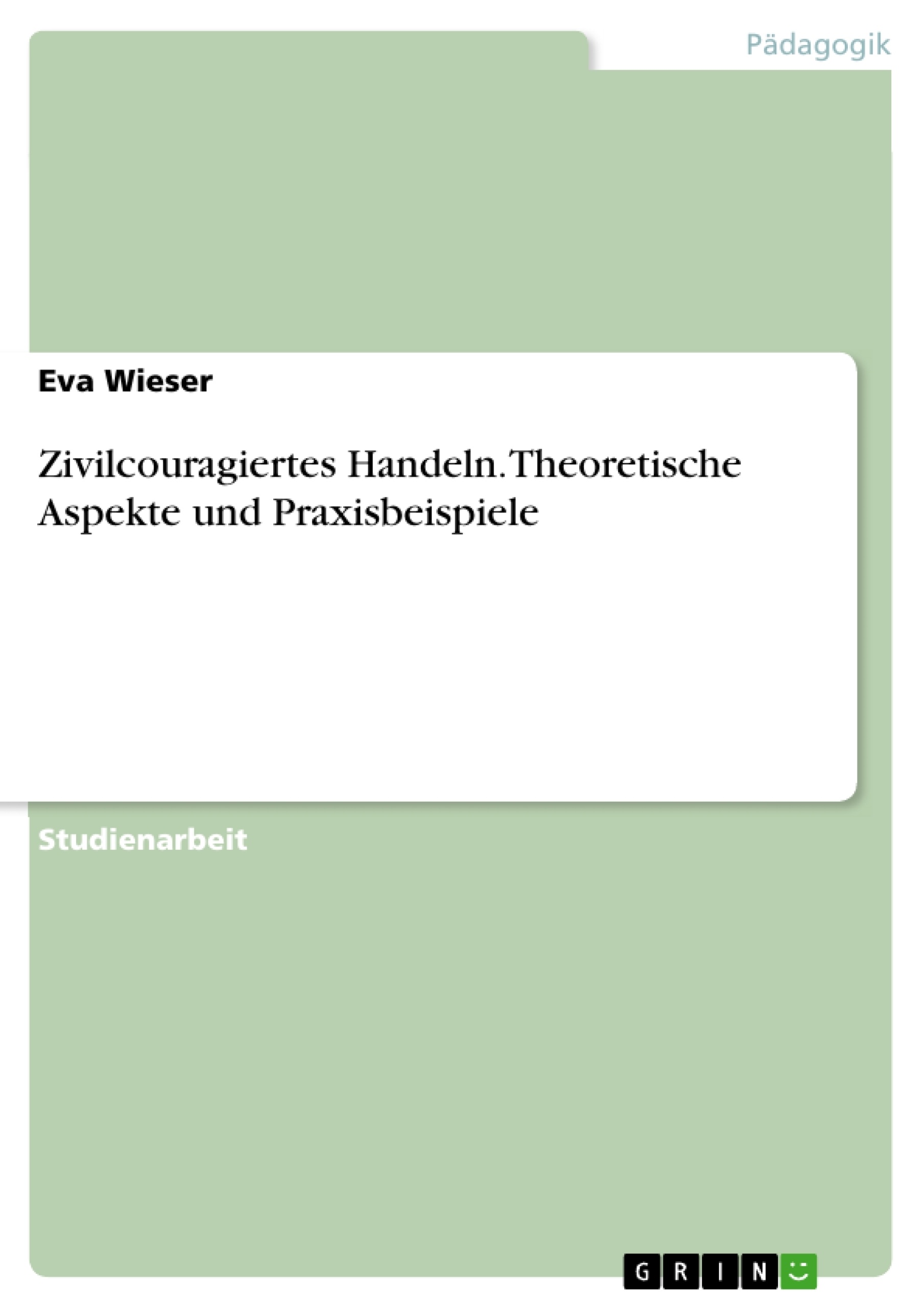Inhaltsverzeichnis
1. Hinführung zur Thematik 3
2. Annäherung an den Begriff „Zivilcourage“ 5
2.1 Definitorische Bestimmung 5
2.2 Formen zivilcouragierten Handelns 7
2.3 Orte und Träger von zivilcouragierten Handelns 8
3. Theoretische Aspekte 9
3.1 Entscheidungsprozess - von der Wahrnehmung bis zum Handeln 9
3.2 Was fördert, was hindert Zivilcourage? 10
3.2.1 Personale Einflussfaktoren 10
3.2.2 Soziale Einflussfaktoren 10
3.2.3 Biografische Einflussfaktoren 12
3.2.4 Orientierungsmuster 13
3.3 Übertragbarkeit auf Kinder und Jugendliche 13
4. Zivilcourage fördern: Demokratische Alltagspraxis und pädagogisches Handeln 15
4.1 Politisch-soziale und pädagogische Problemlagen 15
4.2 Ansätze zur Förderung der Zivilcourage in der Schule 16
4.2.1 Anerkennung und Strukturen 16
4.2.2 Ist Zivilcourage trainierbar? 17
5. Praxisbezug 18
5.1 Vorüberlegung 18
5.2 Konkrete Praxisbeispiele 18
5.2.1 Macht und Ohnmacht 18
5.2.2 Das Asch-Experiment 20
5.2.3 Das war brenzlig! 21
5.2.4 Zivilcourage üben! 22
6. Resümee 23
7. Literaturverzeichnis 24
I. Abbildungsverzeichnis 25
1. Hinführung zur Thematik
Einmal im Monat wird die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ausgestrahlt, die ich mit großer Spannung und gleichzeitig mit Empörung verfolge. Darin werden regelmäßig Fälle gezeigt, in denen durch zivilcouragiertes Handeln Kriminalität entweder aufgedeckt oder vermieden werden konnte. In der heutigen Zeit werden wir häufig mit dem Begriff „Zivilcourage“ konfrontiert: durch die Nachrichten, den Radio- und Kinospots, Werbeplakate, die Schule etc. Bereits als Kind bekommt man von Zivilcourage zu hören, denn dadurch entsteht der Traum vom Superhel-den und wie man im Traum selbst zu einem wird. Dieser Superheld ist jemand, der von allen be-wundert und respektiert wird, zu dem alle aufblicken. Es ist jemand, der sich furchtlos Gefahren aussetzt und trotzdem als Gewinner herausgeht. Besonders durch die Herausforderung mit den hilfebedürftigen Asylanten kommt ein Wort wie „Zivilcourage“ erneut zum Tragen. Sämtliche Fragen haben mich schon immer beschäftigt, die auf die Problematik der Zivilcourage verweisen: Was bedeutet es konkret, zivilcouragiert in unserer Gesellschaft zu handeln? Leben wir heute in einer Ellenbogengesellschaft, die die Rücksicht auf andere nicht zulässt? Beobachten die Men-schen lieber eine öffentliche Konfliktsituation und ignorieren diese, anstatt tatkräftig zu helfen? Welche Motive haben diese Menschen, die nur zum Zuschauer werden? Diese Einstellung kann nach dem Gr
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zur Thematik
- Annäherung an den Begriff „Zivilcourage“
- Definitorische Bestimmung
- Formen zivilcouragierten Handelns
- Orte und Träger von zivilcouragierten Handelns
- Theoretische Aspekte
- Entscheidungsprozess - von der Wahrnehmung bis zum Handeln
- Was fördert, was hindert Zivilcourage?
- Personale Einflussfaktoren
- Soziale Einflussfaktoren
- Biografische Einflussfaktoren
- Orientierungsmuster
- Übertragbarkeit auf Kinder und Jugendliche
- Politisch-soziale und pädagogische Problemlagen
- Ansätze zur Förderung der Zivilcourage in der Schule
- Anerkennung und Strukturen
- Macht und Ohnmacht
- Das Asch-Experiment
- Das war brenzlig!
- Zivilcourage üben!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Zivilcourage und beleuchtet verschiedene Aspekte dieser wichtigen gesellschaftlichen Tugend. Die Zielsetzung ist es, ein umfassendes Verständnis für die Entstehung, die Funktionsweise und die Förderung von Zivilcourage zu entwickeln.
- Definition und Bedeutung des Begriffs "Zivilcourage"
- Theoretische Grundlagen und Einflussfaktoren auf Zivilcourage
- Übertragbarkeit von Zivilcourage auf Kinder und Jugendliche
- Praktische Ansätze zur Förderung von Zivilcourage in der Schule
- Die Trainierbarkeit von Zivilcourage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zur Thematik und einer Annäherung an den Begriff der Zivilcourage. Im Anschluss wird eine definitorische Bestimmung des Begriffs vorgenommen, wobei die Abgrenzung zum Begriff "Mut" erläutert wird. Anschließend werden die verschiedenen Formen und Orte zivilcouragierten Handelns sowie die relevanten theoretischen Aspekte, wie der Entscheidungsprozess und die Einflussfaktoren auf Zivilcourage, beleuchtet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Übertragbarkeit von Zivilcourage auf Kinder und Jugendliche. Hier werden die politisch-sozialen und pädagogischen Problemlagen dargestellt, die die Notwendigkeit von Zivilcourage verdeutlichen. Abschließend werden Ansätze zur Förderung der Zivilcourage in der Schule vorgestellt und die Trainierbarkeit von Zivilcourage diskutiert.
Schlüsselwörter
Zivilcourage, sozialer Mut, demokratisches Handeln, Entscheidungsmodell, Einflussfaktoren, persönliche und soziale Faktoren, biografische Einflussfaktoren, Orientierungsmuster, Förderung von Zivilcourage, pädagogisches Handeln, Schule, Alltagspraxis, Praxisübungen.
Häufig gestellte Fragen
Was genau versteht man unter Zivilcourage?
Zivilcourage bezeichnet den sozialen Mut, in öffentlichen Situationen für demokratische Werte und die Unversehrtheit anderer einzutreten, auch wenn dies mit persönlichen Risiken verbunden ist.
Welche Faktoren hindern Menschen daran, zivilcouragiert zu handeln?
Soziale Einflussfaktoren wie der „Bystander-Effekt“ (Verantwortungsdiffusion) sowie personale Ängste oder mangelnde Handlungskompetenz können Zivilcourage verhindern.
Ist Zivilcourage erlernbar oder trainierbar?
Ja, die Arbeit diskutiert pädagogische Ansätze und Praxisbeispiele, die zeigen, dass Zivilcourage durch gezielte Übungen und die Stärkung des Selbstbewusstseins gefördert werden kann.
Was lehrt uns das berühmte Asch-Experiment?
Das Asch-Experiment verdeutlicht den enormen Konformitätsdruck in Gruppen und zeigt, wie schwierig es für Einzelne ist, einer falschen Mehrheitsmeinung zu widersprechen.
Wie kann Zivilcourage in der Schule gefördert werden?
Durch demokratische Alltagspraxis, Anerkennungsstrukturen und das Besprechen von Konfliktsituationen können Schulen einen geschützten Raum für das Üben von Zivilcourage bieten.
Welche Rolle spielen biografische Einflussfaktoren?
Frühere Erfahrungen mit Gerechtigkeit, Erziehungsmuster und persönliche Vorbilder prägen maßgeblich die Bereitschaft eines Menschen, in brenzligen Situationen einzugreifen.
- Citation du texte
- Eva Wieser (Auteur), 2015, Zivilcouragiertes Handeln. Theoretische Aspekte und Praxisbeispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321035