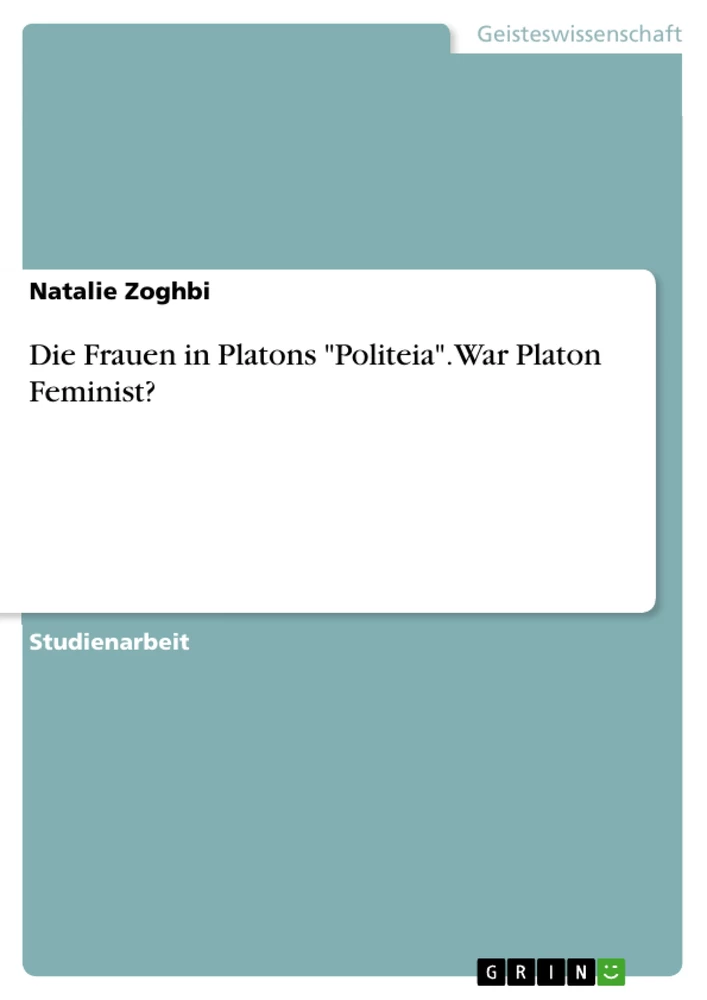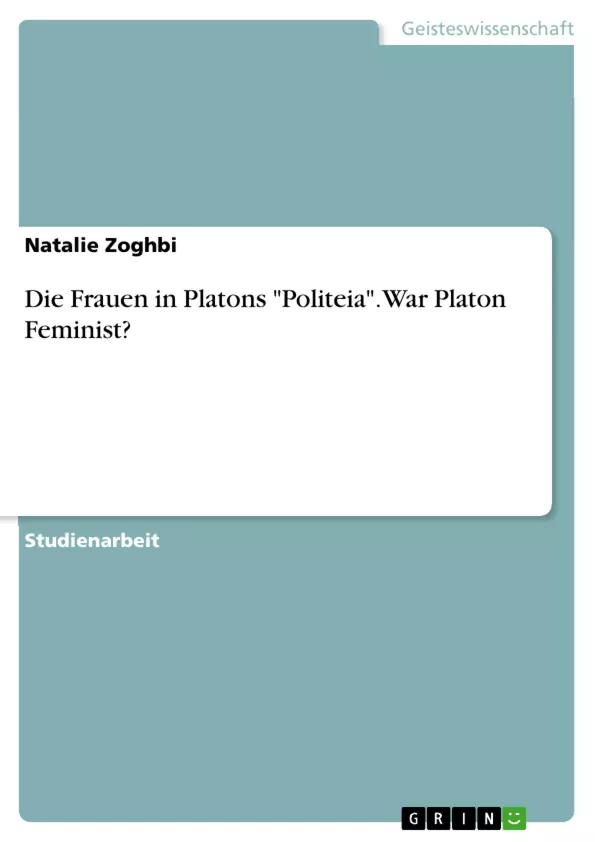Platons Theorien und Ansätze sind nach wie vor derart anwendbar, dass es bemerkenswert ist. Aber war Platon auch Feminist? Es gibt Stimmen im wissenschaftlichen Diskurs, welche für diese These plädieren, doch ist man im Allgemeinen hierüber noch nicht zu einer Einigung gekommen. Diese Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, ausgehend von Platons Frauenbild in der "Politeia" und Bezug nehmend auf die verschiedenen wissenschaftlichen Positionen, ein für und wider dieser Frage zu beleuchten.
Platon war weise. Platon war seiner Zeit voraus. Platons Theorien und Ansätze sind nach wie vor derart anwendbar, dass es bemerkenswert ist. Aber war Platon auch Feminist?
Fragt man nach der Möglichkeit feministischen Gedankenguts in Platons "Politeia", ist es wichtig, vorab eine andere, in der Wissenschaft uneinheitlich ausgelegte Fragestellung zu klären, beziehungsweise darauf hinzuweisen, dass diese im Raum steht: Ist der von Platon beschriebene Idealstaat als Gleichnis für die Gerechtigkeit und damit für das Glück in der Seele des Individuums zu verstehen, wie er in der Mitte des zweiten Buches eingeleitet wird, oder aber als ausschließlich politisches Modell? Da es sich hierbei um eine grundlegende Frage zur Bedeutung des gesamten Werkes handelt, sollen diese zwei Lesarten sowie ihre potentiellen Auswirkungen auf die Feminismus-Debatte um Platon als Einstieg in die Thematik dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Ziel und Aussichten
- Platons Politeia: Staatsmodell oder Gerechtigkeitsgleichnis?
- Aufbau und Differenzierung der zwei Thesen in der Politeia
- Individualität in Platons Staat
- Die Gleichheit der Frauen des Wächterstandes
- Die Frauen- und Kindergemeinschaft.
- Fazit
- Die Feminismus-Unterstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Platons Frauenbild in der Politeia und beleuchtet die Frage, ob Platons Werk feministische Elemente enthält. Dabei wird die vielschichtige Debatte um Platons Staatsidee als politisches Modell oder Gerechtigkeitsgleichnis aufgegriffen und deren Relevanz für die Interpretation von Platons Frauenbild diskutiert.
- Platons Frauenbild in der Politeia und seine Relevanz für die Feminismus-Debatte
- Die Interpretation von Platons Staatsidee als politisches Modell oder Gerechtigkeitsgleichnis
- Die Rolle der Frauen im Idealstaat Platons
- Die Gleichheit der Frauen im Wächterstand und die Frauen- und Kindergemeinschaft
- Die Frage nach dem individuellen Glück im Staat versus dem Wohl des Staates
Zusammenfassung der Kapitel
- Ziel und Aussichten: Dieses Kapitel stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Herausforderungen, die sich aus der Interpretation von Platons Frauenbild im Kontext des Feminismus ergeben. Zudem wird die Debatte um Platons Staatsidee als politisches Modell oder Gerechtigkeitsgleichnis eingeführt.
- Platons Politeia: Staatsmodell oder Gerechtigkeitsgleichnis?: Dieses Kapitel analysiert die beiden zentralen Interpretationen von Platons Politeia und ihre Auswirkungen auf die Frage nach dem individuellen Glück und dem Wohl des Staates.
- Aufbau und Differenzierung der zwei Thesen in der Politeia: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau und die Argumentationslinie der Politeia und beleuchtet die Debatte um die Gerechtigkeit im Kontext des individuellen und des staatlichen Wohls.
- Individualität in Platons Staat: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Platons Staatsidee individuelle Bedürfnisse berücksichtigt oder ausschließlich dem Wohl des Staates dient. Es werden verschiedene Perspektiven auf Platons Frauenbild und die Rolle der Frauen in seinem Idealstaat vorgestellt.
Schlüsselwörter
Platons Politeia, Frauenbild, Feminismus, Staatsmodell, Gerechtigkeitsgleichnis, Individualität, Wohl des Staates, Gleichheit, Wächterstand, Frauen- und Kindergemeinschaft, Gerechtigkeit, Glück.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Platon als früher Feminist?
In der Wissenschaft ist dies umstritten. Während Platon Frauen im Wächterstand gleiche Aufgaben wie Männern zuweist, dient dies primär dem Staatswohl und nicht unbedingt der individuellen Frauenbefreiung.
Welche Rolle spielen Frauen in Platons Idealstaat?
In der Klasse der Wächter sollen Frauen dieselbe Erziehung erhalten und dieselben Ämter bekleiden können wie Männer, sofern sie die nötigen Fähigkeiten besitzen.
Was ist die „Frauen- und Kindergemeinschaft“ bei Platon?
Platon schlägt vor, dass Wächter keine privaten Familien gründen, sondern Frauen und Kinder der Gemeinschaft angehören, um Nepotismus zu verhindern und die Einheit des Staates zu stärken.
Ist Platons „Politeia“ ein rein politisches Modell?
Es gibt zwei Lesarten: Der Staat kann als reales politisches Modell oder als ein Gleichnis für die Gerechtigkeit in der Seele des Individuums verstanden werden.
Wie definiert Platon Gerechtigkeit im Kontext des Staates?
Gerechtigkeit herrscht dann, wenn jeder Stand (Wächter, Helfer, Erwerbende) das Seine tut und zum Wohl des gesamten Organismus beiträgt.
- Arbeit zitieren
- Natalie Zoghbi (Autor:in), 2013, Die Frauen in Platons "Politeia". War Platon Feminist?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321056