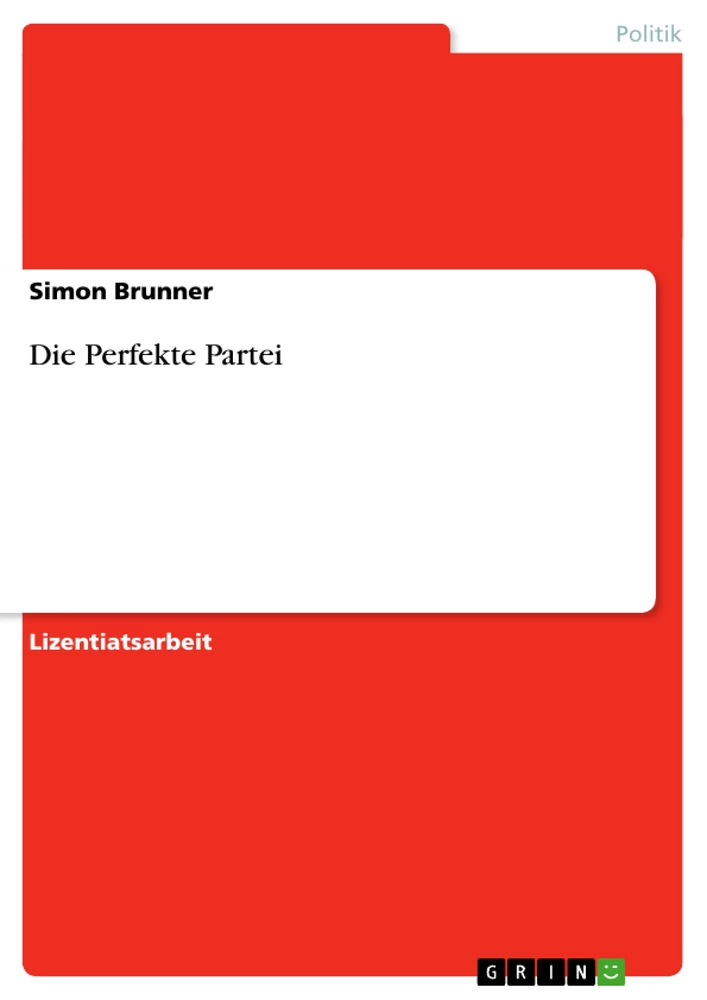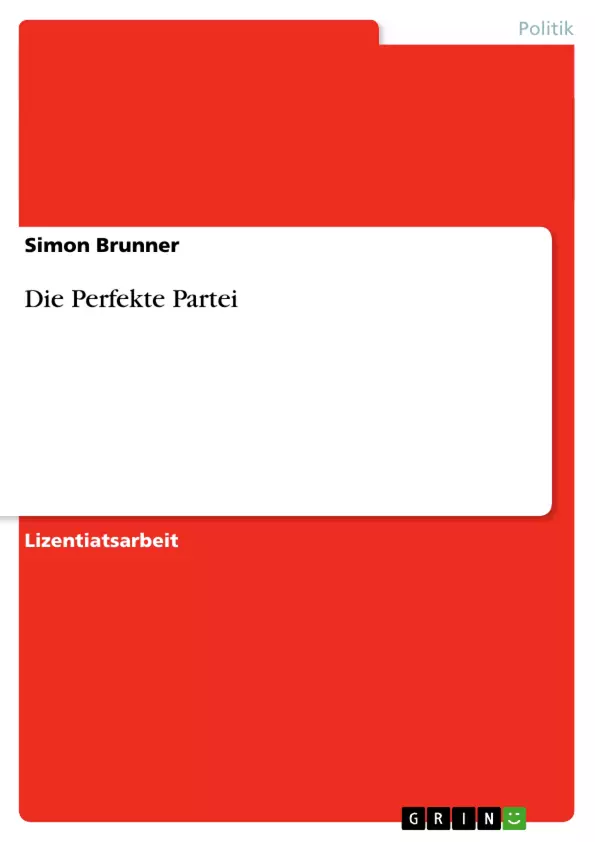Der deutsche Bundeskanzler wechselt seine Meinung auf Grund von Meinungsumfragen, die englischen „Spin-Doctors“ bestimmen mit Instrumenten der Marktforschung, welche Politik Tony Blair verfolgen soll und in der Schweiz wird der SVP vorgeworfen, sie besitze keine Grundeinstellung, ihre Politik werde ausschliesslich von Parteistrategen1 bestimmt. In den letzten Jahren ist das der Eindruck entstanden, Parteien würden, ähnlich wie Verkaufsartikel, den Marktgegebenheiten angepasst, derweil Ideologien in den Hintergrund treten oder ganz ausgeblendet werden.
„Das manische Bestreben der „Spin-Doctors“, das Bild der Regierung in Medien und Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen,“ so schreibt beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung „hat dazu geführt, dass ihren Verlautbarungen auch dann misstraut wird, wenn sie sachlich und wahrheitsgetreu sind.“ (NZZ, 2000). Es wird also grundsätzlich angenommen, Politiker lügen, beziehungsweise ihre Aussagen entsprechen nicht dem, was sie denken. George Gorton, einer der einflussreichsten „Spin-Doctors“ (Nixon, Reagan, Schwarzenegger) erzählt, wie er 1996 von Boris Jelzin engagiert wurde und ihm zur Wiederwahl verhalf: „Ich wollte gerade mit meinem Guru nach Bali fasten und meditieren gehen, als jemand anrief und sagte: ‚Mr. Gorton, wir wissen alles über Sie. Wir wollen, dass Sie morgen nach Russland kommen.’ (…) Als ich in Moskau ankam, lag Jelzin in den Umfragen bei sechs Prozent, vier Kandidaten lagen vor ihm.“ (Weltwoche, 2003) Ohne Jelzin jemals zu treffen, schaffte es Gorton, den kranken, alkoholsüchtigen Präsidenten so zu positionieren, dass er über die Hälfte der Stimmen erzielte. Gorton’s Rezept: „We find out what the voters want, and we give it to them“ („Spinning Boris“, 2003).
In Zentraleuropa wird oftmals Tony Blair als der erste Politiker wahrgenommen, der seine Politik auf Wählerumfragen basiert. Sogar Mitglieder seiner Partei stellen unterdessen in Frage, ob er wirklich ideologische Werte besitzt, oder lediglich nach der optimalen Position sucht. (Rudolf Rechsteiner: „Für mich ist Blairs Labour-Partei nicht mehr sozialdemokratisch“, BZ, 2003). Auch die sonst eher zurückhaltende Financial Times zweifelt an Blairs Werten. Einen Artikel über seine Ausrichtung betitelt sie mit „Blah Blah Blair“ (NZZ, 2002).
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Forschungsfrage
- Relevanz
- Aufbau der Arbeit
- Theorie
- Public Choice
- Die Nachfrage
- Das Wahlverhalten
- Das Proximity Modell
- Das Directional Modell
- Das Directional Model mit Penalty und Region of Acceptability
- Das Angebot
- Die Dimensionalität der politischen Raumes
- Research Design
- Daten
- Die Nachfrage
- Das Angebot
- Operationalisierung
- Die Nachfrage
- Das Proximity Modell
- Das Directional Modell
- Das Directional Modell mit Penalty und Region of Acceptability
- Die Güte der Modelle
- Die Dimensionalität des politischen Raumes
- Die Nachfrage
- Das Angebot
- Resultate
- Die Dimensionalität des politischen Raumes
- Die Nachfrage in den Dimensionen
- Das Angebot in den Dimensionen
- Die Perfekte Partei
- Das Proximity Modell
- Das Directional Modell
- Das Directional Modell mit Penalty und Region of Acceptability
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Lizentiatsarbeit untersucht die Machbarkeit einer „perfekten“ Partei, die ihre Inhalte ausschliesslich nach den Präferenzen der Wähler ausrichtet. Ziel ist es, mithilfe von Modellen der Public Choice Theorie zu analysieren, wie eine Partei in einem ideologischen Raum positioniert sein müsste, um die grösstmögliche Zustimmung zu erhalten.
- Wahlentscheidungsmodelle der Public Choice
- Ideologischer Raum und Positionierung von Parteien
- Entwicklung einer „Perfekten Partei“
- Anwendung empirischer Daten zur Analyse des Wählerverhaltens
- Vergleich verschiedener Modelle der Wahlentscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und Relevanz der „perfekten“ Partei in einem Kontext zunehmender Marktorientierung der Politik dar. Sie skizziert die Struktur und Vorgehensweise der Untersuchung.
- Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Untersuchung. Es werden die zentralen Prämissen der Public Choice Theorie und die beiden wichtigsten Wahlentscheidungsmodelle, das Proximity und das Directional Modell, vorgestellt.
- Daten: Hier werden die verwendeten Datensätze erläutert. Es werden sowohl Daten zur Nachfrage (Wählerpräferenzen) als auch zum Angebot (Parteienpositionen) beschrieben.
- Operationalisierung: Das Kapitel detailliert die Operationalisierung der verwendeten Modelle, insbesondere die Anwendung der Proximity und Directional Modelle sowie die Methode zur Bestimmung der Dimensionalität des politischen Raumes.
- Resultate: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse. Es werden die Dimensionen des politischen Raumes, die Positionierung von Parteien und die Ergebnisse der Anwendung der beiden Wahlentscheidungsmodelle auf die „Perfekte Partei“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Public Choice Theorie, Wahlentscheidungsmodelle, Ideologischer Raum, Parteienpositionierung, „Perfekte Partei“, empirische Analyse, Proximity Modell, Directional Modell, Wählerpräferenzen und Parteistrategien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Forschung zur "Perfekten Partei"?
Die Arbeit untersucht, ob eine Partei rein strategisch so positioniert werden kann, dass sie durch die Anpassung an Wählerpräferenzen die maximale Zustimmung erhält, ähnlich wie ein Produkt am Markt.
Welche Rolle spielen "Spin-Doctors" in der modernen Politik?
Spin-Doctors sind Strategen, die versuchen, das Bild von Politikern in den Medien durch Marktforschung und gezielte Kommunikation positiv zu beeinflussen, oft zulasten fester Ideologien.
Was unterscheidet das Proximity-Modell vom Directional-Modell?
Das Proximity-Modell geht davon aus, dass Wähler die Partei wählen, die ihrer eigenen Position am nächsten ist. Das Directional-Modell besagt, dass Wähler Parteien bevorzugen, die eine klare Richtung auf der "richtigen" Seite eines Themas einnehmen.
Was bedeutet "Public Choice" Theorie?
Die Public Choice Theorie wendet ökonomische Prinzipien auf die Politikwissenschaft an und betrachtet Wähler als Konsumenten und Parteien als Anbieter auf einem politischen Markt.
Können Parteien ohne Ideologie erfolgreich sein?
Die Arbeit analysiert am Beispiel von Politikern wie Tony Blair oder Boris Jelzin, wie eine starke Marktorientierung und das Bedienen von Wählerwünschen den Wahlerfolg über ideologische Werte stellen kann.
- Quote paper
- Simon Brunner (Author), 2004, Die Perfekte Partei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32105