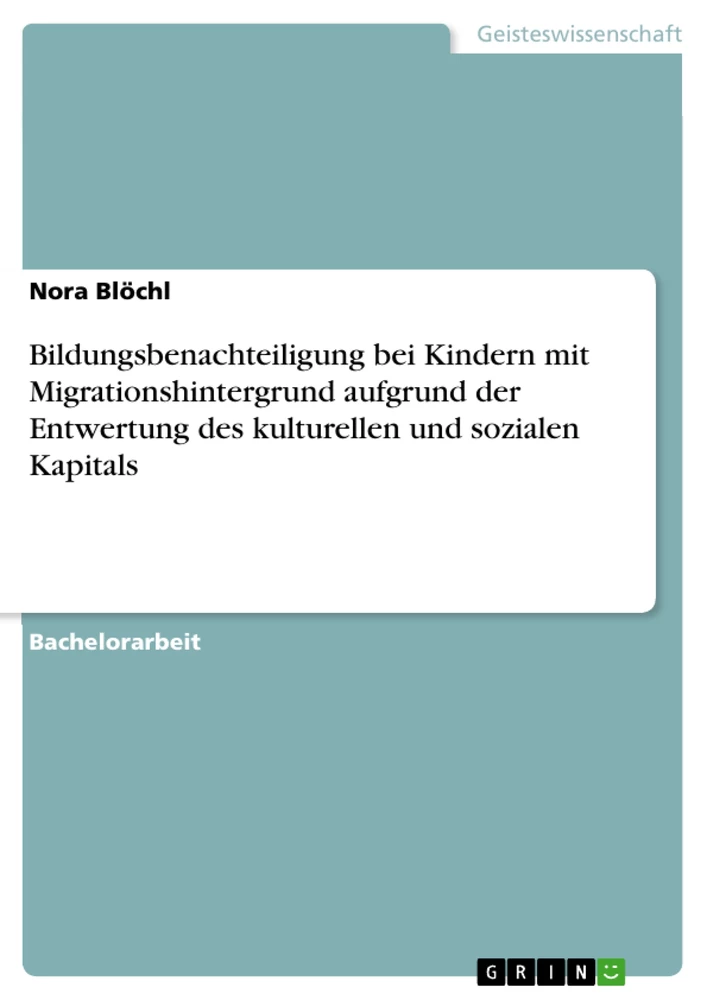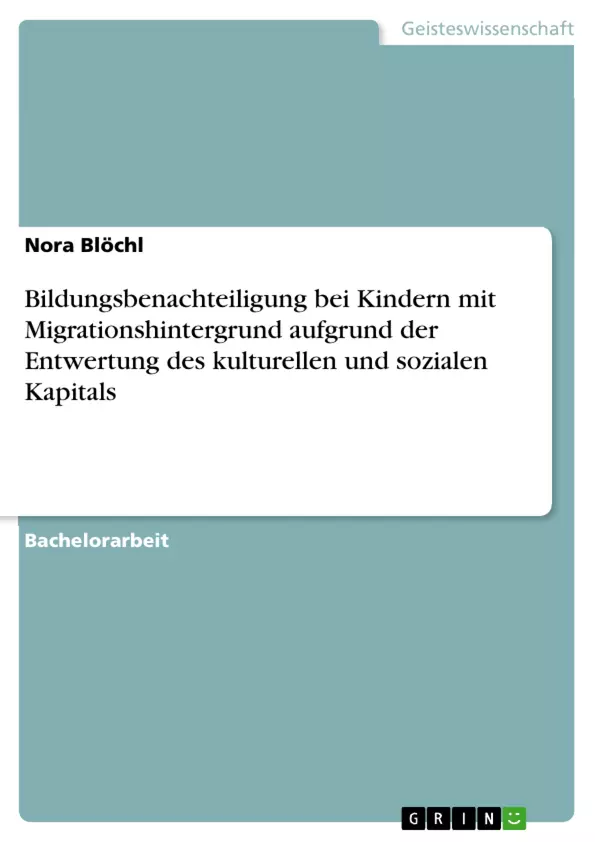In der vorliegenden Arbeit soll eine Antwort auf die Forschungsfrage „Inwiefern ist Bourdieus Konzept der Chancengleichheit auf die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund anzuwenden?“ gefunden werden. Zuerst wird auf Bourdieus Theorie der Chancengleichheit eingegangen. Die verschiedenen Formen des Kapitals werden aufgelistet und erklärt. Danach wird das Thema mit Boudons Theorie noch weiter ausgeführt und es soll erläutert werden, wie das kulturelle Kapital in der Familie weitergereicht wird. Anhand einer Tabelle wird aufgezeigt, wie die Bildungsungerechtigkeiten vom Schulsystem reproduziert werden. Um etwas genauer darzustellen, inwiefern der Bildungsweg von Migrant/innen der zweiten Generation von dem Bildungsweg ihrer Eltern abhängig ist, wird eine Studie von Michaela Sixt und Marek Fuchs angeführt. Die Ergebnisse dieser Studie werden anhand der institutionellen Diskriminierung in der Schule erklärt. Es soll die Frage geklärt werden, inwiefern Migrant/innen in der zweiten Generation der Bildungsweg erschwert wird.
Im nächsten Kapitel werden die Mechanismen der institutionellen Diskriminierung angeführt. Es wird erläutert, inwiefern die deutsche Sprache in der Schule als kulturelles Kapital eine große Rolle spielt und eine kurze Erklärung zum transkulturellen Ansatz geliefert. Um einen produktiven Ansatz im Bezug auf Transkulturalität und Mehrsprachigkeit anzuführen, wird kurz auf das schwedische Schulsystem eingegangen und dieses mit dem österreichischen System verglichen.
Im darauffolgenden Kapitel wird eine geschichtliche Analyse zum österreichischen Kulturbegriff geliefert und auf die nationale Sprachenpolitik eingegangen.
Der letzte Teil der Arbeit soll Antwort darauf geben, ob Mehrsprachigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund als kulturelles Kapital gelten kann und welche Folgen die Entwertung dieses Kapitals auf die Identitätsbildung haben kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gesellschaftspolitische Theorien im Kontext der Chancengleichheit für Jugendliche mit Migrationshintergrund
- 2.1. Illusion der Chancengleichheit
- 2.1.1. Bourdieus Kapitalkonzept
- 2.1.2. Soziale Ungerechtigkeiten bei Boudon
- 2.2. Die Vererbung der sozialen Position der Eltern
- 2.2.1. Die Vererbung der sozialen Position der Eltern bei Migrationshintergrund
- 2.2.2. Bildungsbenachteiligung als Folge der Entwertung des sozialen und kulturellen Kapitals
- 3. Institutionelle Diskriminierung in der Schule
- 3.1. Sprache und Macht
- 3.2. Exklusion und Inklusion
- 3.3. Die deutsche Standardsprache als kulturelles Kapital in der Schule
- 3.4. Mechanismen der Institutionelle Diskriminierung in der Schule
- 3.5. Schulsegregation
- 3.6. PISA und Migrantionskinder
- 3.7. Das schwedische und österreichische Schulsystem
- 4. Österreich und die kulturelle Identität
- 4.1. Nationale Sprachenpolitik in Österreich
- 5. Mehrsprachigkeit als Kapital
- 5.1. Die ökonomischen Gründe für den Fremdsprachenerwerb
- 5.2. Kann Mehrsprachigkeit bei Menschen mit Migrationshintergrund also als kulturelles Kapital gelten?
- 5.3. Transkulturalität
- 5.4. Sprache und Identität
- 5.4.1. Identität
- 5.4.2. Sprache und Identität im Kontext Migration
- 6. Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im Kontext von Bourdieus Kapitaltheorie. Sie analysiert, wie die Entwertung des kulturellen und sozialen Kapitals zu Bildungsungleichheit führt.
- Bourdieus Kapitalkonzept und die Vererbung sozialer Positionen
- Institutionelle Diskriminierung in der Schule und die Rolle der Sprache
- Das österreichische Schulsystem und die nationale Sprachenpolitik
- Mehrsprachigkeit als kulturelles Kapital und die Auswirkungen auf die Identitätsbildung
- Transkulturalität und der Ansatz des schwedischen Schulsystems
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Forschungsfrage ein und skizziert den Fokus der Arbeit auf die Bildungsbenachteiligung von Kindern mit Migrationshintergrund im Kontext von Bourdieus Kapitaltheorie. Kapitel 2 analysiert Bourdieus Kapitalkonzept und die Vererbung sozialer Positionen, wobei die Rolle des kulturellen Kapitals und die Ungleichheiten im Bildungssystem im Vordergrund stehen. Kapitel 3 befasst sich mit der institutionellen Diskriminierung in der Schule, insbesondere mit der Rolle der Sprache und den Mechanismen der Exklusion. Kapitel 4 untersucht die nationale Sprachenpolitik in Österreich und die Bedeutung der kulturellen Identität. Kapitel 5 analysiert Mehrsprachigkeit als kulturelles Kapital, die Auswirkungen auf die Identitätsbildung und die Bedeutung von Transkulturalität.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Migrationshintergrund, Bourdieu, Kapitaltheorie, kulturelles Kapital, soziales Kapital, institutionelle Diskriminierung, Sprache, Mehrsprachigkeit, Transkulturalität, österreichisches Schulsystem, nationale Sprachenpolitik, Identitätsbildung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Bourdieus Theorie der Chancengleichheit?
Bourdieu argumentiert, dass das Bildungssystem soziale Ungleichheiten reproduziert, indem es das kulturelle Kapital der herrschenden Klasse bevorzugt.
Wie führt die Entwertung von Kapital zu Bildungsbenachteiligung?
Wenn das kulturelle oder soziale Kapital von Migrantenfamilien (z.B. Mehrsprachigkeit) in der Schule nicht anerkannt wird, sinken die Bildungschancen der Kinder.
Was ist institutionelle Diskriminierung in der Schule?
Strukturelle Mechanismen im Schulsystem, die Kinder mit Migrationshintergrund benachteiligen, oft verbunden mit der Anforderung der deutschen Standardsprache.
Kann Mehrsprachigkeit als kulturelles Kapital gelten?
Die Arbeit untersucht, ob Mehrsprachigkeit als Ressource anerkannt werden kann oder ob sie durch nationale Sprachenpolitik eher als Hindernis gewertet wird.
Was unterscheidet das schwedische vom österreichischen Schulsystem?
Die Arbeit vergleicht beide Systeme hinsichtlich ihres Umgangs mit Transkulturalität und der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund.
- Quote paper
- Nora Blöchl (Author), 2016, Bildungsbenachteiligung bei Kindern mit Migrationshintergrund aufgrund der Entwertung des kulturellen und sozialen Kapitals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321172