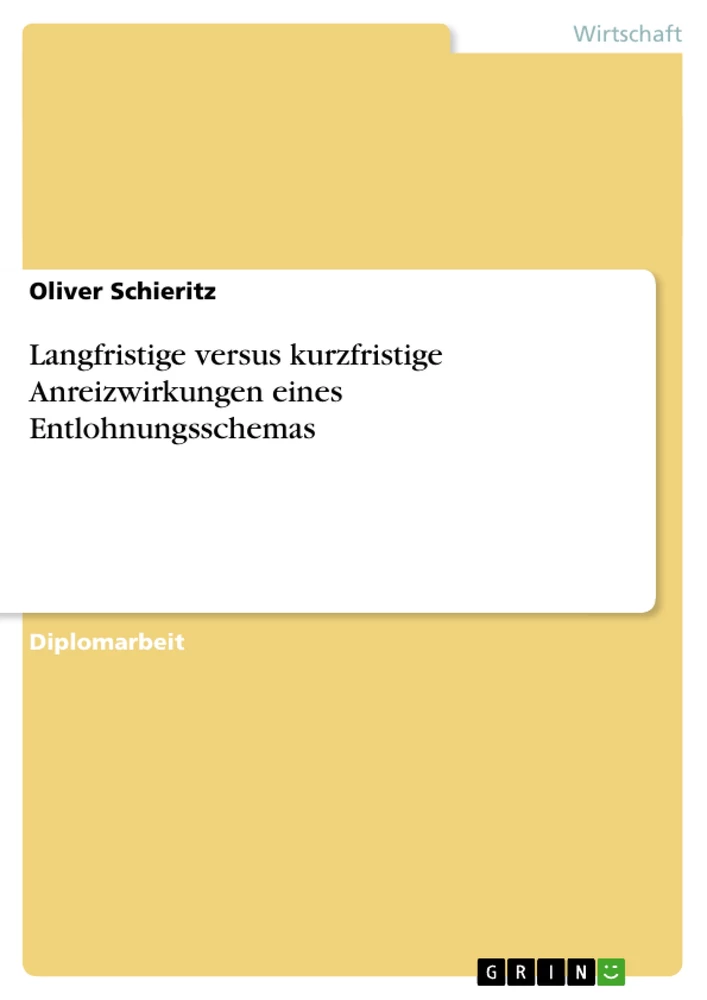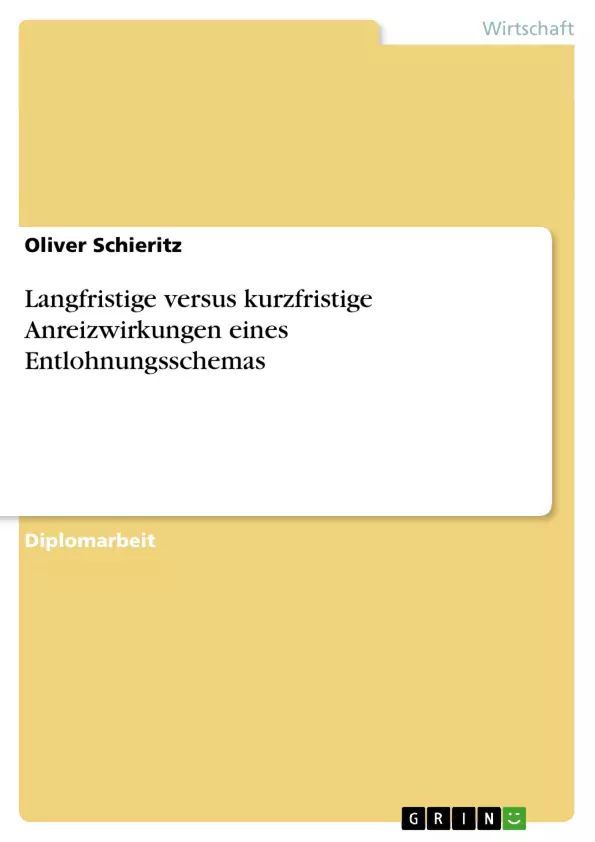In der letzten Zeit werden wieder Diskussionen um die Entlohnung von Top-Managern laut, denen nachgesagt wird, sie bereicherten sich über Gebühr mittels undurchsichtiger Bonuspläne. Im gleichen Atemzug wird den Spitzenmanagern unterstellt, sie würden keine langfristige Ausrichtung in ihren Entscheidungen erkennen lassen. Diese beiden Aussagen zusammengenommen führen zu einer interessanten Überlegung. Die Bonuszahlungen scheinen an Performance-Maße geknüpft zu sein, die einerseits nicht korrekt auf die Leistungen der Manager abgestimmt scheinen und andererseits die Manager dazu bringen Entscheidungen mit einer gewissen Kurzsichtigkeit vorzunehmen.
Hierbei schwingt das bekannte Problem der kurzen Zeithorizonte von Top-Managern mit. Gerade in Spitzenpositionen halten sich Manager meist nur für kurze Zeit. Basieren die Bonusgratifikationen auf Kennzahlen, die vor allem den kurzfristigen Unternehmenserfolg honorieren, wird kaum ein Manager Investitionen tätigen, deren Rückflüsse sich wahrscheinlich erst nach seiner Amtszeit realisieren werden.
Es liegt somit ein klassischer Interessenkonflikt vor, wie ihn die Prinzipal-Agenten-Theorie1 abbildet: Ein Agent, hier der Manager, führt Handlungen im Auftrag eines Prinzipals, hier die Anteilseigner, aus. Der Agent ist über seine Tätigkeit besser informiert als der Prinzipal, sodass eine asymmetrische Informationsverteilung vorliegt. Der Prinzipal kann nicht beobachten, ob der Agent in seinem Sinne handelt, das heißt langfristig optimale Entscheidungen trifft. Um den Agenten zu bewegen, sein Handeln auf die Ziele des Prinzipals abzustimmen werden Anreizsysteme eingesetzt. Diese haben zum Ziel die Leistungserbringung der Entscheidungsträger effizient abzustimmen.2 Die Anreizsysteme verwenden Kennzahlen, um die Leistung des Prinzipals zu messen. Je nachdem wie diese Performance-Maße beschaffen sind, können Verzerrungen entstehen. Diese äußern sich beispielsweise in einer unerwünschten Kurzsichtigkeit des Agenten inm Hinblick auf Entscheidungen.
Es ist demnach wichtig zu prüfen, auf welchen Kennzahlen die Anreizsysteme aufbauen. Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, ob eine bestimmte Gruppe von Kennzahlen – die nicht-finanziellen Performance-Maße – geeignet ist, durch den Einsatz in Anreizverträgen, Manager zu langfristig optimalen Entscheidungen zu bewegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Leistungsentlohnung und nicht-finanzielle Kennzahlen
- 2.1. Leistungsorientierte Entlohnung
- 2.2. Nicht-finanzielle Kennzahlen
- 3. Theoretische Modellierung
- 3.1. Das LEN-Modell als Basis
- 3.1.1. Grundlagen und Annahmen des LEN-Modells
- 3.1.2. Theoretische Probleme des LEN-Modells
- 3.1.3. Rechtfertigung linearer Kompensationsschemata
- 3.2. Ein multiperioden LEN-Modell
- 3.2.1. Grundannahmen und allgemeine Rahmenbedingungen
- 3.2.2. Unterschiedliche Modellszenarien
- 3.2.3. Vergleich von kurzer und langer Vertragslaufzeit
- 3.2.4. Der Einfluss von Nachverhandlungen
- 3.2.5. Ergebnisse der Modellszenarien im Überblick
- 3.1. Das LEN-Modell als Basis
- 4. Weitere Einflussgrößen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen verschiedener Entlohnungssysteme auf die langfristige und kurzfristige Anreizwirkung für Mitarbeiter. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Effekte von leistungsorientierten Entlohnungen und nicht-finanziellen Kennzahlen auf das Verhalten von Mitarbeitern.
- Untersuchung der Anreizwirkungen von Leistungsentlohnungssystemen
- Analyse des LEN-Modells als theoretische Grundlage
- Entwicklung eines multiperioden LEN-Modells zur Bewertung langfristiger und kurzfristiger Anreize
- Bedeutung von nicht-finanziellen Kennzahlen für die Mitarbeitermotivation
- Einfluss verschiedener Faktoren auf die Anreizwirkung von Entlohnungssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Problematik der Anreizwirkungen von Entlohnungssystemen ein. Sie erläutert die Relevanz der Thematik für Unternehmen und Mitarbeiter und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Kapitel 2: Leistungsentlohnung und nicht-finanzielle Kennzahlen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen der leistungsorientierten Entlohnung und beleuchtet den Einfluss nicht-finanzieller Kennzahlen auf die Mitarbeitermotivation und das Verhalten.
- Kapitel 3: Theoretische Modellierung
In diesem Kapitel wird das LEN-Modell als theoretische Grundlage für die Untersuchung der Anreizwirkungen von Entlohnungssystemen vorgestellt. Es werden die Grundlagen und Annahmen des Modells erläutert, sowie die theoretischen Probleme, die mit dem Modell verbunden sind. Das Kapitel behandelt auch die Rechtfertigung linearer Kompensationsschemata und entwickelt ein multiperioden LEN-Modell zur Analyse von langfristigen und kurzfristigen Anreizen.
- Kapitel 4: Weitere Einflussgrößen
Dieses Kapitel beleuchtet weitere Faktoren, die die Anreizwirkung von Entlohnungssystemen beeinflussen, wie z.B. die Risikobereitschaft von Mitarbeitern, die Kommunikationskultur im Unternehmen oder die Wettbewerbssituation am Markt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Leistungsentlohnung, Anreizwirkungen, LEN-Modell, multiperioden Modellierung, nicht-finanzielle Kennzahlen, Mitarbeitermotivation und Vertragsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen
Warum neigen Top-Manager oft zu kurzfristigen Entscheidungen?
Da Manager oft nur kurze Zeit im Amt sind und Boni an kurzfristige Finanzkennzahlen gekoppelt sind, meiden sie Investitionen, deren Erfolg erst nach ihrer Amtszeit eintritt.
Was ist das LEN-Modell?
Das LEN-Modell ist eine theoretische Grundlage der Prinzipal-Agenten-Theorie, um Anreizwirkungen linearer Entlohnungsschemata unter Unsicherheit zu analysieren.
Können nicht-finanzielle Kennzahlen die Langfristigkeit fördern?
Die Arbeit untersucht, ob Kennzahlen wie Kundenzufriedenheit oder Innovationskraft geeignet sind, Manager zu langfristig optimalen Entscheidungen zu bewegen.
Was ist asymmetrische Informationsverteilung?
Eine Situation, in der der Manager (Agent) besser über seine Handlungen informiert ist als der Anteilseigner (Prinzipal), was zu Interessenkonflikten führt.
Welchen Einfluss haben Nachverhandlungen auf Anreizverträge?
Nachverhandlungen können die ursprüngliche Anreizwirkung verzerren und werden im Rahmen eines multiperioden Modells kritisch betrachtet.
- Citation du texte
- Oliver Schieritz (Auteur), 2004, Langfristige versus kurzfristige Anreizwirkungen eines Entlohnungsschemas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32123