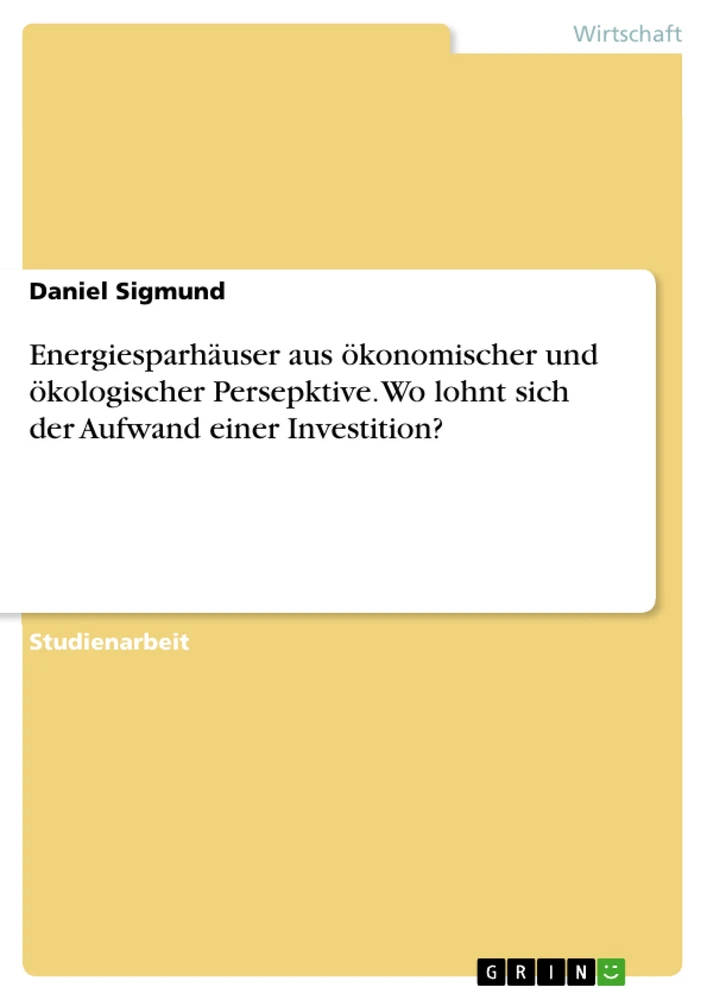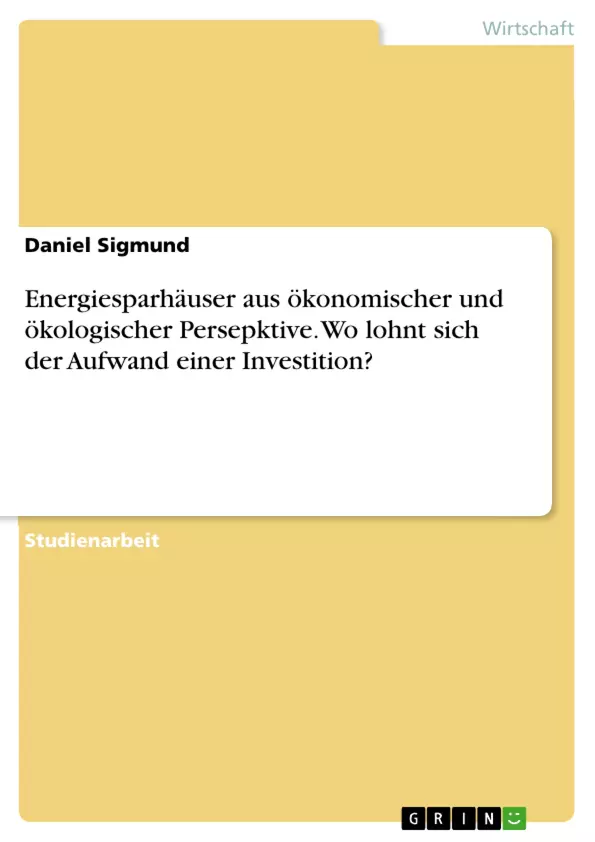Die Investition eines eigenen Hauses muss gut überlegt sein. Neben den Grundstückspreisen sowie den Baukosten spielen auch die anfallenden Energiekosten für Strom, Wärme etc. eine wichtige Rolle. Wer heutzutage ein Haus neu bauen oder renovieren möchte, muss sich an verschiedene Vorgaben halten, die für ein energiesparendes Bauen sorgen sollen.
Neben den gesetzlichen Vorgaben gibt es aber auch private Gründe, die für ein Energiesparhaus sprechen. Für die einen geht es um die Umwelt, für die anderen um das Geld, vielleicht aber auch um beides. Es soll also Energie gespart werden, was sich zum einen positiv auf die Umwelt und das Klima auswirkt, da es Ressourcen und CO2-Emissionen einspart und zusätzlich sollen die jährlichen Energiekosten durch den geringeren Verbrauch gesenkt werden. Doch werden diese Hoffnungen auch erfüllt? Ein Energiesparhaus weist meist deutlich höhere Bau- bzw. Renovierungskosten auf als ein konventionelles Haus. Rentieren sich diese höheren Kosten? Trage ich einen Teil zum Klimaschutz bei, wenn ich mich für ein Energiesparhaus entscheide und ab wann rentiert es sich für mich finanziell?
Doch das ist nur der privatwirtschaftliche Blick. Wie sieht es aus gesamtwirtschaftlicher Sicht aus? Deutschlands Gebäude benötigen mehr als 40 % der einheimischen Endenergie. Das zeigt, dass der Gebäudesektor ein großes Potential zum Energiesparen darstellt. Mithilfe von Förderprogrammen der KfW Bank zur Modernisierung von Bestandsgebäuden und günstigen Krediten für Neubauten mit geringem Energieverbrauch möchte die Regierung für Hausbesitzer Anreize zum Energiesparen schaffen. Auch hier kann man sich fragen, lohnt sich dieser Aufwand?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Energiesparhaustypen
- 3. Gesetzliche Grundlage
- 4. Mögliche Maßnahmen zum Energiesparen
- 5. Auswirkungen von Energiesparhäusern auf die Wirtschaft
- 5.1 Gesamtwirtschaftliche Wirkung
- 5.2 Auswirkungen staatlicher Förderungen auf den Arbeitsmarkt
- 6. Auswirkungen auf die Umwelt
- 7. Das Energiesparhaus aus privater Sicht
- 7.1 Allgemeine Betrachtung von Energiesparhäusern aus Sicht des Eigentümers
- 7.2 Ökonomische Evaluierung am Beispiel Hoheloogstraße
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Wirtschaftlichkeit und den ökologischen Nutzen von Energiesparhäusern in Deutschland. Sie analysiert verschiedene Energiesparhaustypen, die gesetzlichen Grundlagen und die Auswirkungen auf die Wirtschaft und Umwelt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der ökonomischen Bewertung aus Sicht des Hauseigentümers.
- Wirtschaftlichkeit von Energiesparhäusern im Vergleich zu konventionellen Häusern
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderprogramme für Energiesparhäuser
- Ökologische Auswirkungen von Energiesparhäusern auf die Umwelt
- Gesamtwirtschaftliche Effekte durch den Ausbau von Energiesparhäusern
- Private Nutzen-Kosten-Rechnung für den Bau oder die Sanierung eines Energiesparhauses
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Wirtschaftlichkeit von Energiesparhäusern. Sie beleuchtet die Bedeutung der Energiekosten im Kontext von Hausbau und -renovierung und hebt die privaten und gesamtwirtschaftlichen Aspekte des Themas hervor. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen sollen. Es wird der Spagat zwischen ökologischen und ökonomischen Überlegungen angesprochen, die beide in der Entscheidung für oder gegen ein Energiesparhaus eine Rolle spielen.
2. Energiesparhaustypen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Energiesparhaus“ und beschreibt verschiedene Typen wie Niedrigenergiehäuser, Niedrigstenergiehäuser, KfW-Effizienzhäuser, Passivhäuser, Nullenergie- und Plusenergiehäuser sowie 3-Liter-Häuser. Es werden die jeweiligen energetischen Anforderungen und die Unterschiede in den Energieverbrauchswerten erläutert, wobei die Klassifizierungssysteme der KfW und die Liter-Heizöl-Methode hervorgehoben werden. Die verschiedenen Definitionen werden kritisch gegenübergestellt und in ihren historischen Kontext gesetzt.
3. Gesetzliche Grundlage: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen für energiesparendes Bauen, angefangen von EU-Richtlinien über Bundesgesetze bis hin zu kommunalen Verordnungen. Es beleuchtet die Ziele dieser Regelungen, nämlich die Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden und den Beitrag zum Klimaschutz. Der Fokus liegt auf der Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Bau und die Renovierung von Energiesparhäusern beeinflussen.
Schlüsselwörter
Energiesparhaus, Wirtschaftlichkeit, Ökologie, KfW-Effizienzhäuser, Gesetzliche Grundlagen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Umwelt, Kosten-Nutzen-Analyse, Förderprogramme, CO2-Emissionen, Primärenergiebedarf.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Seminararbeit über Energiesparhäuser
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Wirtschaftlichkeit und den ökologischen Nutzen von Energiesparhäusern in Deutschland. Sie analysiert verschiedene Haustypen, gesetzliche Grundlagen und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Umwelt, mit besonderem Fokus auf die ökonomische Bewertung aus Eigentümersicht.
Welche Energiesparhaustypen werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Typen wie Niedrigenergiehäuser, Niedrigstenergiehäuser, KfW-Effizienzhäuser, Passivhäuser, Nullenergie- und Plusenergiehäuser sowie 3-Liter-Häuser. Die energetischen Anforderungen und Unterschiede im Energieverbrauch werden erläutert, inklusive der Klassifizierungssysteme der KfW und der Liter-Heizöl-Methode.
Welche gesetzlichen Grundlagen werden betrachtet?
Das Kapitel zur Gesetzgebung behandelt die rechtlichen Grundlagen für energiesparendes Bauen, von EU-Richtlinien und Bundesgesetzen bis zu kommunalen Verordnungen. Es beleuchtet die Ziele dieser Regelungen (Senkung des Energieverbrauchs und Beitrag zum Klimaschutz) und deren Einfluss auf den Bau und die Renovierung von Energiesparhäusern.
Welche wirtschaftlichen Aspekte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Wirtschaftlichkeit von Energiesparhäusern im Vergleich zu konventionellen Häusern, die Auswirkungen staatlicher Förderungen auf den Arbeitsmarkt und die gesamtwirtschaftlichen Effekte durch den Ausbau von Energiesparhäusern. Eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse wird anhand eines Beispiels durchgeführt.
Wie werden die ökologischen Auswirkungen betrachtet?
Die ökologischen Auswirkungen von Energiesparhäusern auf die Umwelt werden umfassend untersucht. Die Reduktion von CO2-Emissionen und der Beitrag zum Klimaschutz spielen dabei eine zentrale Rolle.
Welche Perspektive des Hauseigentümers wird eingenommen?
Die Arbeit beleuchtet die allgemeine Betrachtung von Energiesparhäusern aus Sicht des Eigentümers und führt eine ökonomische Evaluierung anhand eines konkreten Beispiels (Hoheloogstraße) durch. Dies beinhaltet die private Nutzen-Kosten-Rechnung für Bau oder Sanierung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Energiesparhaus, Wirtschaftlichkeit, Ökologie, KfW-Effizienzhäuser, Gesetzliche Grundlagen, Energieeinsparverordnung (EnEV), Umwelt, Kosten-Nutzen-Analyse, Förderprogramme, CO2-Emissionen, Primärenergiebedarf.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu Energiesparhaustypen, gesetzlichen Grundlagen, Maßnahmen zum Energiesparen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen sowie eine Betrachtung aus privater Sicht und ein Fazit. Zusätzlich gibt es eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Wo finde ich weitere Informationen?
Diese FAQ bieten einen Überblick über den Inhalt der Seminararbeit. Für detaillierte Informationen wird auf den vollständigen Text verwiesen.
- Citation du texte
- Daniel Sigmund (Auteur), 2014, Energiesparhäuser aus ökonomischer und ökologischer Persepktive. Wo lohnt sich der Aufwand einer Investition?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321279