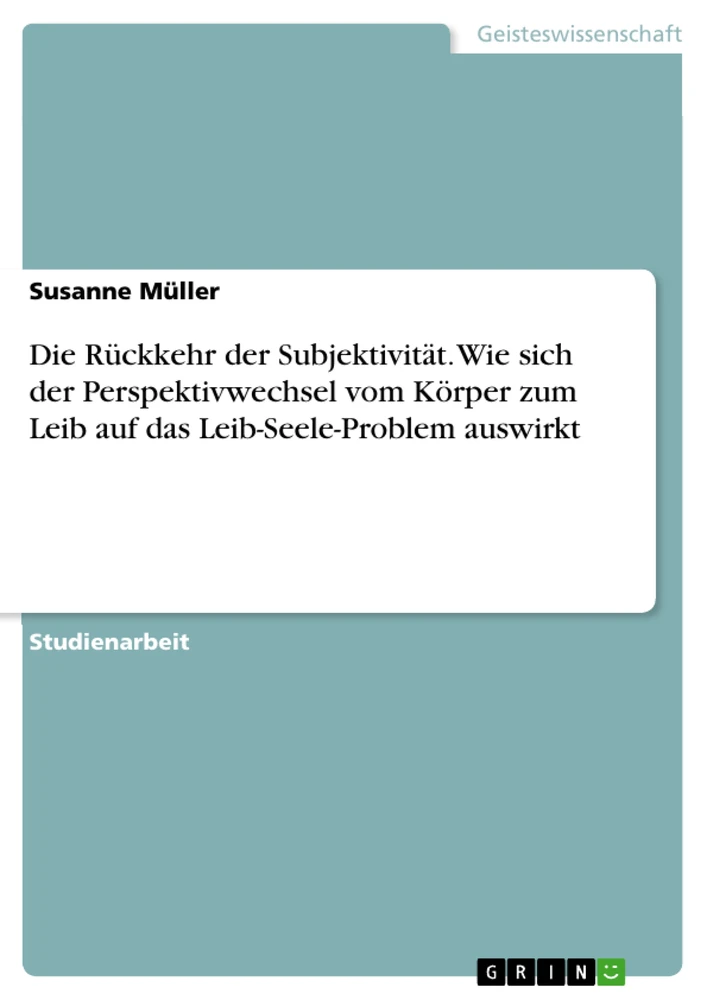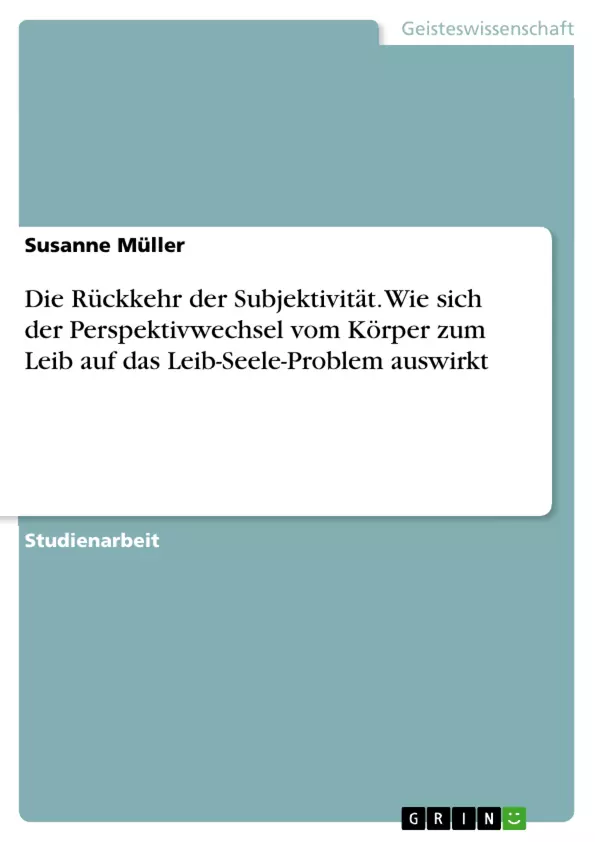Die unbequemen Fragen der Philosophie sind tief in Intuitionen verwurzelt, die unser Selbstverständnis als Personen und Menschen betreffen. Wir erleben uns als seelisch-geistige Wesen mit Wünschen, Wahrnehmungen und Absichten. Planvolles Handeln, Erinnerungen, Tagträume oder Nachdenken gehören zu unserer alltäglichen Lebenswelt. Doch auch technische Errungenschaften aus der Naturwissenschaft, die dem modernen Menschen zu mehr Komfort und wirtschaftlichem Fortschritt verhelfen, den gehobenen Lebensstandard der westlichen Welt sichern, Atomkerne teilen oder Krankheiten verhindern, gehören zu dieser Lebenswelt.
Die Grundannahmen der Naturwissenschaften werden kaum in Zweifel gezogen. Ihnen zufolge ist die Welt physisch kausal geschlossen. Jedem Ereignis geht ein anderes physisches Ereignis kausal voraus. Ebenso verhält es sich mit Ereignissen im menschlichen Gehirn. Aber an keiner Stelle in dieser Ursache-Wirkungs-Kette trifft man auf mentale Phänomene wie Absichten, Wünsche oder Empfindungen. Je kleinteiliger man die Strukturen und Prozesse des Gehirns durchkämmt, je schärfer die Mikroskope werden, sie können keine semantische Information, kein Glücksgefühl oder Schmerz, keine Erinnerung, keine Phantasie und kein Wissen ausmachen.
Selbst unter den Neurowissenschaftlern herrscht keine Einigkeit bezüglich des Erklärungswertes ihrer Ergebnisse zu mentalen Phänomenen. Bislang konnte sich die Wissenschaftsgemeinde auf keine vorherrschende Theorie über das Zusammenwirken von Geist und Gehirn einigen. Zwar glaubt man nicht nur in der Naturwissenschaft, dass mentale Phänomene rein physischer Natur sind, doch es verbleiben hartnäckig Erklärungsschwierigkeiten bezüglich phänomenaler Qualitäten.
Angesichts dieser komplexen Kontroverse soll ein Perspektivwechsel versucht werden, der durch die Ausführungen von Thomas Fuchs angeregt wurde. Fuchs schlägt vor, als Ausgangsbetrachtung den Menschen nicht als physischen Körper mit zusätzlichen mentalen Eigenschaften zu betrachten, sondern ihn als lebensweltlichen Leib, in seiner Gesamtheit mit allen inneren Facetten zu denken. Zusätzlich zu diesem Leib, ist der denkende Mensch auch noch zu einer rein naturwissenschaftlichen Betrachtung dieses Leibes fähig – der 3. Person Perspektive. Die leitende Forschungsfrage dieses Textes lautet daher: Welche Konsequenzen auf die Debatte hat ein Wechsel der Ausgangsperspektive von der rein naturwissenschaftlich physischen Betrachtung hin zu einer holistischen Leibbetrachtung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problem und Fragestellung
- Kapitel 1 - Vom Leib zum Körper und zurück
- Die unvereinbaren Prämissen
- Die Fuchs'sche Idee vom Leib - der Doppelaspekt
- Kapitel 2 - Die Wiedereingliederung der Seele
- Leib und Naturwissenschaft
- Konsequenzen der veränderten Ausgangsperspektive
- Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die sich aus dem Versuch ergeben, mentale Phänomene mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaften zu erklären. Der Fokus liegt auf dem klassischen Problem der mentalen Verursachung und der Frage, wie die Interaktion zwischen Geist und Gehirn zu verstehen ist.
- Das Problem der mentalen Verursachung und die Unvereinbarkeit von mentalen Phänomenen, physischen Ursachen und der kausalen Geschlossenheit der physischen Welt
- Die dominierende naturalistische Sichtweise in der analytischen Philosophie und die Reduktion mentaler Phänomene auf physische Eigenschaften
- Die Kritik an der Reduktion mentaler Phänomene und die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels
- Die Bedeutung des Leibes und seiner Rolle im Verhältnis von Geist und Körper
- Die Auswirkungen eines Perspektivwechsels vom Körper zum Leib auf das Leib-Seele-Problem
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der mentalen Verursachung im Kontext der modernen Philosophie und Neurowissenschaften vor. Sie beleuchtet die Unvereinbarkeit der drei Prämissen, die die Debatte prägen: mentale Phänomene sind nicht-physisch, mentale Phänomene können physische Phänomene verursachen, und die physische Welt ist lückenlos kausal geschlossen.
- Kapitel 1 - Vom Leib zum Körper und zurück: Dieses Kapitel untersucht die Prämissen, die die Debatte um die Interaktion von Geist und Körper prägen. Es analysiert die Fuchs'sche Idee vom Leib und die Auswirkungen eines Perspektivwechsels vom Körper zum Leib.
- Kapitel 2 - Die Wiedereingliederung der Seele: Dieses Kapitel widmet sich der Rolle des Leibes in der Naturwissenschaft und untersucht die Konsequenzen, die sich aus der veränderten Ausgangsperspektive ergeben. Es beleuchtet die Interaktion von Leib und Naturwissenschaft und untersucht die Auswirkungen auf die Debatte um Geist und Gehirn.
Schlüsselwörter
Mentale Verursachung, Leib, Körper, Geist, Gehirn, Naturwissenschaften, Neurowissenschaften, Philosophie des Geistes, Phänomenologie, Naturalismus, Reduktion, Perspektivwechsel, Leib-Seele-Problem, Intuitionen, Selbstverständnis, Empfindungen, Qualitäten, Erklärungsschwierigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Leib-Seele-Problem in der modernen Philosophie?
Es beschreibt die Schwierigkeit zu erklären, wie mentale Phänomene (Wünsche, Gefühle) und physische Prozesse im Gehirn interagieren, besonders wenn man von einer kausal geschlossenen physischen Welt ausgeht.
Was schlägt Thomas Fuchs als Perspektivwechsel vor?
Fuchs schlägt vor, den Menschen primär als „lebensweltlichen Leib“ in seiner Gesamtheit zu betrachten, anstatt ihn nur als physischen Körper mit zusätzlichen mentalen Eigenschaften zu sehen.
Was ist der Unterschied zwischen „Körper“ und „Leib“?
Der „Körper“ ist die naturwissenschaftliche Sichtweise von außen (3. Person), während der „Leib“ die subjektive, erlebte Gesamtheit des Menschen von innen (1. Person) beschreibt.
Können Neurowissenschaften Glücksgefühle oder Schmerz „sehen“?
Nein, Mikroskope und bildgebende Verfahren finden zwar physische Korrelate, können aber die subjektive phänomenale Qualität (wie sich Schmerz anfühlt) nicht direkt erfassen.
Was sind die Konsequenzen einer holistischen Leibbetrachtung?
Durch diesen Wechsel wird die Seele wieder eingegliedert und die strikte Trennung zwischen Geist und Materie zugunsten einer ganzheitlichen Sicht auf den lebendigen Menschen aufgehoben.
- Arbeit zitieren
- M.A. phil. Susanne Müller (Autor:in), 2016, Die Rückkehr der Subjektivität. Wie sich der Perspektivwechsel vom Körper zum Leib auf das Leib-Seele-Problem auswirkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321399