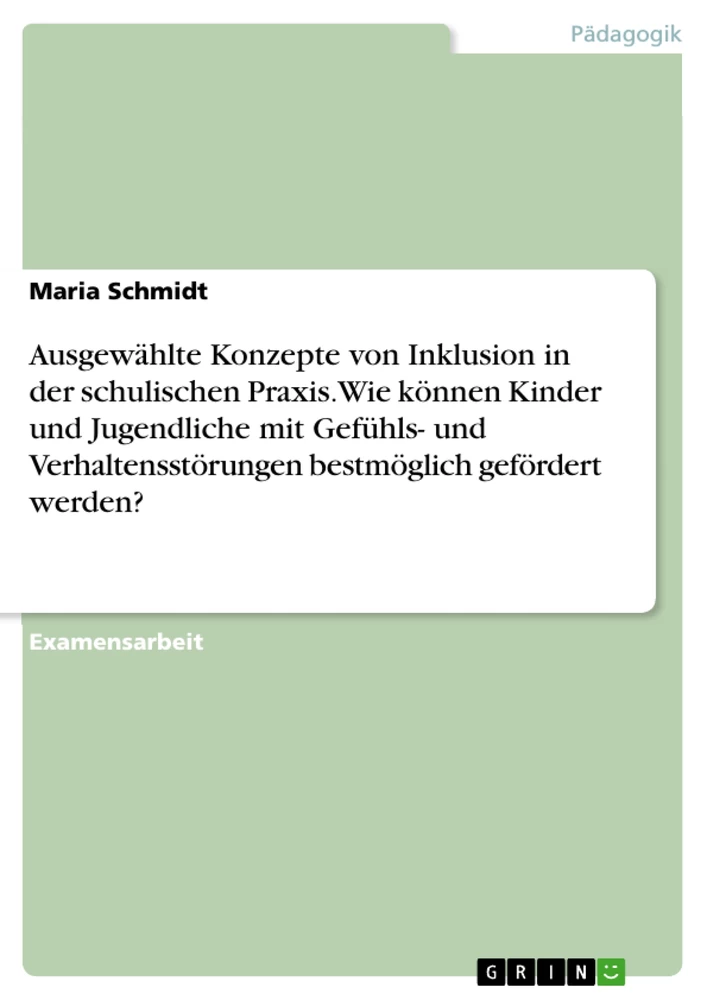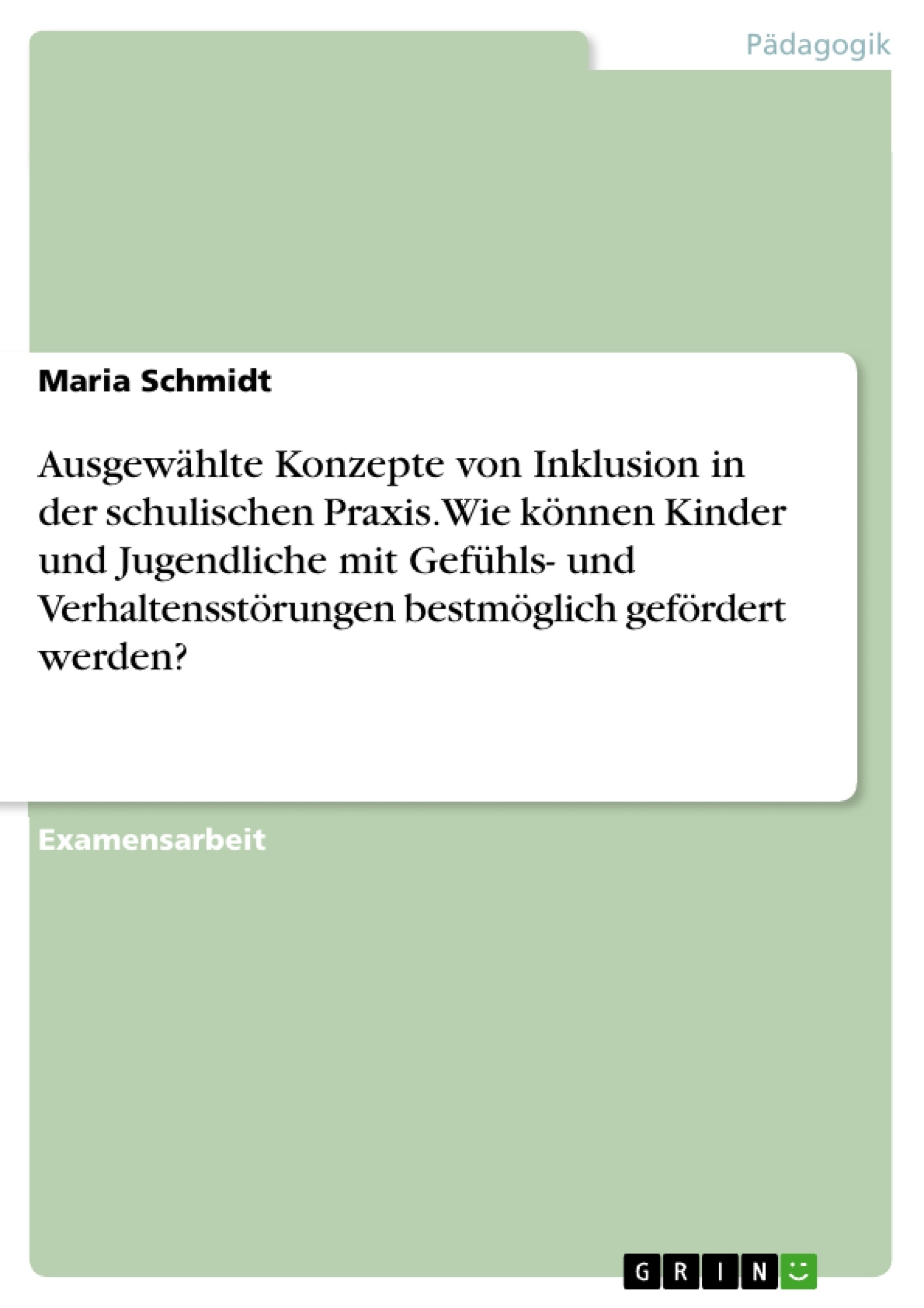Angesichts der aktuellen Debatte um Inklusion soll in dieser Arbeit eine gezielte Betrachtung der Anforderungen an die Institution Schule im Hinblick auf die soziale und emotionale Förderung von Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welche konkreten Ansprüche Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen aufgrund ihrer Lebenssituationen haben und welche Bedingungen sich daraus ergeben, die in einer Schule geschaffen werden müssen, um den Ansprüchen gerecht zu werden und ihnen eine angemessene schulische Umgebung zu bieten. Die Betrachtungen zu diesem Thema beziehen sich auf die inklusive Entwicklung in Deutschland und im Speziellen auf die Entwicklung in Sachsen-Anhalt.
Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich auf den Begriff und das Konzept Inklusion genauer eingehen. Rechtliche Grundlagen dieses Konzepts sowie die verschiedenen Formen schulischer Inklusion werden diskutiert. Abschließend erfolgt eine genaue Betrachtung des Standes der inklusiven Entwicklung in Sachsen-Anhalt. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen genau analysiert und dargestellt. Auf Grundlage der vorangegangenen Erkenntnisse und Betrachtungen wird im dritten Abschnitt dieser Arbeit ein eigenes Konzept für eine inklusive Schule entwickelt. Dieses Konzept orientiert sich vor allem an den besonderen Bedarfslagen der Kinder und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen und soll die Frage klären, welche speziellen Bedingungen in einer inklusiven Schule für diese Schülerinnen und Schüler geschaffen werden müssen um ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Da dieses entwickelte Konzept in der Realität aber nicht nachprüfbar ist und sich lediglich am Idealzustand orientiert, wird das Schulkonzept und damit verbunden der Landesschulversuch der IGS-Halle/Saale im vierten Teil der Arbeit untersucht. Die Ergebnisse dieses Landesschulversuchs sollen genutzt werden um das eigene erarbeitete Schulkonzept mit Praxiserfahrungen zu überarbeiten. Abschließend folgt eine Diskussion der wesentlichen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Partizipation in der Schule
- 2.1 Zur Definition des Behinderungsbegriffs
- 2.2 Der Weg zum gemeinsamen Lernen
- 2.3 Integration versus Inklusion
- 2.4 Konzepte zum Umgang mit Vielfalt in der Schule
- 3. Stand der inklusiven Entwicklung im Land Sachsen Anhalt
- 4. Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
- 4.1 Ausgangslage
- 4.1.1 Persönliche Dimension
- 4.1.2 Dimension des sozialen Umfelds
- 4.1.3 Gesellschaftliche Dimension
- 4.2 Begriffsklärung
- 4.3 Ursachen von Gefühls- und Verhaltensstörungen
- 4.4 Die Schule für Erziehungshilfe
- 4.4.1 Zielgruppe der Schule für Erziehungshilfe
- 4.4.2 Ziele und Aufgaben der Schule für Erziehungshilfe
- 4.5 Sonderpädagogischer Förderbedarf beim Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- 4.5.1 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
- 4.5.2 Formen sonderpädagogischer Förderung
- 5. Entwicklung eines Konzepts einer inklusiven Schule mit besonderer Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
- 5.1 Die Schule für Alle
- 5.1.1 Raum und Zeit
- 5.1.2 Beziehung
- 5.1.3 Schulleben
- 5.1.4 Profession
- 5.1.5 Ernährung
- 5.1.6 Gestaltung des Unterrichts
- 5.1.7 Benotung
- 5.1.8 Außerschulische Angebote
- 5.1.9 Kooperation
- 5.1.10 Neue Aufgabe der Diagnostik
- 5.2 Zusammenfassung
- 6. Schulentwicklung in der Praxis am Beispiel des Schulversuchs der Integrativen Gesamtschule Halle/Saale
- 6.1 Die Ausgangslage integrativer Entwicklungen
- 6.2 Rahmenbedingungen des Landesschulversuchs
- 6.3 Die Schulentwicklung während des Landesschulversuchs
- 6.3.1 Verlauf des Schulversuchs
- 6.3.2 Wissenschaftliche Begleitung
- 6.3.3 Ergebnisse des Schulversuchs aus Sicht der Schüler, Lehrer und Eltern
- 6.4 Fazit des Schulversuchs
- 7. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anforderungen an Schulen, um Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen inklusiv zu fördern. Ziel ist es, die spezifischen Bedürfnisse dieser Schüler zu ermitteln und daraus notwendige schulische Rahmenbedingungen abzuleiten. Die Arbeit bezieht sich auf die inklusive Entwicklung in Deutschland, insbesondere Sachsen-Anhalt.
- Konzept der Inklusion und seine Abgrenzung zur Integration
- Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
- Ursachen und Erscheinungsformen von Gefühls- und Verhaltensstörungen
- Entwicklung eines inklusiven Schulkonzepts
- Praxisbeispiel eines Schulversuchs zur integrativen Schulentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Inklusion in Deutschland vor, insbesondere im Kontext der UN-Behindertenrechtskonvention und dem steigenden Anteil von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, besonders im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung. Sie hebt die Bedeutung der sozialen Teilhabe und die Notwendigkeit einer effektiven Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen hervor und definiert das Ziel der Arbeit: die Erarbeitung von schulischen Rahmenbedingungen für eine angemessene Förderung von Schülern mit Gefühls- und Verhaltensstörungen.
2. Partizipation in der Schule: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Behinderung, den Weg zum gemeinsamen Lernen und differenziert zwischen Integration und Inklusion. Es analysiert verschiedene Konzepte für den Umgang mit Vielfalt in der Schule, um die theoretischen Grundlagen für die spätere Auseinandersetzung mit der Praxis der Inklusion zu schaffen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung eines Verständnisses für die unterschiedlichen Ansätze und deren Auswirkungen auf die Förderung von Schülern mit besonderem Förderbedarf.
3. Stand der inklusiven Entwicklung im Land Sachsen Anhalt: Dieses Kapitel beschreibt den aktuellen Stand der inklusiven Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt. Es analysiert die Fortschritte, Herausforderungen und spezifischen Gegebenheiten des Landes im Kontext der Inklusion. Die Darstellung liefert einen regionalen Kontext für die folgenden Kapitel und verdeutlicht die Besonderheiten der sächsisch-anhaltinischen Schulpraxis.
4. Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen: Dieses Kapitel analysiert die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen. Es befasst sich mit der Begriffsklärung, den Ursachen sowie der Darstellung verschiedener Störungsformen (externalisierend und internalisierend) und der Rolle der Schule für Erziehungshilfe. Die Kapitel unterstreichen die Komplexität der Thematik und beleuchten die verschiedenen Dimensionen (persönlich, soziales Umfeld, gesellschaftlich), die bei der Betrachtung dieser Schülergruppe berücksichtigt werden müssen.
5. Entwicklung eines Konzepts einer inklusiven Schule mit besonderer Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen: Dieses Kapitel entwirft ein Konzept für eine inklusive Schule, das sich speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen konzentriert. Es beschreibt notwendige Anpassungen in Bereichen wie Raumgestaltung, Beziehungen, Schulleben, Professionalisierung, Ernährung, Unterrichtsgestaltung, Benotung, außerschulische Angebote, Kooperation und Diagnostik. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer förderlichen und inklusiven Lernumgebung.
6. Schulentwicklung in der Praxis am Beispiel des Schulversuchs der Integrativen Gesamtschule Halle/Saale: Dieses Kapitel präsentiert ein Praxisbeispiel für inklusive Schulentwicklung anhand des Schulversuchs an der Integrativen Gesamtschule Halle/Saale. Es beschreibt die Ausgangslage, die Rahmenbedingungen, den Verlauf, die wissenschaftliche Begleitung und die Ergebnisse aus der Perspektive von Schülern, Lehrern und Eltern. Dieses Kapitel liefert wichtige Erkenntnisse für die Übertragbarkeit und Effektivität von inklusiven Modellen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Gefühls- und Verhaltensstörungen, emotionale und soziale Entwicklung, inklusive Schulentwicklung, Sachsen-Anhalt, Partizipation, Schulversuch, gemeinsame Schule.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Inklusive Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt - Fokus Gefühls- und Verhaltensstörungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anforderungen an Schulen, um Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen inklusiv zu fördern. Ziel ist die Ermittlung spezifischer Bedürfnisse dieser Schüler und die Ableitung notwendiger schulischer Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt auf der inklusiven Entwicklung in Sachsen-Anhalt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte von Inklusion und Integration, die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen, die Ursachen und Erscheinungsformen solcher Störungen, die Entwicklung eines inklusiven Schulkonzepts und ein Praxisbeispiel eines Schulversuchs zur integrativen Schulentwicklung in Sachsen-Anhalt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Partizipation in der Schule, Stand der inklusiven Entwicklung in Sachsen-Anhalt, Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen, Entwicklung eines Konzepts einer inklusiven Schule, Schulentwicklung in der Praxis (Beispiel Halle/Saale) und Diskussion. Jedes Kapitel wird durch eine Zusammenfassung erläutert.
Was versteht die Arbeit unter Inklusion und wie unterscheidet sie sich von Integration?
Die Arbeit differenziert explizit zwischen Inklusion und Integration. Während Integration ein Einbeziehen von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelschulunterricht beschreibt, geht Inklusion darüber hinaus und fordert die Gestaltung einer Schule für alle, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers eingeht und Teilhabe ermöglicht.
Welche Aspekte werden im Kapitel "Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Lebenslagen dieser Schülergruppe, klärt den Begriff, untersucht Ursachen und Erscheinungsformen (externalisierende und internalisierende Störungen), beleuchtet die Rolle der Schule für Erziehungshilfe und den sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich emotionaler und sozialer Entwicklung.
Wie sieht das entwickelte Konzept für eine inklusive Schule aus?
Das entwickelte Konzept beschreibt notwendige Anpassungen in Bereichen wie Raumgestaltung, Beziehungen, Schulleben, Professionalisierung der Lehrkräfte, Ernährung, Unterrichtsgestaltung, Benotung, außerschulische Angebote, Kooperation und Diagnostik. Ziel ist die Schaffung einer förderlichen und inklusiven Lernumgebung für alle Schüler, insbesondere für diejenigen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen.
Welches Praxisbeispiel wird vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert den Schulversuch der Integrativen Gesamtschule Halle/Saale. Beschrieben werden die Ausgangslage, die Rahmenbedingungen, der Verlauf, die wissenschaftliche Begleitung und die Ergebnisse aus Sicht der Schüler, Lehrer und Eltern. Dies dient als Beispiel für die Übertragbarkeit und Effektivität inklusiver Modelle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Integration, Sonderpädagogischer Förderbedarf, Gefühls- und Verhaltensstörungen, emotionale und soziale Entwicklung, inklusive Schulentwicklung, Sachsen-Anhalt, Partizipation, Schulversuch, gemeinsame Schule.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Dokument enthält ein ausführliches Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen, die einen Überblick über die behandelten Inhalte jedes Kapitels geben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Schulentwickler, Lehrer, Eltern, sowie Wissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema inklusive Schulentwicklung und der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Maria Schmidt (Autor:in), 2013, Ausgewählte Konzepte von Inklusion in der schulischen Praxis. Wie können Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen bestmöglich gefördert werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321429