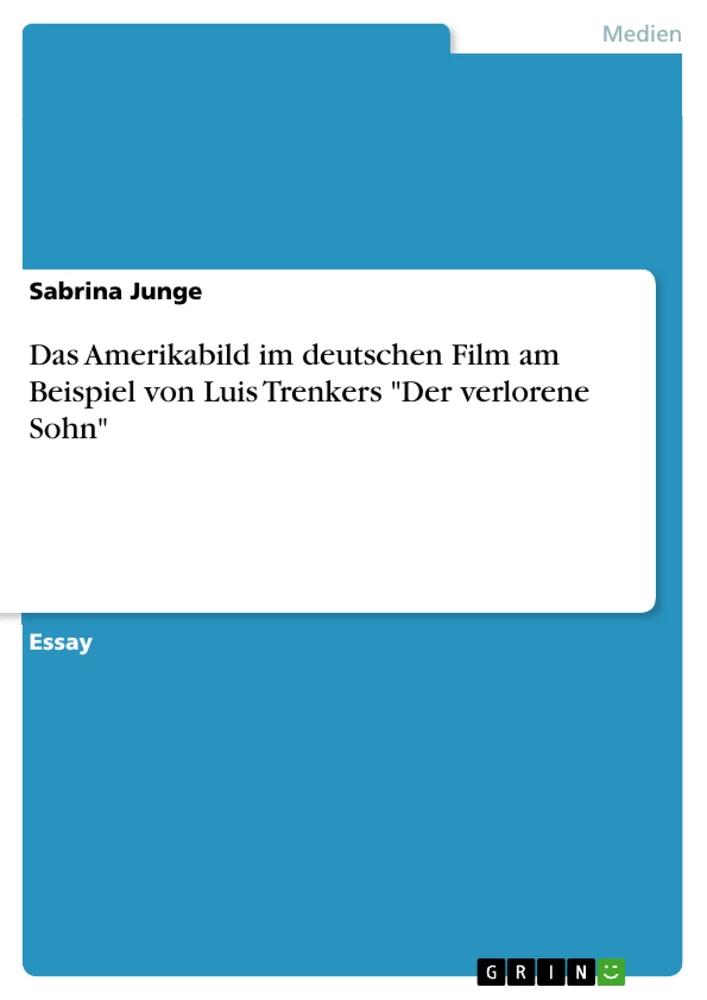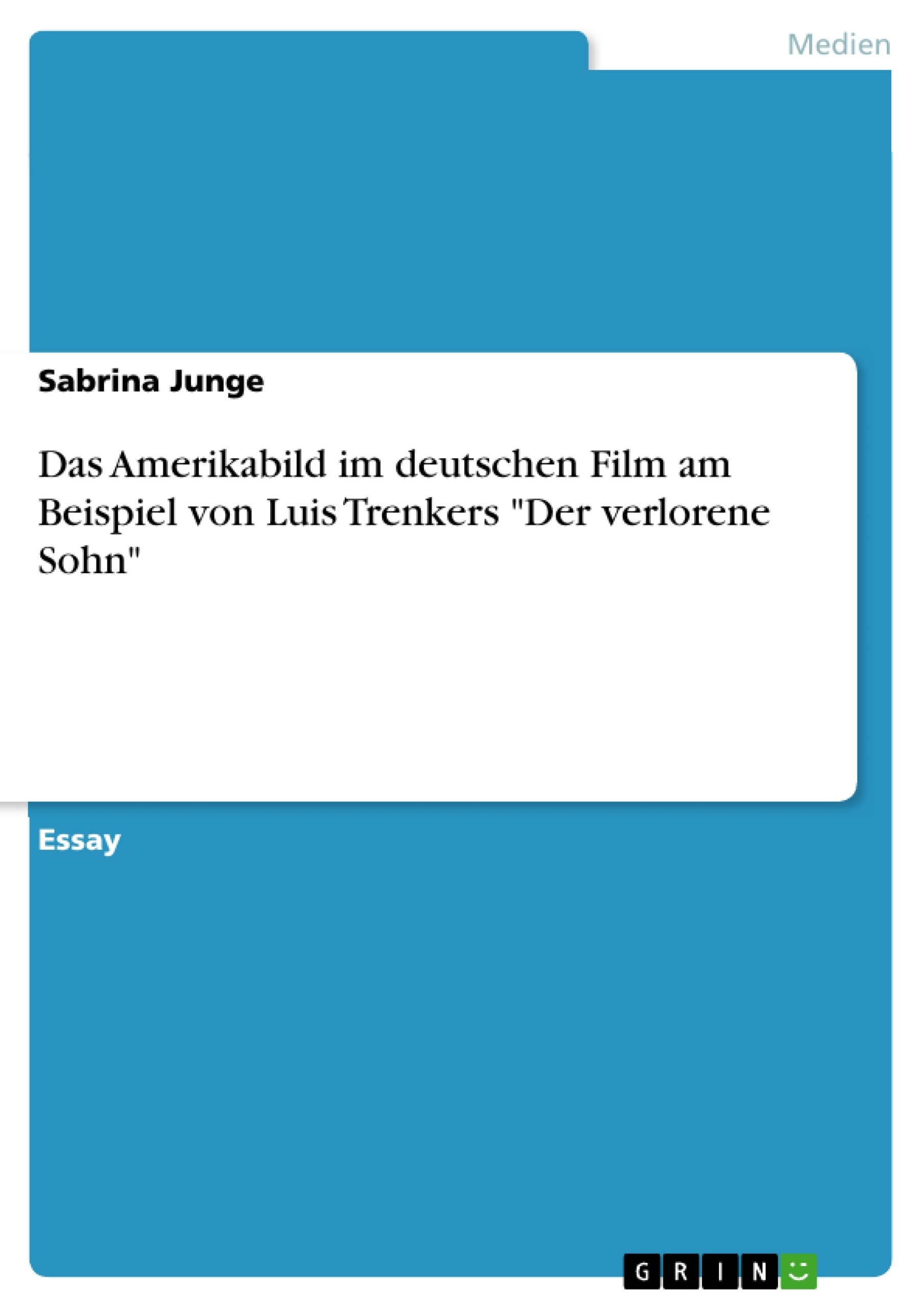1934 ist das Jahr, in dem Luis Trenker seinen Bergsteigerepos „Der verlorene Sohn“ veröffentlicht. Während Amerika derweilen mitten in der Great Depression steckt und das amerikanische Medienbild von der Populärkultur dominiert wird, ist in Deutschland bereits Hitler an der Macht.
Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung geht auch die Gleichschaltung der Medienlandschaft einher. Und es stellt sich die Frage, von welchen Einflüssen das Amerikabild Trenkers in „Der verlorene Sohn“ geprägt worden ist. Sein Bergfilm ist ein Beispiel aus der „Massenkultur“ zur Zeit der Great Depression. Inwiefern hat das, den zu den USA kontaktpflegenden Trenker dazu bewogen, Amerika anders zu präsentieren? Oder hat gar der Nationalsozialismus seinen Blick beeinflusst?
Inhaltsverzeichnis
- Populärkultur
- Das Amerikabild in „Der verlorene Sohn“
- Trenkers Amerika
- Amerikanisierung
- Das Bild Amerikas in „Der verlorene Sohn“
- Die Heimat wird verherrlicht
- Der Bergfilm
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Amerikabild im deutschen Film, insbesondere in Luis Trenkers Bergfilm "Der verlorene Sohn" aus dem Jahr 1934. Es wird analysiert, wie Trenkers Darstellung Amerikas von der damaligen Populärkultur und dem Nationalsozialismus beeinflusst wurde. Die Arbeit geht der Frage nach, inwiefern Trenker Amerika anders präsentierte als es in der Realität war und welche Rolle die nationalsozialistische Ideologie in der Gestaltung des Amerikabildes spielte.
- Das Amerikabild im deutschen Film
- Die Rolle der Populärkultur
- Der Einfluss des Nationalsozialismus
- Die Darstellung von Amerika in "Der verlorene Sohn"
- Die Bedeutung der Heimat in Trenkers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel erläutert den Begriff der Populärkultur und ihren Aufstieg im frühen 20. Jahrhundert. Es wird auch die „Amerikanisierung“ und die damit verbundenen Thesen des Kulturimperialismus diskutiert.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Darstellung Amerikas in "Der verlorene Sohn". Es werden die Ambivalenzen, die Trenker in seinem Film zum Ausdruck bringt, analysiert, sowohl die Bewunderung für New York als auch die Darstellung der Stadt als kalte und unfreundliche Fremde.
- Im dritten Kapitel wird die Frage untersucht, inwiefern Trenkers eigene Erfahrungen in Amerika seinen Blick auf das Land geprägt haben. Es wird auch die Rolle der Nationalsozialisten und ihre Nutzung von "Der verlorene Sohn" als Propagandainstrument beleuchtet.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage der "Amerikanisierung" der deutschen Medienlandschaft. Es wird argumentiert, dass die "Amerikanisierung" in Deutschland erst in späteren Jahren stattgefunden hat.
- Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Bedeutung von "Der verlorene Sohn" als Beispiel für die Verherrlichung der Heimat im nationalsozialistischen Deutschland.
- Das sechste Kapitel geht auf die Charakteristika des Bergfilms ein und beleuchtet die Nutzung von "Der verlorene Sohn" als Propagandainstrument durch die Nationalsozialisten.
- Das siebte Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung des Films im Kontext der damaligen Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen: Amerikabild, Populärkultur, Nationalsozialismus, Bergfilm, Heimat, „Amerikanisierung“, "Der verlorene Sohn", Luis Trenker. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung von Amerika in Trenkers Film und die Einflüsse, die die Gestaltung des Amerikabildes prägten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Amerika in Trenkers Film "Der verlorene Sohn" dargestellt?
Amerika, insbesondere New York, wird ambivalent dargestellt: Einerseits als faszinierende Metropole, andererseits als kalte, anonyme und lebensfeindliche Fremde während der Weltwirtschaftskrise.
Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf den Film?
Die Nationalsozialisten nutzten den Film als Propagandainstrument, um die "Heimat" (die Berge) als moralisch überlegen gegenüber dem "dekadenten" Amerika zu verherrlichen.
Was bedeutet "Amerikanisierung" im Kontext von 1934?
Die Arbeit diskutiert, inwiefern US-amerikanische Populärkultur bereits die deutsche Medienlandschaft beeinflusste und wie Trenker auf diesen Kulturimperialismus reagierte.
Warum wählte Luis Trenker das Genre des Bergfilms für diese Kritik?
Der Bergfilm bot den idealen visuellen Kontrast: Die Beständigkeit und Reinheit der Alpen gegen die Schnelllebigkeit und den sozialen Abstieg in den Häuserschluchten New Yorks.
War Trenker selbst Amerika gegenüber eingestellt?
Trenker pflegte durchaus Kontakte in die USA, was seine Darstellung im Film beeinflusste, da er eigene Erfahrungen aus der Zeit der Great Depression einfließen ließ.
- Quote paper
- Sabrina Junge (Author), 2013, Das Amerikabild im deutschen Film am Beispiel von Luis Trenkers "Der verlorene Sohn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321504